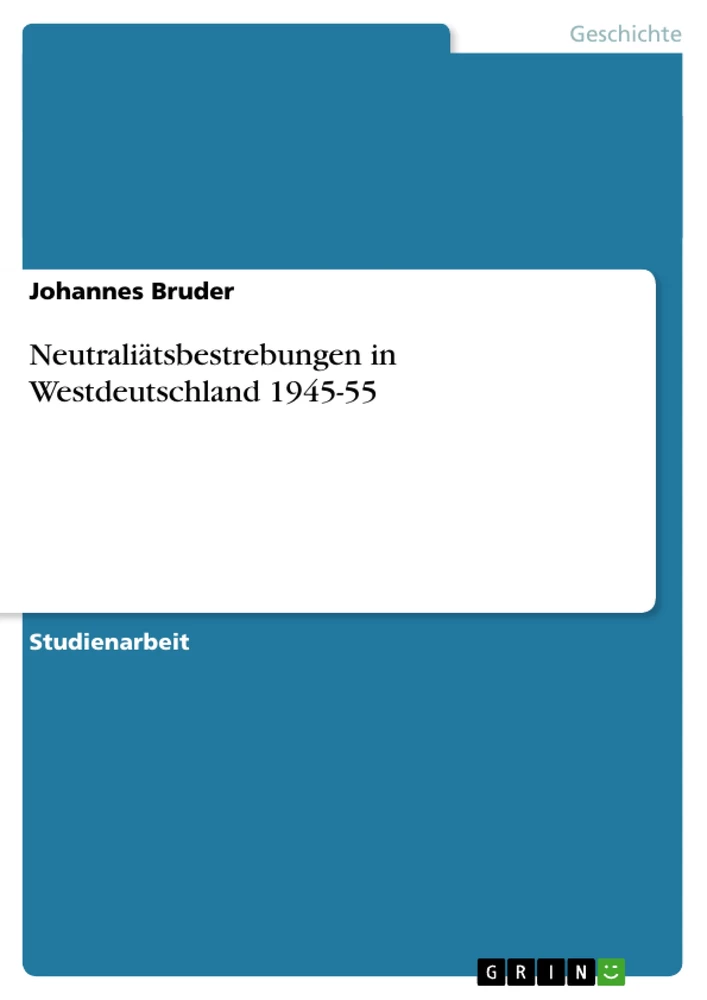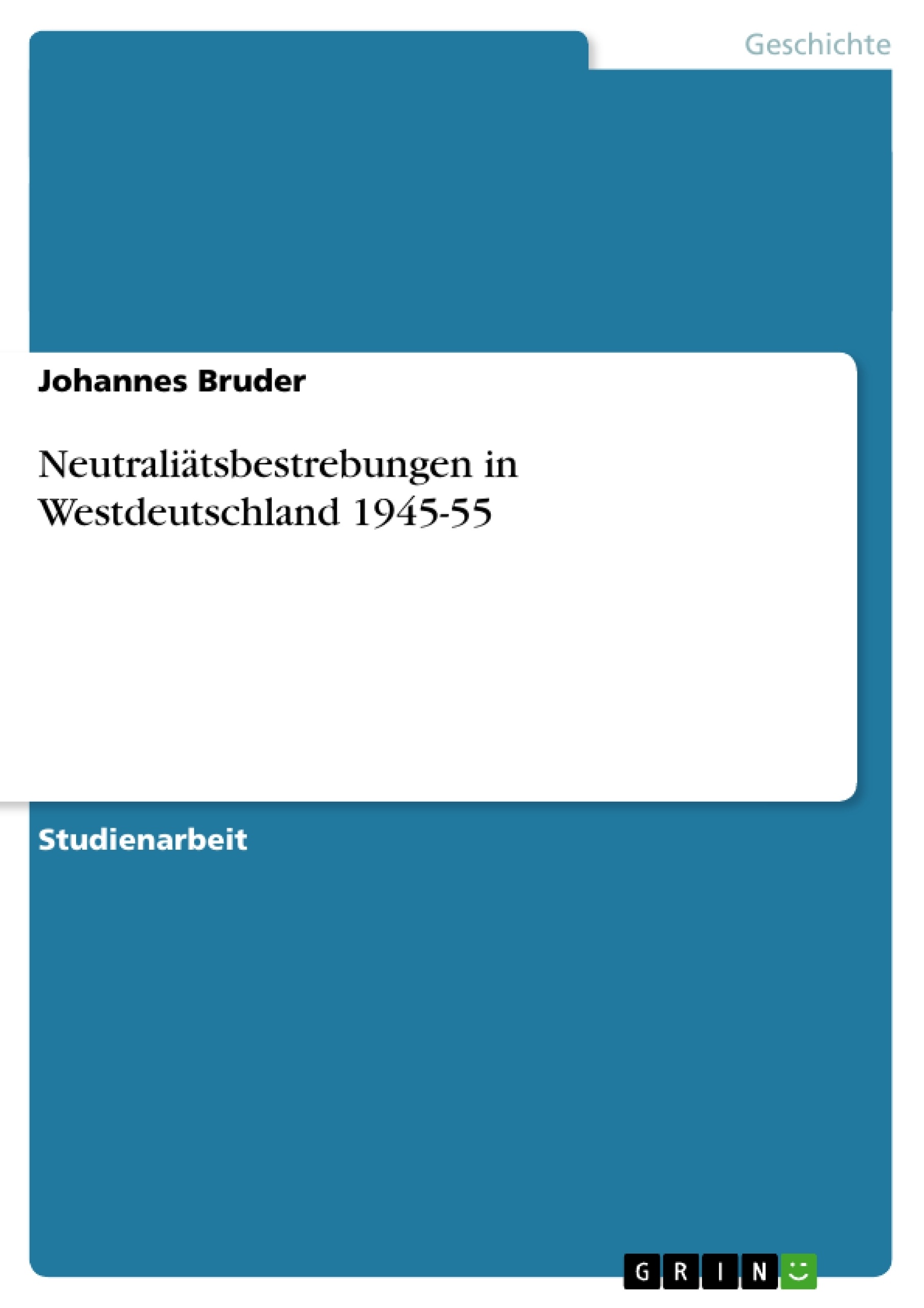Die Geschichte der Neutralitätsbestrebungen in Deutschland nach dem 2. Weltkrieg beginnt im Grunde mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945. Auch wenn die ersten Bemühungen um eine deutsche Neutralität erst im Jahre 1947 an die Öffentlichkeit drangen, so mussten schon mit der Errichtung der sowjetischen Militäradministration (SMAD) im Juni und der Potsdamer Viermächtekonferenz im Juli und August 1945 die Frage auftauchen, wie die Teilung Deutschlands in zwei unabhängige Staaten abzuwenden sei. Ob nun die Erhaltung nationalistischen Gedankenguts oder im Gegenteil die Wiedergutmachung der Taten des Nationalsozialismus, ob eine neue Gesellschaftsordnung oder eine aus der geostrategischen Lage Deutschlands abgeleitete Mittlerfunktion zwischen den sich konstituierenden Machtblöcken das Ziel war, die Wiedervereinigung Deutschlands unter dem Paradigma Neutralität schrieben sich viele auf ihre Fahnen. Manche nur zur Kaschierung unerwünschten Gedankenguts, andere aus voller Überzeugung. Die verschiedenen Strömungen innerhalb der Neutralitätsbewegung lassen sich grob in Befürworter und Gegner des sogenannten „Dritten Weges“ unterscheiden. Unter diesem Schlagwort könnte man ganz allgemein ein Absage an den >westlichen Individualismus< wie an den >östlichen Kollektivismus<, verbunden mit einem deutschen Sonderweg zur Erreichung der Wiedervereinigung verstehen.
Die Geschichte der Neutralitätsbestrebungen in Westdeutschland blieb indes eine der Solisten und Protagonisten. Viele kleine Vereinigungen und Diskussionszirkel lebten von den Ideen ihrer Protagonisten, eine pluralistische Willensbildung fand in ihnen nicht statt, ja, sie war oftmals gar nicht erwünscht.
Ausgehend von einer Darstellung der Aktionen, Ideen und Erfolge der „Neutralisten“ (Abschnitte 2-4) soll daher im folgenden die Frage nach der Perspektive dieser Konzeptionen beantwortet werden (Abschnitt 5). Hat die Regierung Adenauer das Wort Neutralität zu Unrecht aus ihrem Wortschatz verbannt ? Waren die Konzeptionen der „Neutralisten“ tragfähig und wenn ja, warum sind sie gescheitert ?
Inhaltsverzeichnis
- Deutschland als Brücke zwischen Ost und West
- Die Heidelberger Aktionsgruppe zur Demokratie und zum freien Sozialismus
- Die Gesellschaft für die Wiedervereinigung Deutschlands
- Befürworter der Alternative Dritter Weg
- Die Oppositionellen Sozialdemokraten
- Theodor Köglers Freiheitsbund
- Wolf Schenke und die Dritte Front
- Gegner des Dritten Wegs
- Ulrich Noack und der Nauheimer Kreis
- Neutralitätsbestrebungen in den etablierten Parteien
- Gustav Heinemann und die GVP
- Kurt Schumacher und Fritz Erler in der SPD
- Thomas Dehler und Karl Pfleiderer in der FDP
- Der Deutsche Kongress als Sammlungsbewegung
- Chancen und Risiken der Neutralisierungskonzepte
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Neutralitätsbestrebungen in der westdeutschen Politik zwischen 1945 und 1955. Sie analysiert die verschiedenen Akteure und ihre Konzeptionen, die sich für eine neutrale Position Deutschlands zwischen den Ost- und Westblöcken einsetzten. Die Arbeit beleuchtet die Hintergründe, die Ziele und die Herausforderungen dieser Bestrebungen sowie die Gründe für ihr Scheitern.
- Die Entwicklung der Neutralitätsbewegung in Westdeutschland
- Die verschiedenen Konzepte und Akteure der Neutralitätsbewegung
- Die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Neutralitätsbestrebungen
- Die Chancen und Risiken der Neutralisierungskonzepte
- Die Gründe für das Scheitern der Neutralitätsbestrebungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Entstehung der Neutralitätsbestrebungen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Es zeigt auf, wie die Idee einer neutralen Position Deutschlands als Alternative zur Zwei-Blöcke-Welt im Kontext der damaligen politischen und gesellschaftlichen Lage entstand.
Das zweite Kapitel stellt die Heidelberger Aktionsgruppe zur Demokratie und zum freien Sozialismus vor. Diese Gruppe, bestehend aus Universitätsprofessoren, entwickelte ein Konzept für eine neutrale Position Deutschlands, die auf einer Mischung aus nationalem Verzicht und nationalem Anspruch basierte.
Das dritte Kapitel widmet sich der Gesellschaft für die Wiedervereinigung Deutschlands, die sich ebenfalls für eine neutrale Position Deutschlands einsetzte. Die Gruppe, unter der Leitung des ehemaligen deutschen Botschafters in Moskau, Rudolf Nadolny, verfolgte ein Konzept, das auf den Ideen von Bismarck und Stresemann basierte.
Das vierte Kapitel beleuchtet die Gegner des "Dritten Weges", die sich gegen eine neutrale Position Deutschlands aussprachen. Neben dem Nauheimer Kreis, einer Gruppe von Politikern und Intellektuellen, werden auch die Positionen der etablierten Parteien - insbesondere der SPD und FDP - dargestellt.
Das fünfte Kapitel untersucht die Chancen und Risiken der Neutralisierungskonzepte. Es analysiert die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen, die sich aus einer neutralen Position Deutschlands ergeben hätten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die wichtigsten Schlüsselwörter und Themenfelder der Neutralitätsbestrebungen in der westdeutschen Politik zwischen 1945 und 1955: Neutralität, Wiedervereinigung, Dritter Weg, Ost-West-Konflikt, deutsche Außenpolitik, deutsche Sicherheitspolitik, Heidelberger Aktionsgruppe, Gesellschaft für die Wiedervereinigung Deutschlands, Nauheimer Kreis, Adenauer-Regierung, SPD, FDP, deutsche Geschichte.
- Quote paper
- Johannes Bruder (Author), 2004, Neutraliätsbestrebungen in Westdeutschland 1945-55, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/50389