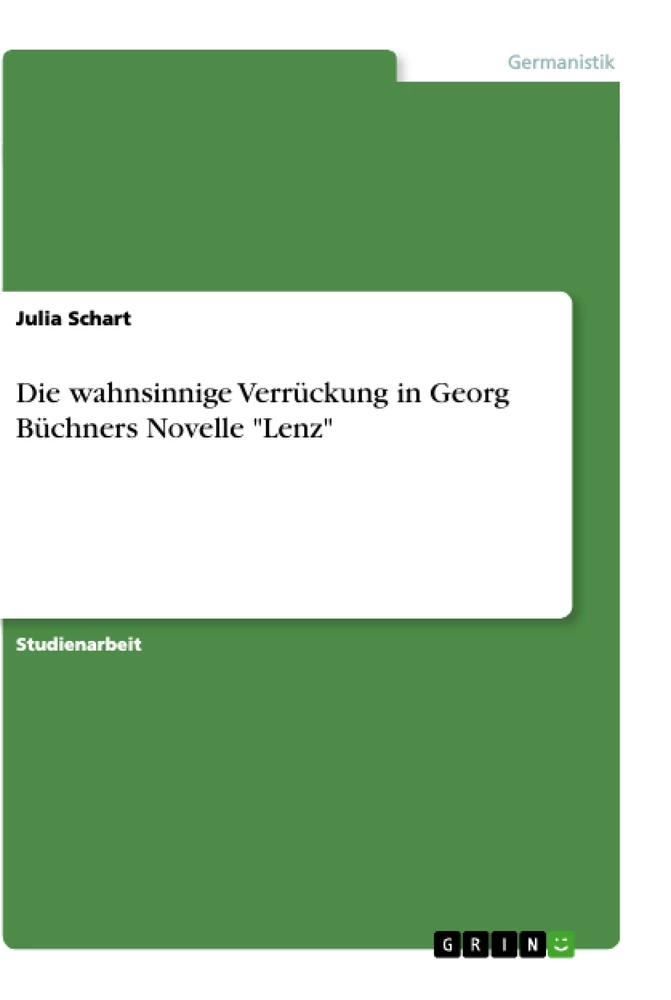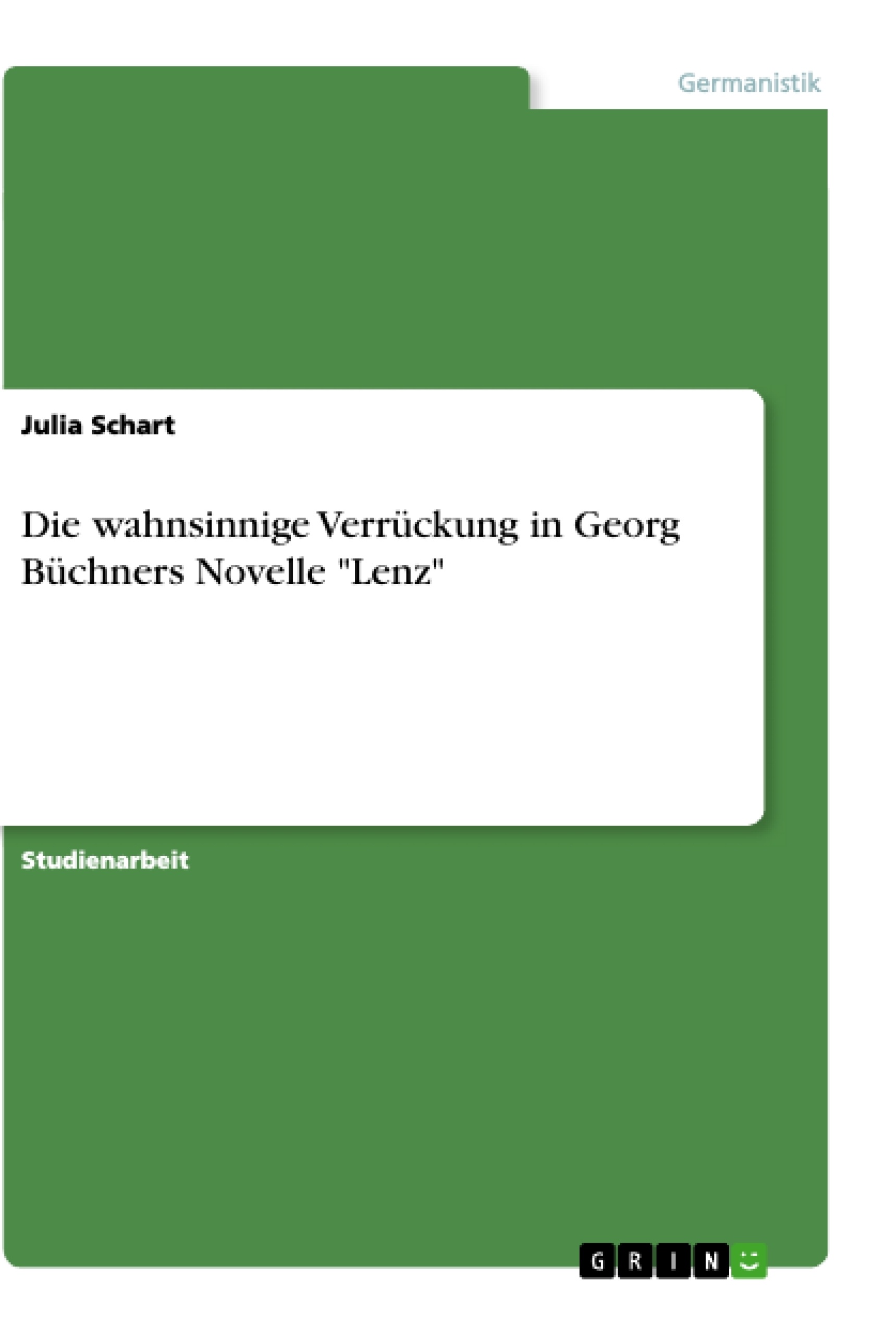Diese Arbeit untersucht die Motive des Wahnsinns, Irrsinns und der Melancholie in Georg Büchners Novelle "Lenz". Getrieben von Schüben des Wahnsinns, flüchtet sich jener Protagonist ins Steintal nach Waldersbach, ein Ort in den Vogesen, zu einem gewissen Pfarrer mit dem Namen Johann Friedrich Oberlin. Der Geistliche des Dorfes ist nicht nur kommunaler Seelsorger und Prediger, sondern wird auch zu Lenz' engster und wichtigster Bezugsperson, die ihm stets neuen Mut und Kraft verleiht, Trost spendet und seine Klagen anhört. Während dieser Zeit hatte Oberlin immer wieder Gelegenheit schriftliche Aufzeichnungen bezüglich seiner Erfahrungen und Erlebnisse mit dem ziellosen Schützling zu machen und diese auf Papier festzuhalten.
Büchner hingegen war es, der irgendwann all diese Notizen für sich wiederentdeckte und daraufhin entschied die einst niedergeschriebenen zwischenmenschlichen Verhältnisse und persönlichen Sorgen, Qualen und Ängste eines J.M.R. Lenz neu zu arrangieren und daraus ein Buch zu verfassen. Ferner setzte er dabei das sogenannte Kunstgespräch ein, ein sprachliches Mittel, welches ihm die Möglichkeit bot auch seinen individuellen Gedanken und Erfahrungen Ausdruck zu verleihen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die Literaten Lenz und Büchner
- 2. Von Auf und Abs bis hin zum Wahnsinn – die sprachliche Umsetzung
- 3. Lenz im Steintal - die emotionale Umsetzung
- 4. Schluss
- 5. Quellennachweise
- 6. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Novelle „Lenz“ von Georg Büchner ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit dem Leben und dem geistigen Verfall des jungen Schriftstellers Jakob Michael Reinhold Lenz. Büchner zeichnet in seinem Werk ein eindringliches Bild von Lenz' psychischem Zerfall und der Suche nach Halt und Sinn in einer Welt, die ihm zunehmend fremd erscheint. Die Novelle beleuchtet nicht nur die tragische Geschichte Lenz' sondern erforscht auch die Grenzen zwischen Vernunft und Wahnsinn sowie die komplexen Wechselwirkungen zwischen Individuum und Gesellschaft.
- Die Darstellung des psychischen Verfalls von J.M.R. Lenz
- Die Rolle der Sprache als Ausdruck von Wahnsinn und Innerlichkeit
- Die Beziehung zwischen Lenz und Pfarrer Oberlin
- Die Konfrontation mit der Natur als Spiegelbild innerer Zustände
- Die literarische Verarbeitung historischer Figuren und Ereignisse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen einführenden Überblick über die Leben und Werke von Jakob Michael Reinhold Lenz und Georg Büchner. Sie stellt die zentrale Frage nach dem Verhältnis von Genie und Wahnsinn und führt in die Thematik von Lenz' psychischem Verfall und seiner Suche nach Halt ein. Im ersten Kapitel werden die Lebensläufe der beiden Literaten Lenz und Büchner beleuchtet. Es werden Parallelen und Unterschiede ihrer Lebenswege sowie ihre Beziehungen zur Literatur und zum gesellschaftlichen Umfeld aufgezeigt. Das zweite Kapitel befasst sich mit der sprachlichen Umsetzung von Lenz' psychischem Zustand in der Novelle. Es wird analysiert, wie Büchner durch sprachliche Mittel wie Metaphern, Bilder und Rhythmus die innere Zerrissenheit und den Zerfall der Persönlichkeit Lenz' darzustellen vermag.
Schlüsselwörter
Die Novelle „Lenz“ behandelt Themen wie Wahnsinn, Irrsinn, Melancholie, Literatur, Schriftstellerei, Sturm und Drang, Geisteskrankheit, Natur, Religion, Gesellschaft, Individuum, Sprache, Identität, Existenz und Tragik.
- Quote paper
- Julia Schart (Author), 2010, Die wahnsinnige Verrückung in Georg Büchners Novelle "Lenz", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/503418