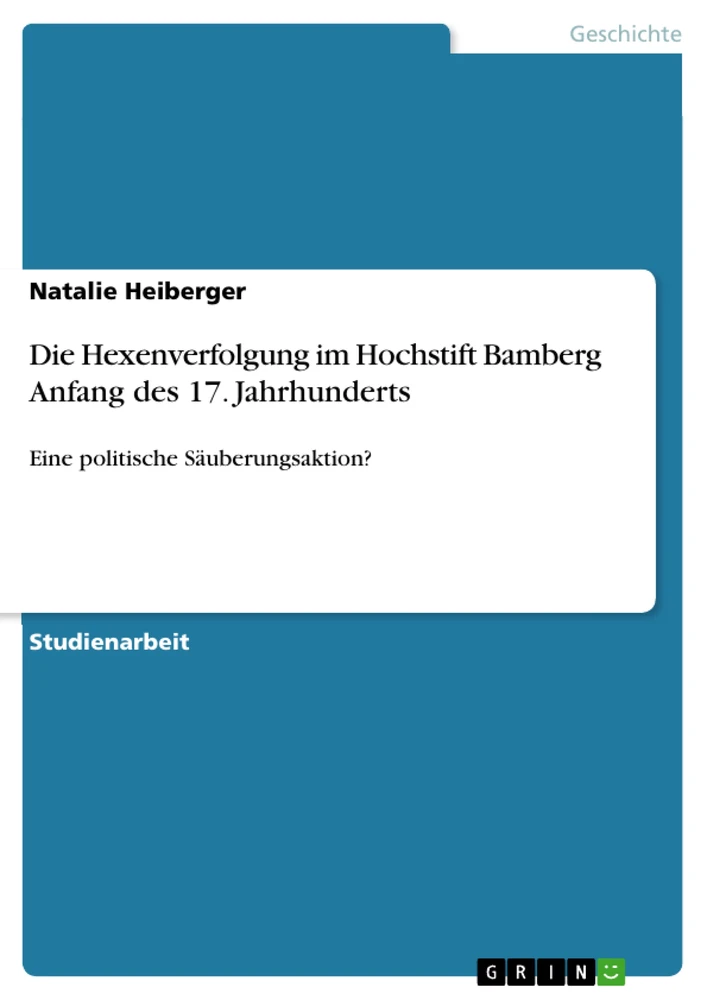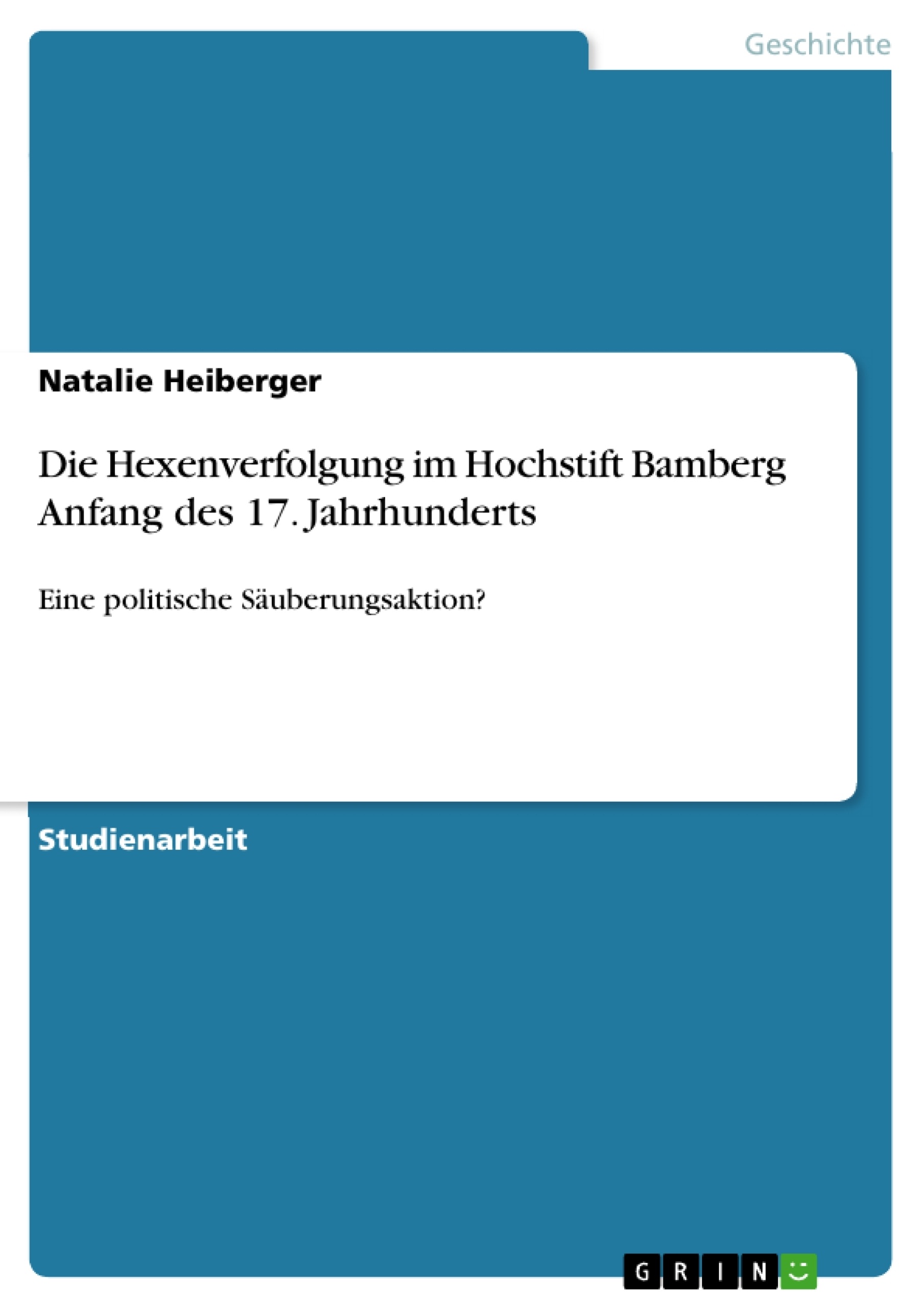Die Verfolgung von vermeintlichen Anhängern einer Hexensekte und ihrer Exekution stellte im beginnenden 17. Jahrhundert im Hochstift Bamberg einen zutiefst erschreckenden Vorfall dar, dem etwa 1000 Menschen zum Opfer fielen. Was Bamberg von ähnlichen Ereignissen in anderen Territorien unterschied, waren primär die große Zahlen der Hingerichteten, trotz der Einstufung der Hexerei als Ausnahmeverbrechen und die Planmäßigkeit mit der gegen vermeintliche Hexen vorgegangen wurde. In zwei Jahrzehnten fanden drei Prozesswellen statt, die sich in ihrer Intensität steigerten. Eines der wenigen Zeugnisse der Hexenverfolgung. Eines der Opfer der Prozesswellen war Johannes Junius, der im Alter von 55 Jahren, der Hexerei bezichtigt und anschließend hingerichtete wurde.
Johannes Junius gehörte der städtischen Oberschicht an, war Ratsmitglied, und fungierte zeitweise als Unter- und Ober- Bürgermeister der Stadt Bamberg. Fiel er dennoch oder gerade deswegen der Hexenverfolgung im Hochstift Bamberg zum Opfer? Diente die Verfolgung der Oberschicht Bambergs der politischen Säuberung durch den Weihbischof Georg II Fuchs von Dornheim? Dieser befand sich Anfang des 17. Jahrhundert in Kontroversen mit dem Bamberger Stadtrat und war treibende Kraft der Verfolgungen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Anfänge der Hexenverfolgung im Hochstift Bamberg
- 2. Höhepunkt der Hexenverfolgung im Hochstift Bamberg Anfang des 17. Jahrhunderts
- 3. Der Brief des Johannes Junius
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Hexenverfolgung im Hochstift Bamberg zu Beginn des 17. Jahrhunderts und fragt nach den politischen Hintergründen. Sie analysiert die Entwicklung der Verfolgung, den Höhepunkt der Prozesswellen und die Rolle des Weihbischofs Georg II. Fuchs von Dornheim. Der Brief des Johannes Junius dient als wichtiges Quellenbeispiel.
- Entwicklung der Hexenverfolgung in Bamberg
- Der Höhepunkt der Verfolgung im frühen 17. Jahrhundert
- Die Rolle von Weihbischof Georg II. Fuchs von Dornheim
- Der Fall Johannes Junius als Beispiel
- Politische Aspekte der Hexenverfolgung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Hexenverfolgung im Hochstift Bamberg zu Beginn des 17. Jahrhunderts als erschreckendes Ereignis vor, bei dem etwa 1000 Menschen ums Leben kamen. Sie hebt die ungewöhnlich hohe Zahl der Opfer und die geplante Vorgehensweise der Behörden hervor. Der Brief des Johannes Junius, eines Opfers der Verfolgung, wird als wichtiges Quellenzeugnis vorgestellt, das Fragen nach den politischen Motiven der Verfolgung aufwirft, insbesondere in Bezug auf die Rolle des Weihbischofs Georg II. Fuchs von Dornheim und dessen Konflikte mit dem Bamberger Stadtrat.
1. Anfänge der Hexenverfolgung im Hochstift Bamberg: Dieses Kapitel beleuchtet die gesellschaftlichen und religiösen Grundlagen der Hexenverfolgung. Es beschreibt die weitverbreitete Vorstellung von Magie und Schadenszauber, die durch die Hexenbulle von Papst Innozenz VIII. und den "Hexenhammer" (Malleus Maleficarum) verstärkt wurde. Das Kapitel verdeutlicht, wie die Lehren des Hexenhammers, insbesondere die Vorstellung vom Teufelspakt und die Anfälligkeit von Frauen, in die Bevölkerung eindrangen und letztendlich, verzögert durch die Kleine Eiszeit und die damit verbundenen Missernten und Hungersnöte, zu einer intensiveren Anwendung der Hexenlehre führten.
2. Höhepunkt der Hexenverfolgung im Hochstift Bamberg Anfang des 17. Jahrhunderts: Dieses Kapitel beschreibt den Höhepunkt der Hexenverfolgung in Bamberg zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Es zeigt auf, wie die Bambergische Peinliche Halsgerichtsordnung die Verfolgung legitimierte und wie unter Bischof Johann Gottfried von Aschhausen und vor allem unter seinem Nachfolger Johann Georg Fuchs von Dornheim die Verfolgungen an Intensität zunahmen. Der Auslöser für eine verstärkte Verfolgung war unter anderem eine Missernte. Das Kapitel beschreibt die systematische Vorgehensweise der Behörden, die auf Folter und Geständnissen beruhte, und wie die Hexerei als "crimen exceptum" behandelt wurde. Der Bau des Malefiz-Hauses wird als wichtiger Aspekt der organisierten Verfolgung erwähnt.
Schlüsselwörter
Hexenverfolgung, Hochstift Bamberg, 17. Jahrhundert, Weihbischof Georg II. Fuchs von Dornheim, Johannes Junius, politische Säuberung, Hexenhammer, Malleus Maleficarum, Folter, "crimen exceptum", Prozesswellen, Missernten.
Häufig gestellte Fragen: Hexenverfolgung im Hochstift Bamberg
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Hexenverfolgung im Hochstift Bamberg zu Beginn des 17. Jahrhunderts, insbesondere deren politische Hintergründe, die Entwicklung der Verfolgung, den Höhepunkt der Prozesswellen und die Rolle des Weihbischofs Georg II. Fuchs von Dornheim. Der Brief des Johannes Junius dient als wichtiges Quellenbeispiel.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der Hexenverfolgung in Bamberg, ihren Höhepunkt im frühen 17. Jahrhundert, die Rolle von Weihbischof Georg II. Fuchs von Dornheim, den Fall Johannes Junius als Beispiel und die politischen Aspekte der Hexenverfolgung. Es werden die gesellschaftlichen und religiösen Grundlagen der Hexenverfolgung beleuchtet, die Rolle der Bambergischen Peinlichen Halsgerichtsordnung und die systematische Vorgehensweise der Behörden, die auf Folter und Geständnissen beruhte, untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel und ein Fazit. Die Einleitung stellt die Hexenverfolgung im Hochstift Bamberg vor und führt in die Thematik ein. Kapitel 1 behandelt die Anfänge der Hexenverfolgung, Kapitel 2 den Höhepunkt der Verfolgung im frühen 17. Jahrhundert und die Rolle des Weihbischofs. Das dritte Kapitel analysiert den Brief von Johannes Junius. Ein Fazit rundet die Arbeit ab.
Welche Rolle spielte Weihbischof Georg II. Fuchs von Dornheim?
Weihbischof Georg II. Fuchs von Dornheim spielte eine zentrale Rolle bei der Hexenverfolgung in Bamberg. Die Arbeit untersucht seine Rolle und seinen Einfluss auf die Intensität der Verfolgungen, besonders im Zusammenhang mit Konflikten mit dem Bamberger Stadtrat. Der Brief von Johannes Junius wirft Fragen nach seinen politischen Motiven auf.
Was ist die Bedeutung des Briefes von Johannes Junius?
Der Brief von Johannes Junius, einem Opfer der Hexenverfolgung, ist eine wichtige Quelle für die Arbeit. Er liefert Einblicke in die Ereignisse und wirft Fragen nach den politischen Motiven der Verfolgung auf, insbesondere hinsichtlich der Rolle von Weihbischof Georg II. Fuchs von Dornheim.
Welche Quellen wurden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf den Brief von Johannes Junius als wichtiges Quellenzeugnis. Weitere Quellen werden im Text implizit erwähnt, wie z.B. die Bambergische Peinliche Halsgerichtsordnung, die Hexenbulle von Papst Innozenz VIII. und der "Hexenhammer" (Malleus Maleficarum).
Wie viele Menschen kamen bei der Hexenverfolgung in Bamberg ums Leben?
Die Einleitung erwähnt, dass bei der Hexenverfolgung im Hochstift Bamberg zu Beginn des 17. Jahrhunderts etwa 1000 Menschen ums Leben kamen. Diese hohe Opferzahl unterstreicht die Grausamkeit und das Ausmaß der Verfolgung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hexenverfolgung, Hochstift Bamberg, 17. Jahrhundert, Weihbischof Georg II. Fuchs von Dornheim, Johannes Junius, politische Säuberung, Hexenhammer, Malleus Maleficarum, Folter, "crimen exceptum", Prozesswellen, Missernten.
- Quote paper
- Natalie Heiberger (Author), 2019, Die Hexenverfolgung im Hochstift Bamberg Anfang des 17. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/503393