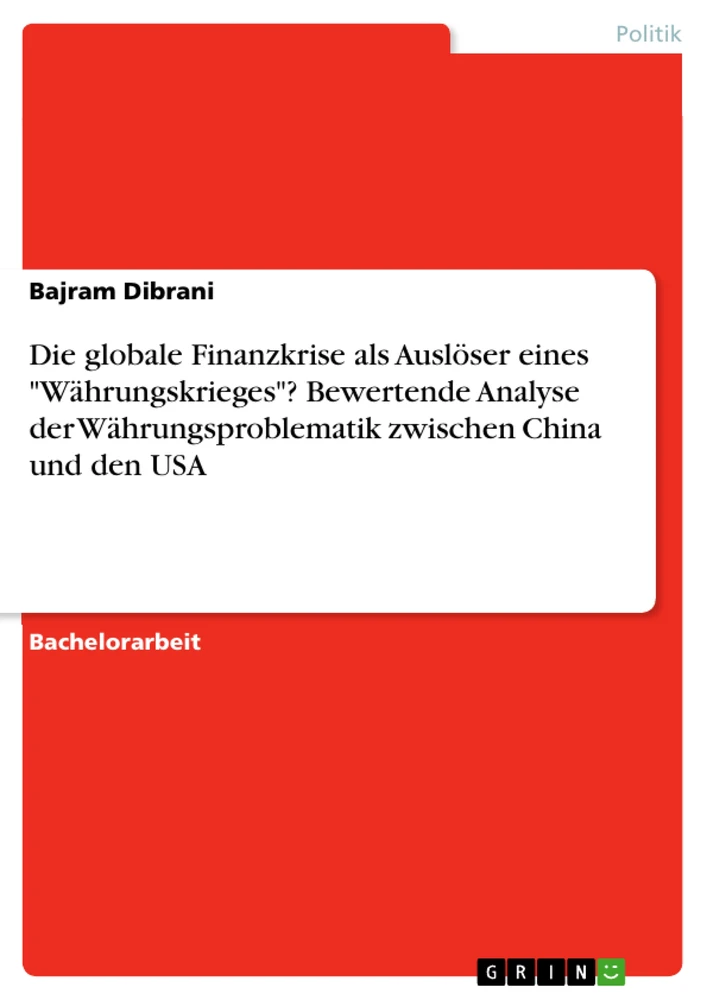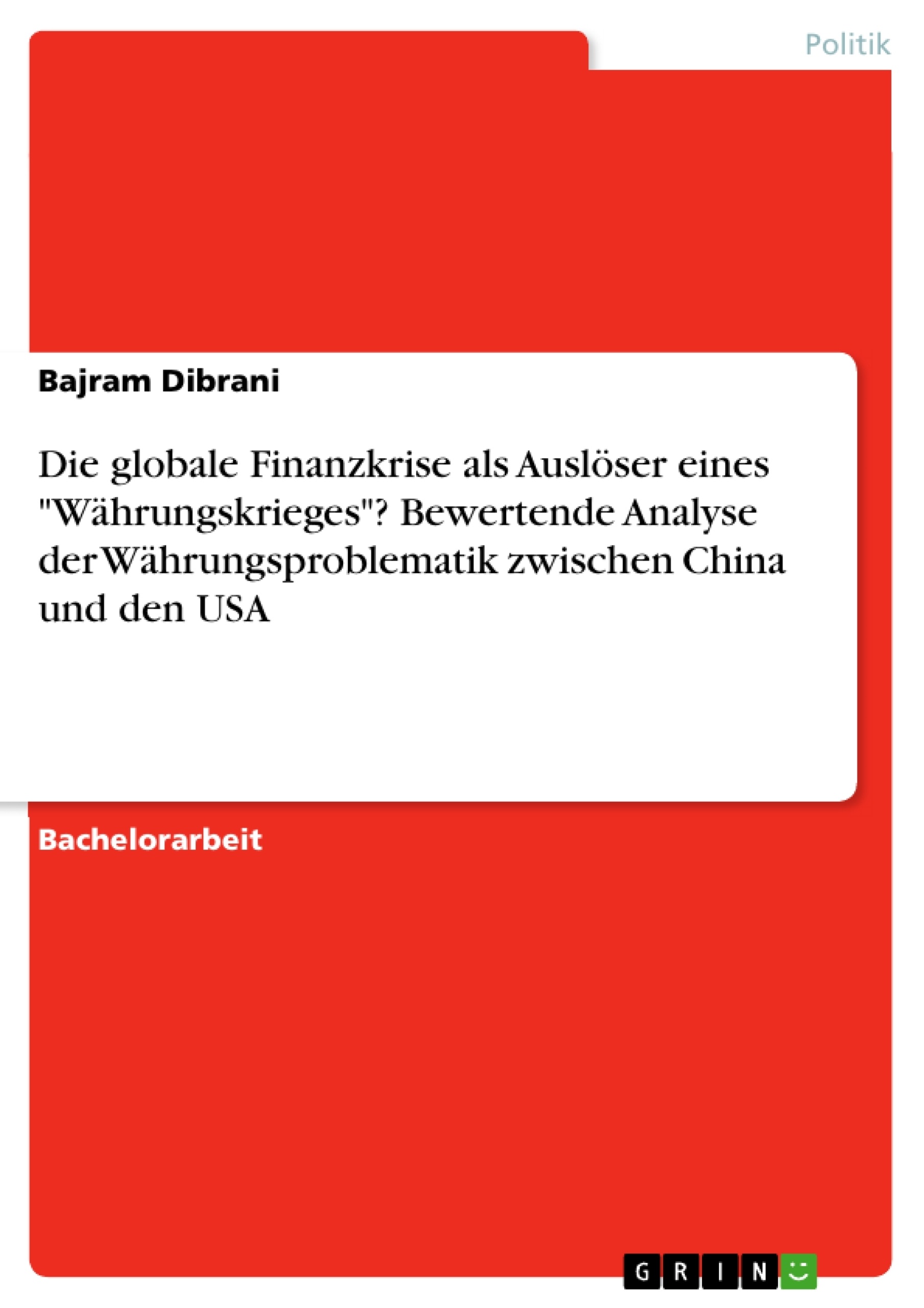Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit die USA und China ausgelöst durch Finanz- und Wirtschaftskrise von 2007/2008 einen Währungskrieg führen. Es erfolgt eine Definition des Begriffes Krieg, die sich an den Grundannahmen des Militärtheoretikers Clausewitz orientiert, um mit dem Neologismus des Währungskrieges wissenschaftlich arbeiten zu können. Dabei werden drei dem Währungskrieg wesensähnliche historische Phänomene betrachtet, von denen der Währungskrieg differenziert wird. Die wirtschaftliche Situation Chinas und der USA wird dargestellt und die Ursachen der Währungsstreitigkeiten erläutert. Es wird geklärt, welche währungspolitischen Maßnahmen beide Länder vorgenommen haben, um dabei die Risiken, wie beispielsweise die Devisenakkumulation Chinas, die Ungleichgewichte zwischen beiden Ländern infolge der unterschiedlichen Leistungsbilanzen und die expansive Geldpolitik der amerikanischen Zentralbank Fed zu beleuchten.
Schon mehrere Jahre vor dem Ausbruch der globalen Finanzkrise 2007/2008 hat sich die Welt wirtschaftlich gesehen in Gewinner und Verlierer geteilt. Die Gewinner sind die Überschussländer, welche mehr exportieren als importieren und dadurch eine positive Handels- und Leistungsbilanz generieren. Bei den Verlierern ist es umgekehrt. Während vor allem China, Japan, die übrigen asiatischen Schwellenländer und die Ölförderländer Handelsüberschüsse erzielen, stehen auf am anderen Ende Defizitländer wie Großbritannien und insbesondere die USA, die eine überaus negative Handelsbilanz vorweisen . Auf diese Weise haben sich die globalen Ungleichgewichte seit der Jahrtausendwende zunehmend verschärft.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffliche Grundlagen: Die Kriegs-Definition nach Clausewitz
- 3. „Währungskrieg“: ein neues Phänomen?
- 3.1 Beggar-thy-neighbour-Politik
- 3.2 Die Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre und der Abwertungswettlauf
- 3.3 Währungsdumping
- 4. Währungskrieg im Gefolge der Finanz- und Wirtschaftskrise? - Analyse am Beispiel der Volksrepublik China und der USA
- 4.1 Die Situation nach der globalen Finanzkrise ab 2007/2008: Währungskonflikt mit historischen Parallelen
- 4.2 Gegenwärtige wirtschaftliche Situation der USA und Ursachen der Währungsstreitigkeiten
- 4.3 Die wirtschaftliche Situation und Währungspolitik der Volksrepublik China
- 4.3.1 Das Währungssystem Chinas
- 4.3.2 Aufwertungsdruck des RMB und Inflationsproblematik
- 4.4 Bewertende Analyse der Währungsproblematik zwischen China und den USA
- 4.4.1 Chinas Handelsbilanzüberschüsse und die Globalen Ungleichgewichte
- 4.4.2 Chinas anhaltende Devisenakkumulation
- 4.4.3 Das „Quantitative Easing“ der USA
- 5. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die These eines „Währungskrieges“ zwischen den USA und China im Kontext der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007/2008. Die Arbeit analysiert die wirtschaftlichen Hintergründe und die jeweiligen Währungspolitiken beider Länder, um die Frage nach dem Bestehen eines solchen Konflikts zu beantworten.
- Definition und historische Parallelen zum Begriff des „Währungskrieges“
- Analyse der wirtschaftlichen Situation der USA und Chinas
- Bewertung der Währungspolitik beider Länder im Hinblick auf den Handelsbilanzüberschuss Chinas
- Die Rolle der Devisenakkumulation Chinas und des „Quantitative Easing“ der USA
- Bewertung der globalen Ungleichgewichte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der globalen wirtschaftlichen Ungleichgewichte vor und nach der Finanzkrise 2007/2008. Sie hebt die Handelsbilanzüberschüsse von Ländern wie China und die Defizite der USA hervor und führt das Schlagwort „Währungskrieg“ ein, dessen mediale Entstehung und Relevanz in Bezug auf die USA und China im Fokus stehen.
2. Begriffliche Grundlagen: Die Kriegs-Definition nach Clausewitz: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse fest. Es verwendet die Definition von Krieg nach Clausewitz um die Metapher des „Währungskrieges“ zu untersuchen und die Begrifflichkeiten zu klären.
3. „Währungskrieg“: ein neues Phänomen?: Dieses Kapitel untersucht, ob der Begriff „Währungskrieg“ ein neues Phänomen darstellt, indem es historische Beispiele wie die Beggar-thy-neighbour-Politik und den Abwertungswettlauf der 1930er Jahre analysiert. Es beleuchtet zudem das Phänomen des Währungsdumpings und stellt Verbindungen zu aktuellen Entwicklungen her.
4. Währungskrieg im Gefolge der Finanz- und Wirtschaftskrise? - Analyse am Beispiel der Volksrepublik China und der USA: Dieser zentrale Teil der Arbeit analysiert die wirtschaftliche Situation der USA und Chinas nach der Finanzkrise. Er untersucht die Ursachen der Währungsstreitigkeiten, das chinesische Währungssystem, den Aufwertungsdruck des RMB und die damit verbundene Inflationsproblematik. Die Analyse umfasst eine detaillierte Betrachtung der Handelsbilanzüberschüsse Chinas, seiner Devisenakkumulation und der Auswirkungen des „Quantitative Easing“ der USA auf die globale Wirtschaft und das Verhältnis zwischen den beiden Ländern. Die Kapitel 4.1-4.4 liefern eine tiefgründige Analyse dieser Aspekte.
Schlüsselwörter
Währungskrieg, Finanz- und Wirtschaftskrise 2007/2008, USA, China, Handelsbilanz, Devisenreserven, RMB, Quantitative Easing, globale Ungleichgewichte, Währungspolitik, Abwertung, Aufwertung, Beggar-thy-neighbour-Politik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Währungskrieg zwischen China und den USA?
Was ist der Gegenstand dieser wissenschaftlichen Arbeit?
Die Arbeit untersucht die These eines „Währungskrieges“ zwischen den USA und China nach der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007/2008. Sie analysiert die wirtschaftlichen Hintergründe und Währungspolitiken beider Länder, um die Existenz eines solchen Konflikts zu belegen oder zu widerlegen.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit beinhaltet eine Definition des „Währungskrieges“ unter Bezugnahme auf Clausewitz' Kriegsdefinition, die Analyse historischer Parallelen (Beggar-thy-neighbour-Politik, Abwertungswettlauf der 1930er), eine detaillierte Betrachtung der wirtschaftlichen Situation der USA und Chinas (inkl. chinesisches Währungssystem, Aufwertungsdruck des RMB, Inflation), die Rolle der Handelsbilanzüberschüsse Chinas, seiner Devisenakkumulation und des „Quantitative Easing“ der USA, sowie eine Bewertung der globalen Ungleichgewichte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) beschreibt den Kontext der globalen wirtschaftlichen Ungleichgewichte. Kapitel 2 (Begriffliche Grundlagen) legt die theoretischen Grundlagen der Kriegsdefinition nach Clausewitz fest. Kapitel 3 („Währungskrieg“: ein neues Phänomen?) untersucht historische Parallelen zum Begriff „Währungskrieg“. Kapitel 4 (Währungskrieg im Gefolge der Finanz- und Wirtschaftskrise?) analysiert die wirtschaftliche Situation der USA und Chinas nach der Finanzkrise detailliert. Kapitel 5 (Schluss) fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Währungskrieg, Finanz- und Wirtschaftskrise 2007/2008, USA, China, Handelsbilanz, Devisenreserven, RMB, Quantitative Easing, globale Ungleichgewichte, Währungspolitik, Abwertung, Aufwertung, Beggar-thy-neighbour-Politik.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die These eines „Währungskrieges“ zwischen den USA und China zu untersuchen und zu bewerten, indem sie die wirtschaftlichen Hintergründe und die Währungspolitik beider Länder analysiert.
Gibt es historische Beispiele für „Währungskriege“?
Ja, die Arbeit analysiert historische Beispiele wie die Beggar-thy-neighbour-Politik und den Abwertungswettlauf der 1930er Jahre als Parallelen zum Konzept des „Währungskrieges“.
Welche Rolle spielen die Handelsbilanzüberschüsse Chinas und das „Quantitative Easing“ der USA?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung der Handelsbilanzüberschüsse Chinas, seiner Devisenakkumulation und der Auswirkungen des „Quantitative Easing“ der USA auf die globale Wirtschaft und das Verhältnis zwischen den beiden Ländern als zentrale Faktoren im Kontext des möglichen „Währungskrieges“.
Wie wird der Begriff „Währungskrieg“ definiert und eingeordnet?
Die Arbeit verwendet die Kriegsdefinition nach Clausewitz, um den Begriff „Währungskrieg“ zu analysieren und seine Bedeutung im Kontext der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und China zu klären.
- Citation du texte
- Bajram Dibrani (Auteur), 2011, Die globale Finanzkrise als Auslöser eines "Währungskrieges"? Bewertende Analyse der Währungsproblematik zwischen China und den USA, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/502985