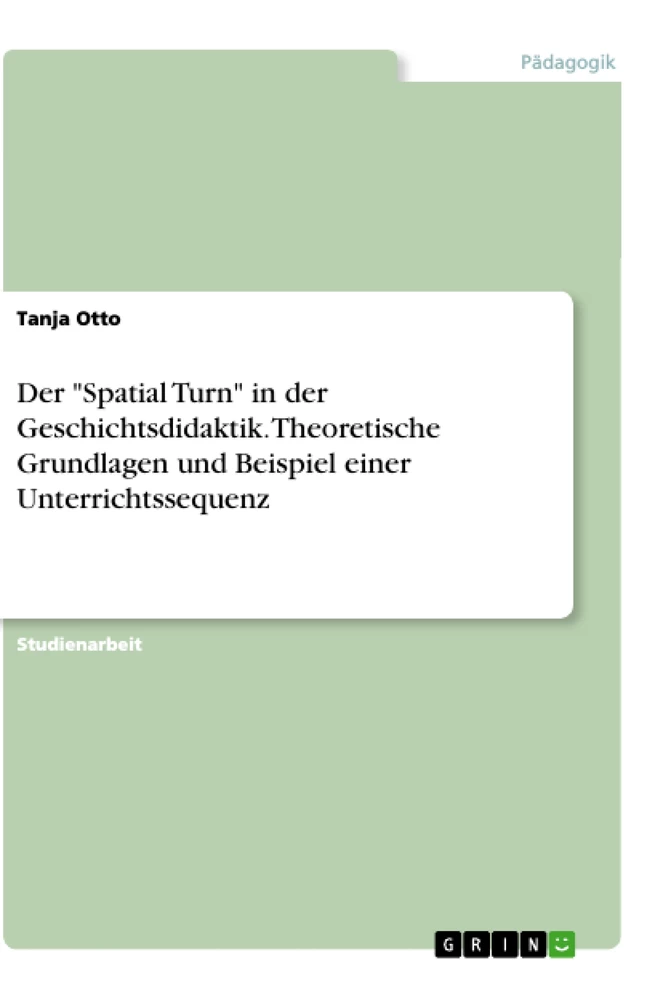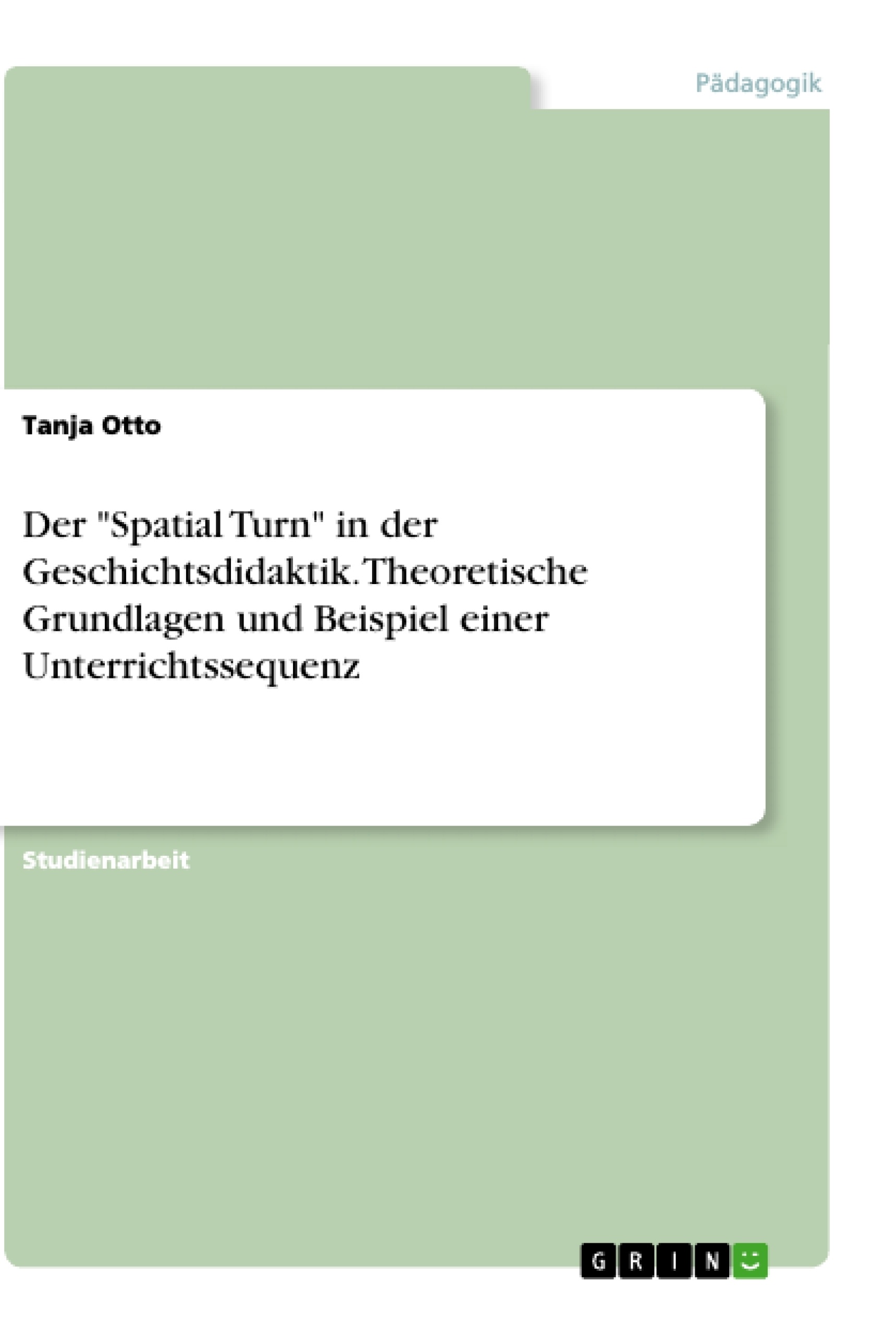Das Referat behandelte den sogenannten "Spatial Turn" in der Geschichtsdidaktik und ging dabei auf die gängigen Theorien ein, um einerseits die Thematik zu erklären und andererseits Lösungsansätze zu liefern. Als Einstieg des Referats wurden den Studierenden verschiedene Weltkarten aus der Gegenwart gezeigt. Es handelte sich sowohl um thematische (in diesem Fall politische) als auch um physische Weltkarten. Außerdem waren die Karten unterschiedlich zentriert und demzufolge nicht nur auf Europa ausgerichtet, sondern auch auf Asien und Amerika. Diese Kontrastierung sollte bei den Studierenden eine erste Sensibilisierung hinsichtlich des Konstruktcharakters von Karten wecken und auch die Überrepräsentation von politischen Karten im Geschichtsunterricht problematisieren. Schließlich sind territoriale Grenzen nicht naturgegeben, sondern sie verräumlichen an sich nichtterritoriale Gegebenheiten wie Ethnien, Religionen und Kulturen, was wiederum zur Verfestigung dieser Sichtweisen führen kann.
Im Folgenden wurde dann gezeigt, dass die angesprochenen Probleme innerhalb der letzten zwanzig Jahre im Rahmen des sogenannten "Spatial Turn" wissenschaftlich untersucht und diskutiert worden sind. Oswalt nennt diese Entwicklung treffend "Raumrenaissance". Hierzu erfolgte eine Darlegung der Neuerungen, die sich in diesem Zusammenhang für die historische Kategorie "Raum" ergeben haben. Die wichtigste Neuerung stellt der Übergang von der Vorstellung der "Macht des Raums" hin zur Vorstellung der "Macht der Raumkonzepte" dar. Im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde der Raum vielfach für deterministische Begründungen insbesondere biogenetischer Art instrumentalisiert, was schließlich im Nationalsozialismus in der Begründung von Krieg und Genozid kulminierte, aber bis heute immer wieder auftaucht. In der neuesten Forschung wird jedoch nicht vom Raum selbst als Determinante ausgegangen, sondern von der zentralen Rolle der Raumkonzepte.
Ebenfalls wurde auf die Verortung des Raums in den Lehrplänen eingegangen, indem zunächst problematische Aspekte und zuletzt mögliche Lösungen aufgezeigt wurden. Generell lässt sich feststellen, dass der Raum in den Lehr- und Bildungsplänen lediglich ein "basales Prinzip der Ein- und Zuordnung" darstellt. Es werden die Raumdimensionen von der Regional- bis zur Weltgeschichte als klar definierbare Größen gesehen, die Ereignisse wie ein Container enthalten, das heißt die zeitliche Dimension wird der räumlichen ausdrücklich vorgezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Verschriftlichung des Referats: Theoretische Grundlagen zum „Spatial Turn“
- Einleitung
- Der „Spatial Turn“ - Karten als Abbilder und Konstruktion von Mentalitäten
- Raumbezüge im Geschichtsunterricht
- Entwurf eines Arbeitsblattes: Die Gründung des deutschen Kaiserreichs 1871 – eine „Revolution von oben“?
- Sachanalyse
- Einbettung in den Lehrplan
- Didaktische Reduktion
- Umsetzung des Arbeitsblatts „Eine Revolution von oben?“
- Einbettung in eine konkrete Unterrichtsstunde-/sequenz
- Literaturverzeichnis
- Quellen
- Bildquellen
- Quellen auf dem Arbeitsblatt
- Forschungsliteratur
- Literatur zum Spatial Turn
- Literatur zur Gründung des deutschen Kaiserreichs
- Literatur für die didaktische Umsetzung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Portfolio präsentiert die Verschriftlichung eines Referats zu den theoretischen Grundlagen des „Spatial Turn“ im Geschichtsunterricht und den Entwurf eines Arbeitsblattes zur Gründung des deutschen Kaiserreichs 1871. Ziel ist die Auseinandersetzung mit der Bedeutung räumlicher Konzepte in der Geschichtswissenschaft und deren didaktische Umsetzung im Unterricht.
- Der „Spatial Turn“ und seine Bedeutung für die Geschichtsdidaktik
- Karten als Konstrukte und Abbilder von Mentalitäten
- Raumbezüge auf Mikro-, Meso- und Makroebene im Geschichtsunterricht
- Didaktische Reduktion komplexer historischer Themen
- Entwicklung und Umsetzung von Arbeitsblättern im Geschichtsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Verschriftlichung des Referats: Theoretische Grundlagen zum „Spatial Turn“: Dieses Kapitel erörtert den „Spatial Turn“ und dessen Bedeutung für die Geschichtsdidaktik. Es beginnt mit einer Einführung, die die Studierenden durch den Vergleich verschiedener Weltkarten für den Konstruktcharakter von Karten sensibilisiert. Der Hauptteil beleuchtet den „Spatial Turn“ als wissenschaftliche Auseinandersetzung mit räumlichen Konzepten, den Wandel von der „Macht des Raums“ zur „Macht der Raumkonzepte“ und die Bedeutung von „Mental Maps“. Es wird hervorgehoben, wie Karten nicht nur Abbilder, sondern auch Konstrukte von Mentalitäten sind, und wie dies die Geschichtswissenschaft und den Geschichtsunterricht bereichert. Die Kapitel schließen mit der Bedeutung der Raumbezugsebenen (Mikro, Meso, Makro) im Geschichtsunterricht und der Notwendigkeit der Reflexion des eigenen Standpunkts.
Entwurf eines Arbeitsblattes: Die Gründung des deutschen Kaiserreichs 1871 – eine „Revolution von oben“?: Dieses Kapitel beschreibt den Entwurf eines Arbeitsblattes zum Thema der Reichsgründung 1871. Es umfasst eine Sachanalyse des historischen Ereignisses, die Einbettung in den Lehrplan, die didaktische Reduktion des komplexen Themas und die konkrete Umsetzung des Arbeitsblattes. Der Fokus liegt auf der didaktischen Aufbereitung des Themas für Schülerinnen und Schüler, der Berücksichtigung unterschiedlicher Lernvoraussetzungen und der Gestaltung eines interaktiven Lernprozesses. Die Einbettung in eine konkrete Unterrichtssequenz wird ebenfalls dargestellt. Das Arbeitsblatt soll den Schülern ermöglichen, die Reichsgründung kritisch zu hinterfragen und verschiedene Perspektiven einzunehmen, unter anderem die Frage ob es sich tatsächlich um eine „Revolution von oben“ handelte.
Schlüsselwörter
Spatial Turn, Geschichtsdidaktik, Raumkonzepte, Kartenanalyse, Mental Maps, Reichsgründung 1871, Didaktische Reduktion, Geschichtsunterricht, Raumbezüge, Perspektivenübernahme, Mentalitätengeschichte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Portfolio: "Spatial Turn" und Reichsgründung 1871
Was ist der Inhalt dieses Portfolios?
Dieses Portfolio präsentiert die Verschriftlichung eines Referats zu den theoretischen Grundlagen des „Spatial Turn“ im Geschichtsunterricht und den Entwurf eines Arbeitsblattes zur Gründung des deutschen Kaiserreichs 1871. Es behandelt die Bedeutung räumlicher Konzepte in der Geschichtswissenschaft und deren didaktische Umsetzung im Unterricht.
Welche Themen werden im Referat zum „Spatial Turn“ behandelt?
Das Referat erörtert den „Spatial Turn“ und seine Bedeutung für die Geschichtsdidaktik. Es umfasst eine Einführung, die den Konstruktcharakter von Karten verdeutlicht, die Auseinandersetzung mit räumlichen Konzepten, den Wandel von der „Macht des Raums“ zur „Macht der Raumkonzepte“, die Bedeutung von „Mental Maps“ und die Rolle von Karten als Konstrukte und Abbilder von Mentalitäten. Schließlich werden Raumbezugsebenen (Mikro, Meso, Makro) im Geschichtsunterricht und die Reflexion des eigenen Standpunkts thematisiert.
Was ist das Thema des Arbeitsblattes?
Das Arbeitsblatt behandelt die Gründung des deutschen Kaiserreichs 1871 unter der Fragestellung: „Eine Revolution von oben?“. Es soll den Schülern ermöglichen, dieses historische Ereignis kritisch zu hinterfragen und verschiedene Perspektiven einzunehmen.
Wie ist das Arbeitsblatt aufgebaut?
Der Entwurf des Arbeitsblattes beinhaltet eine Sachanalyse des historischen Ereignisses, die Einbettung in den Lehrplan, die didaktische Reduktion des komplexen Themas und die konkrete Umsetzung des Arbeitsblattes. Der Fokus liegt auf der didaktischen Aufbereitung für Schüler, der Berücksichtigung unterschiedlicher Lernvoraussetzungen und der Gestaltung eines interaktiven Lernprozesses. Die Einbettung in eine konkrete Unterrichtssequenz wird ebenfalls dargestellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Portfolios?
Schlüsselwörter sind: Spatial Turn, Geschichtsdidaktik, Raumkonzepte, Kartenanalyse, Mental Maps, Reichsgründung 1871, Didaktische Reduktion, Geschichtsunterricht, Raumbezüge, Perspektivenübernahme, Mentalitätengeschichte.
Welche Zielsetzung verfolgt das Portfolio?
Ziel ist die Auseinandersetzung mit der Bedeutung räumlicher Konzepte in der Geschichtswissenschaft und deren didaktische Umsetzung im Unterricht. Konkret werden der „Spatial Turn“ und seine Bedeutung für die Geschichtsdidaktik sowie die Entwicklung und Umsetzung von Arbeitsblättern im Geschichtsunterricht behandelt.
Welche Kapitel umfasst das Portfolio?
Das Portfolio enthält die Verschriftlichung des Referats zum „Spatial Turn“, den Entwurf eines Arbeitsblattes zur Reichsgründung 1871 und ein Literaturverzeichnis mit Quellen und Forschungsliteratur.
- Quote paper
- Tanja Otto (Author), 2017, Der "Spatial Turn" in der Geschichtsdidaktik. Theoretische Grundlagen und Beispiel einer Unterrichtssequenz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/502944