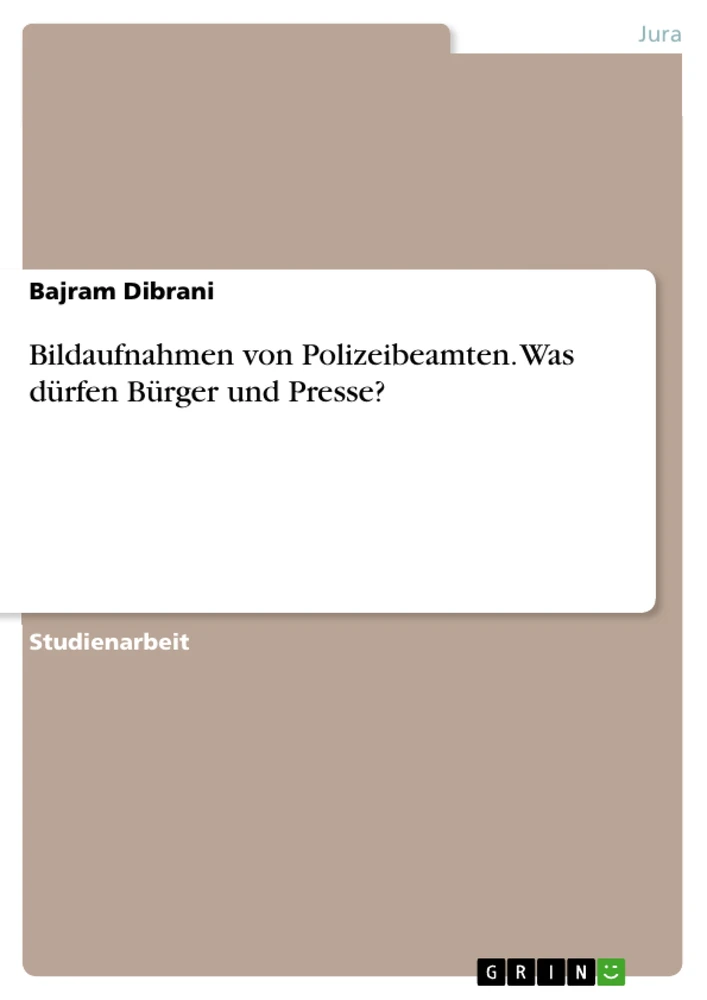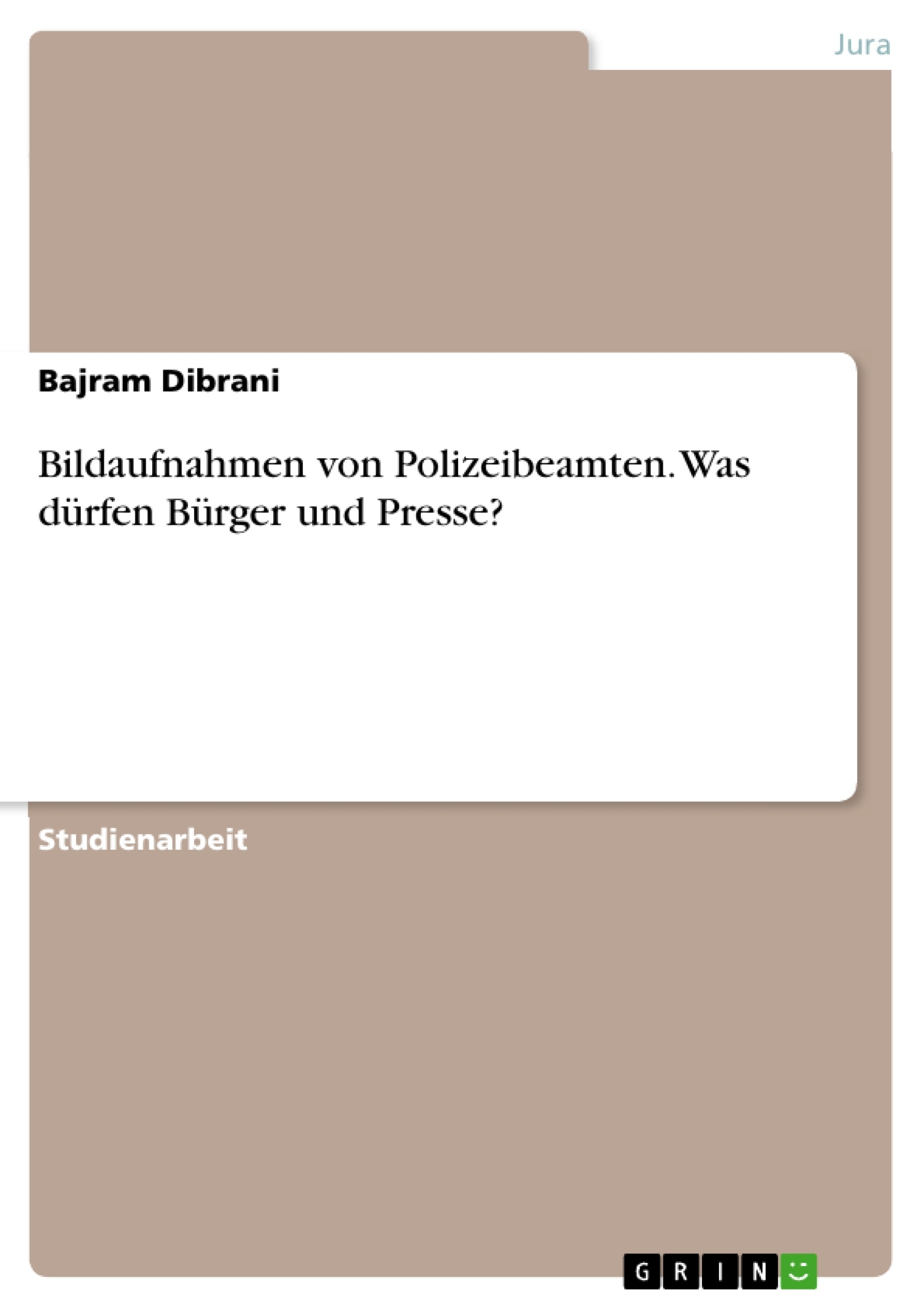Die Videoüberwachung von Demonstrationen durch die Polizeibehörden ist ein probates und mittlerweile routiniert eingesetztes Mittel zur Vorbeugung von Straftaten und zur Strafverfolgung – ob an Bahnhöfen, in der Bank, auf öffentlichen Plätzen oder in Schulen. Allgemeine Rechtsnormen, wie § 6b des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und § 34 des Landesdatenschutzgesetzes regeln den Einsatz von Videoüberwachungsmaßnahmen ebenso wie spezialgesetzliche Vorschriften, beispielsweise § 27 des Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes (POG) von Rheinland-Pfalz. Die Polizei macht häufig zu Beweiszwecken Fotos und Videoaufnahmen von Demonstrationen mit erhöhtem Gewalt- und Risikopotential. Mit der weiten Verbreitung von Mobiltelefonen und Smartphones ist das Fotografieren und Filmen auf solchen Veranstaltungen auch auf der Gegenseite stark angestiegen. Angesichts dieser technischen Entwicklung werden Polizeibeamte im Einsatz immer häufiger fotografiert oder gefilmt, mit der Absicht die Bilder oder Videos im Anschluss zu veröffentlichen. Während früher die Veröffentlichung seitens der Presse in den (Print-)Medien üblich war, werden die Aufnahmen heutzutage in einschlägigen Blogs, Foren oder auf "Youtube" präsentiert.
Im Umkehrschluss stellt sich also die Frage, was Bürger und Presse in diesem Zusammenhang dürfen. Dazu gab es in der jüngeren Rechtsprechung der vergangenen beiden Jahre zwei wegweisende Urteile, welche Konsequenzen für die Rechtspraxis haben. Im Verhältnis Bürger-Polizei und Presse-Polizei führt das zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen im Spannungsfeld zwischen Gefahrenabwehr und öffentlicher Sicherheit sowie berechtigten Interessen des Abgebildeten gegenüber dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit. Insbesondere die Identitätsfeststellung als Mittel zur Gefahrenabwehr ist in der Literatur stark problematisiert worden und wirft einige Fragen auf.
Prinzipiell würde es dem ersten Anschein nach zur Beantwortung der Frage, was Bürger und Presse hinsichtlich der Aufnahmen von Polizeibeamten dürfen, ausreichen, sich die einschlägigen Gesetzesstellen wie etwa § 22, 23 Kunsturheberrechtsgesetz (KunstUrhG) sowie die beiden aufgeführten Urteile des BVerfG anzuschauen und die konkreten Regelungen mit den Schlussfolgerungen der beiden Gerichtsentscheidungen zusammenzuführen. Dennoch lohnt sich eine kritische Auseinandersetzung insbesondere mit den beiden Urteilen, damit ein vollständiges Verständnis zur Beantwortung der Fragestellung entstehen kann.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Die Urteile des BVerwG und OVG Lüneburg hinsichtlich der Bildaufnahmen von Polizeibeamten
- I. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 28.03.2012
- II. Der Beschluss des OVG Lüneburg vom 19.06.2013
- C. Problematik des Fotografierens und Filmens von Polizisten bei Einsätzen
- I. Bildaufnahmen von Polizeibeamten: Was darf die Presse?
- 1. Urheberrechte: §§ 22, 23 KunstUrhG i.V.m. § 33 KunstUrhG
- a) § 22 KunstUrhG: Recht am eigenen Bild als besondere Form des allgemeinen Persönlichkeitsrechts
- b) § 23 KunstUrhG Ausnahme zu § 22 KunstUrhG: Bereich der Zeitgeschichte (§ 23 Abs. 1 Nr. 1 KunstUrhG)
- 2. Die Bedeutung der Grundrechte in diesem Zusammenhang: Art. 5 Abs. I GG, Art 2 GG, Art. 1 GG
- 3. Zwischenfazit: Was darf die Presse hinsichtlich der Abbildungen von Polizisten bei Einsätzen?
- II. Bildaufnahmen von Polizeibeamten: Was darf der Bürger?
- 1. Die öffentliche Sicherheit als Schutzgut
- 2. Das Vorliegen einer Gefahr
- 3. Die Identitätsfeststellung als vorbeugende Gefahrenabwehr?
- 4. Die Bemessung der Eingriffsintensität
- D. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die rechtlichen Rahmenbedingungen für Bildaufnahmen von Polizeibeamten durch Bürger und Presse. Sie analysiert die relevanten Gerichtsurteile und gesetzlichen Bestimmungen, um die rechtlichen Grenzen zu klären. Der Fokus liegt auf der Abwägung zwischen dem Recht am eigenen Bild der Polizeibeamten, dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit und dem Schutz der öffentlichen Sicherheit.
- Recht am eigenen Bild von Polizeibeamten
- Informationsfreiheit und Pressefreiheit
- Öffentliche Sicherheit und Gefahrenabwehr
- Auslegung relevanter Gerichtsurteile
- Abwägung der betroffenen Grundrechte
Zusammenfassung der Kapitel
A. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Kontext von Bildaufnahmen von Polizeibeamten im Zeitalter von Smartphones und Social Media. Sie stellt die zentrale Frage nach den Rechten von Bürgern und Presse in diesem Zusammenhang und hebt die Relevanz zweier wegweisender Gerichtsurteile hervor. Die Einleitung betont die Spannungen zwischen Gefahrenabwehr, öffentlichem Interesse und den Rechten der Abgebildeten. Sie dient als Grundlage für die detaillierte Analyse der Rechtslage in den folgenden Kapiteln.
B. Die Urteile des BVerwG und OVG Lüneburg hinsichtlich der Bildaufnahmen von Polizeibeamten: Dieses Kapitel analysiert zwei bedeutende Gerichtsentscheidungen: das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts von 2012 und den Beschluss des OVG Lüneburg von 2013. Es untersucht die jeweilige Argumentation der Gerichte und deren Auswirkungen auf die Praxis. Die Zusammenfassung der Urteile dient als Grundlage für das Verständnis der folgenden Kapitel, die die Problematik aus verschiedenen Perspektiven beleuchten.
C. Problematik des Fotografierens und Filmens von Polizisten bei Einsätzen: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit der Problematik des Fotografierens und Filmens von Polizisten während Einsätzen. Es differenziert zwischen den Rechten der Presse und den Rechten von Bürgern und analysiert die relevanten gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere die §§ 22 und 23 des KunstUrheberrechtsgesetzes (KunstUrhG). Es untersucht die Bedeutung der Grundrechte, wie Art. 5 Abs. 1 GG (Meinungsfreiheit), Art. 2 GG (Persönlichkeitsrecht) und Art. 1 GG (Würde des Menschen), im Kontext von Bildaufnahmen und beleuchtet die schwierige Abwägung zwischen diesen Rechten und dem Interesse an der öffentlichen Sicherheit. Der Schnittpunkt zwischen den Rechten der Presse und den Rechten von Bürgern wird umfassend beleuchtet.
Schlüsselwörter
Polizeirecht, Bildaufnahmen, Recht am eigenen Bild, Pressefreiheit, Informationsfreiheit, Öffentliche Sicherheit, Gefahrenabwehr, KunstUrhG, Bundesverwaltungsgericht, OVG Lüneburg, Grundrechte, Identitätsfeststellung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Rechtliche Rahmenbedingungen für Bildaufnahmen von Polizeibeamten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die rechtlichen Rahmenbedingungen für Bildaufnahmen von Polizeibeamten durch Bürger und Presse. Sie analysiert die relevanten Gerichtsurteile und gesetzlichen Bestimmungen, um die rechtlichen Grenzen zu klären und die Abwägung zwischen dem Recht am eigenen Bild der Polizeibeamten, dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit und dem Schutz der öffentlichen Sicherheit zu beleuchten.
Welche Gerichtsurteile werden analysiert?
Die Arbeit analysiert insbesondere das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 28.03.2012 und den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg (OVG Lüneburg) vom 19.06.2013. Die Argumentation der Gerichte und deren Auswirkungen auf die Praxis werden untersucht.
Welche gesetzlichen Bestimmungen sind relevant?
Die relevanten gesetzlichen Bestimmungen umfassen insbesondere die §§ 22 und 23 des KunstUrheberrechtsgesetzes (KunstUrhG) zum Recht am eigenen Bild, sowie die Grundrechte aus dem Grundgesetz (GG), wie Art. 5 Abs. 1 GG (Meinungsfreiheit), Art. 2 GG (Persönlichkeitsrecht) und Art. 1 GG (Würde des Menschen).
Wie wird die Problematik des Fotografierens und Filmens von Polizisten bei Einsätzen differenziert?
Die Arbeit differenziert zwischen den Rechten der Presse und den Rechten von Bürgern beim Fotografieren und Filmen von Polizeibeamten während Einsätzen. Sie beleuchtet die schwierige Abwägung zwischen dem Recht am eigenen Bild, dem Informationsinteresse der Öffentlichkeit und dem Schutz der öffentlichen Sicherheit.
Welche Aspekte der öffentlichen Sicherheit werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die öffentliche Sicherheit als Schutzgut und untersucht, ob und unter welchen Bedingungen das Fotografieren und Filmen von Polizeibeamten eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellen kann. Dabei werden Aspekte wie die Identitätsfeststellung und die Bemessung der Eingriffsintensität berücksichtigt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Polizeirecht, Bildaufnahmen, Recht am eigenen Bild, Pressefreiheit, Informationsfreiheit, Öffentliche Sicherheit, Gefahrenabwehr, KunstUrhG, Bundesverwaltungsgericht, OVG Lüneburg, Grundrechte, Identitätsfeststellung.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Themen Recht am eigenen Bild von Polizeibeamten, Informationsfreiheit und Pressefreiheit, öffentliche Sicherheit und Gefahrenabwehr, Auslegung relevanter Gerichtsurteile und die Abwägung der betroffenen Grundrechte.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in folgende Kapitel gegliedert: Einleitung, Analyse der Urteile des BVerwG und OVG Lüneburg, Problematik des Fotografierens und Filmens von Polizisten (Differenzierung Presse/Bürger), und Fazit. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
- Quote paper
- Bajram Dibrani (Author), 2014, Bildaufnahmen von Polizeibeamten. Was dürfen Bürger und Presse?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/502871