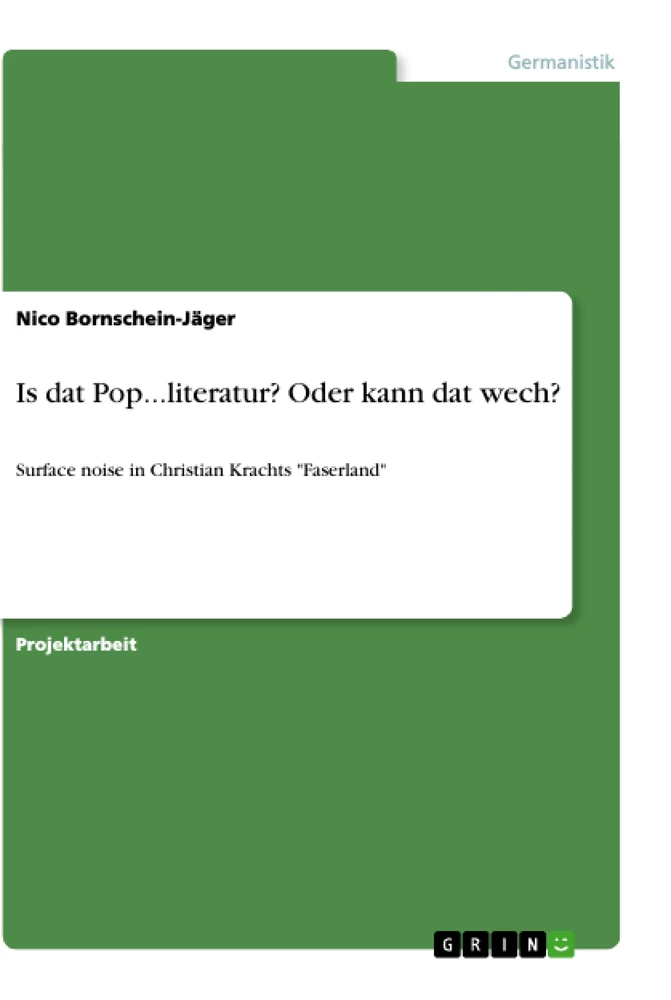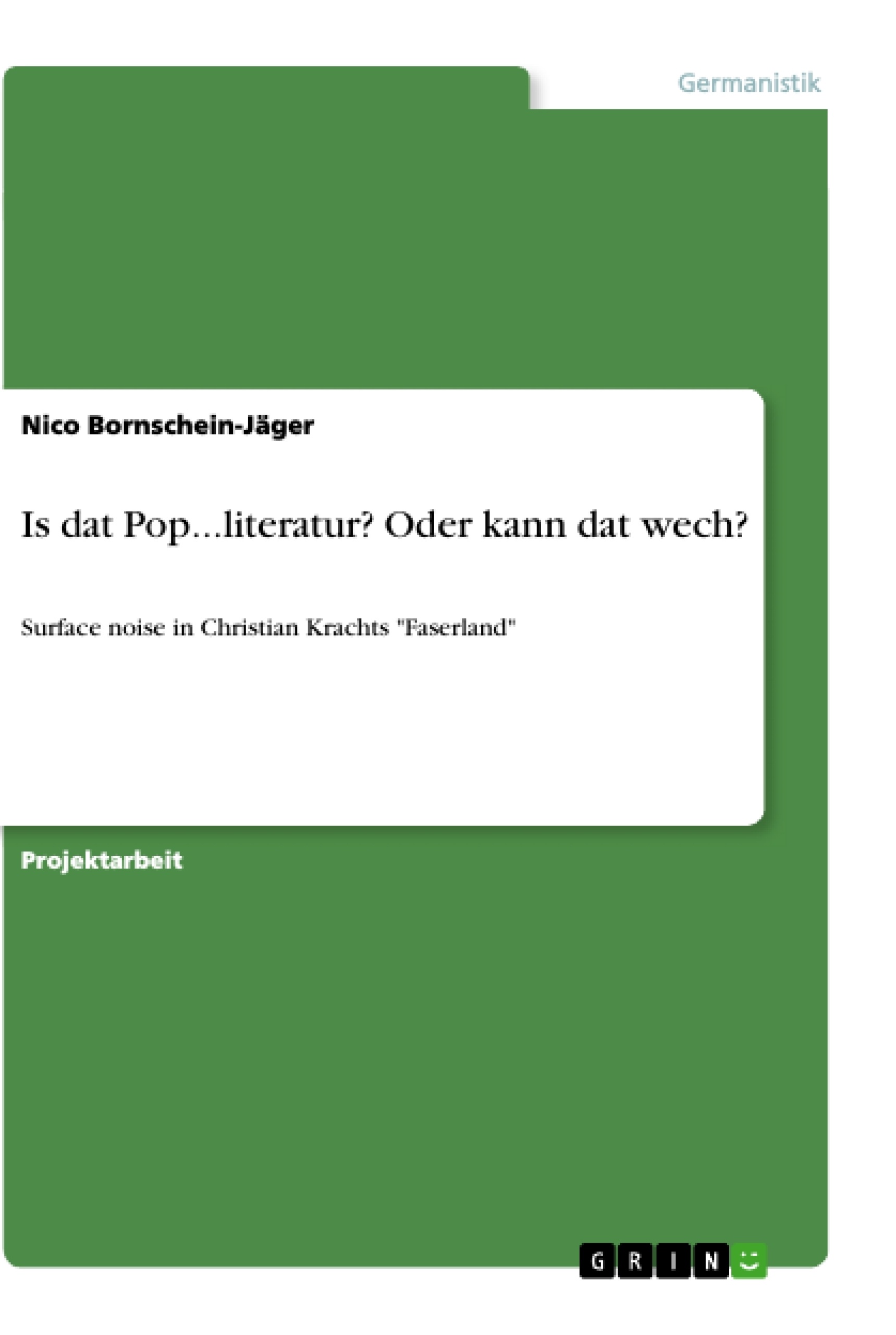Trotz aller definitorischen Uneinigkeit soll in dieser Arbeit versucht werden, grob zu skizzieren, welche Merkmale dem Roman "Faserland" als einer mit "Pop" betitelten Literatur zu Grunde liegen und was "Pop" eigentlich ist.
1995 debütierte Christian Kracht mit seinem konsumkritischen "Faserland". Der Roman beschäftigt sich mit dem Niedergang der sogenannten harmonischen bürgerlichen Gesellschaft der Nachkriegszeit und individuellen und nationalen Identitätskrisen. Dieser erste Teil des Tryptichons "Faserland–1979–Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten" polarisierte. Während die Frankfurter Neue Presse diesem "das Zeug zum deutschen Kultbuch der 90er" zusprach und der Stern sich endlich über "ein Buch über das Deutschland spricht" freute, empfand die Mehrzahl der Kritiker das Werk als handlungsarm und langweilig. Er plagiiere Jay McInerney oder Bret Easton Ellis, lästerte man in den Feuilletons. "Plattes Zeitgequatsche", das an Banalität und Oberflächlichkeit kaum zu überbieten sei, echauffierte man sich in den Foren.
"Pop" einheitlich und allgemeingültig zu definieren, ist nahezu aussichtslos. Der Begriff scheint beinahe "endlos dehnbar" – alles oder nichts könnte "Pop" sein. Etymologisch leitet sich das autonome Lexem "Pop" von "populär" ab. In angloamerikanischen Literatur- und Sozialwissenschaftsdiskursen gilt indes die so genannte popular culture "als Gegenstück zur elitären oder Hochkultur" und grenzt sich so vom Herkömmlichen ab: Um eines Konsens willen soll also "Popliteratur" hier nicht mehr und nicht weniger als ein Wortspiel mit den Termini "popular culture" und "Pop–Art" betrachtet werden vor dem Hintergrund der Klassifizierung des Lexems "Pop" "als Derivat von populär" und des onomatopoetischen Innuendo auf das englische Verb "to pop", das mit "knallen" oder "platzen" übersetzt wird.
Inhalt
1. Einleitung
2. Surface Noise
3. Is dat Popliteratur?
4. Oder kann dat wech? – Ein Fazit
5. Literatur- und Quellenverzeichnis
1. Einleitung
1995 debütierte Christian Kracht mit seinem konsumkritischen Faserland. Der Roman beschäftigt sich mit dem Niedergang der sogenannten harmonischen bürgerlichen Gesellschaft der Nachkriegszeit und individuellen und nationalen Identitätskrisen. Dieser erste Teil des Tryptichons Faserland – 1979 – Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten polarisierte: Während die Frankfurter Neue Presse diesem „das Zeug zum deutschen Kultbuch der 90er“1 zusprach und der Stern sich endlich über „ein Buch über das Deutschland spricht“2 freute, empfand die Mehrzahl der Kritiker das Werk als handlungsarm und langweilig: „Da schreibt ein widerlich arroganter Schnösel, der sein ‚Zeitgeist‘-Dandytum schon für Literatur hält und seine banalen Reisenotizen für erbarmungslos scharfe Beobachtungen“.3 Er plagiiere Jay McInerney oder Bret Easton Ellis, lästerte man in den Feuilletons.4 „Plattes Zeitgequatsche“, das an Banalität und Oberflächlichkeit kaum zu überbieten sei, echauffierte man sich in den Foren. Und nicht zuletzt musste sich Krachts Faserland den Vorwurf gefallen lassen, „[…] keine gesellschaftspolitische Position zu beziehen [und] sich ohne kritische Distanz in der Markenwelt [...] eingerichtet zu haben“5. Inzwischen aber empfindet man „[d]ie Ernsthaftigkeit, mit der Kracht Markenprodukte einführte und als Fundamente des Lebens Anfang der neunziger Jahre vor Augen führte, [als] befreiend“6 und erkennt in Faserland größtenteils „ein Gründungsphänomen des Literatur-Pop“7.
Trotz aller definitorischen Uneinigkeit sei hier also deshalb versucht, zumindest grob zu skizzieren, welche Merkmale Faserland als einer mit ‚Pop‘ betitelten Literatur8 zu Grunde liegen und was – allem voran – ‚Pop‘ eigentlich ist.
2. Surface Noise
Georg Diez stellt fest,
„[dass] wenn es lustig klang, [es] wohl Pop sein [musste], schließlich, das wussten sie aus den bunten Magazinen, schließlich war jetzt alles Pop. Aber mit Pop, was auch immer das war, hatte dieses Buch herzlich wenig zu tun, und alle, die in der gewissen Zärtlichkeit, mit der Kracht die Oberfläche der Dinge streichelte, nur die Affirmation herauslasen, konnten einfach nicht entziffern, dass sich das Leiden an der Welt heute anders buchstabiert.“9
‚Pop‘ einheitlich und allgemeingültig zu definieren, ist also nahezu aussichtslos. Der Begriff scheint beinahe „endlos dehnbar“10 – alles oder nichts könnte ‚Pop‘ sein. Etymologisch leitet sich das autonome Lexem ‚Pop‘ von ‚populär‘ ab. In angloamerikanischen Literatur- und Sozialwissenschaftsdiskursen gilt indes die so genannte popular culture „als Gegenstück zur elitären oder Hochkultur“11 und grenzt sich so vom Herkömmlichen ab: Um eines Konsens willen soll also ‚Popliteratur‘ hier nicht mehr und nicht weniger als ein Wortspiel mit den Termini ‚popular culture‘ und ‚Pop–Art‘ betrachtet werden vor dem Hintergrund der Klassifizierung des Lexems ‚Pop‘ „als Derivat von populär“ und des onomatopoetischen Innuendo auf das englische Verb ‚to pop‘, das mit ‚knallen‘ oder ‚platzen‘ übersetzt wird.12 In diesem Sinne unifiziert der Begriff ‚Popliteratur‘ gewissermaßen eine „rebellisch-subversive Dimension“ mit einem ebenso provokanten und „explosiv-revolutionären Gestus“.13
Erstmals sprach der amerikanische Medientheoretiker Leslie A. Fiedler gegen Ende der 1960er Jahre in Reminiszenz an den Dadaismus von ‚Pop‘.14 Aber schon zehn Jahre zuvor, in den 50er Jahren, formierte sich in den USA die sogenannte Beat Generation, die die Literatur nicht zuletzt dadurch beeinflusste, indem sie mit Tabus wie Sex, Elend und Drogenmissbrauch im Zusammenhang mit alltäglichen Gegebenheiten und Gegenständen brach.15 Mit ihrer provokanten und obszönen Sprache konstituierten sie das Lebensgefühl der späteren Hippie-Bewegung, und spätestens mit J. D. Salingers The Catcher in the Rye war ‚Pop‘ endgültig in der Literatur angekommen. „[D]ie Mauer zwischen [zuvor] elitärer Hoch- und populärer Massenkultur“ wurde eingerissen.16
In den 60er Jahren schwappten diese Einflüsse „[mit ihrem] Protest sowie [ihrer] gesellschaftliche[n] Kritik“ auch nach Deutschland.17 Insbesondere die Popliteratur „wird hier als ästhetisch, sozial, politisch und ökonomisch vielschichtiger Diskurs innerhalb der Gegenwartskultur verstanden, der im Sinne eines engeren Kulturbegriffs auf künstlerischen Ausdrucksformen wie Musik, Literatur, bildenden Künsten und Film basiert“.18 Dieser multimediale Kern des ‚Pop‘ ist, wie im Folgenden gezeigt wird, auch Faserland immanent, das sich durchaus mit Diederichsen Worten „als eine freundlich-höhnische Präsentation aufklärerischer Dialektik“19 beschreiben lässt und den Höhepunkt popliterarischen Schaffens markiert. Als ‚90er-Jahre-Pop‘, ohne weiter Diederichsens Unterteilung in ‚Pop I‘ und ‚Pop II‘ zu beleuchten20, sind hier nun nicht mehr offene Kritik und politisches Engagement zentral, sondern Unterhaltung, abbildende Realismus-Treue und die Darstellung von Adoleszenz-Problemen,21 vertextet in einer „Form des leichten, ironischen, oberflächlichen Lifestyle“-Kults22.
3. Is dat Pop…literatur?
Das Argument, ein Text sei Pop, wenn man ihn dafür hält,23 nähme der Diskussion die Luft und zeigt nur die zunehmende, wahnhaft anmutende Entgrenzung und Vergeistlichung seiner Bedeutung. Deshalb bleibt es nachfolgend unbeachtet.
In einem Interview mit der Zeit gesteht Christian Kracht: „Ich hab keine Ahnung, was das sein soll: Popliteratur“.24 Dennoch verwendet er in Faserland circa siebzig populäre Markennamen – mindestens acht allein auf Seite eins des ersten Kapitels25 – die nicht nur Konsumerismus und Markenfetischismus widerspiegeln, sondern gleichzeitig durch ihre Popularität plastisch die Oberfläche einer dadurch authentisch wirkenden Welt veranschaulichen, in der sich der Ich-Erzähler bewegt.26 Das deckt sich mit Reiter, der unter ‚Pop‘ alles subsumiert, was eine „Dokumentation des Zeitgeistes“ und des entsprechenden „gesellschaftlichen Klimas“ mit gleichzeitiger „Beschreibung des Lebensgefühls“ ausmacht, wobei der Protagonist gleichsam zur Stimme einer ganzen Generation wird.27 Seine Definition gibt auch Stefan Beuse Substanz, wenn er lobt, Kracht habe „eine Identifikationsfigur für große Teile einer ganzen Generation geschaffen“.28
Faserland verwebt lebensnahe Adoleszenz-Thematiken eines jugendlichen Protagonisten29 wie Liebe,30 Freundschaft,31 Partys32, Gruppenzugehörigkeit,33 Sex,34 Drogen und Alkohol,35 also solche, die die menschliche Psyche tangieren und eng mit einer Identitätskrise verwoben sind.36 Diese Textur wird schon auf der ersten Seite des ersten Kapitels deutlich. Der Ich-Erzähler sinniert bei einer Flasche Jever darüber, wie seine Schulfreundin oder vielleicht auch Jugendliebe Karin, die er zuletzt im Traxx und im P1 gesehen hat und die ihrerseits Chablis trinkt, im Bett sein mag.37 Alkohol- und Drogenmissbrauch bilden in diesem Gewebe Schweißnähte, die den Roman einerseits zusammenhalten, andererseits auf den Rost unter der Oberfläche hinweisen: Koksen ist selbstverständlich für die Generation Ü30, Alkoholika fungieren als Durstlöscher,38 Tabletten kitten Probleme und machen Partys erst so richtig schön.39 Im weiteren Romanverlauf zeigt insbesondere der Alkohol in Verbindung mit harten Psychopharmaka seine psychopathologisch-destruktive und zuletzt tödliche Kehrseite.40
Die repetitiv verwendete Phrase „Ich zünde mir eine Zigarette an“ und ihre Varianten – hier öffnet sich die Schleuse zu den sprachlich-stilistischen Auffälligkeiten – wirken fast wie Punch-Lines.41 Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil Kracht den Markennamen Parisienne, die der Ich-Erzähler in der ursprünglichen Fassung suchtet, herausgestrichen hat, damit man Faserland nicht schon ab der ersten Seite in die Schublade der Popliteratur stecke.42 Das grotesk häufige Zündeln am Glimmstängel, das schon früh im Roman einen komischen Höhepunkt erfährt, als der Namenlose seine „mindestens zweitausendste Zigarette“ anzündet,43 erinnert all jene, denen bis dahin der ähnliche Duktus nicht aufgefallen ist, deshalb erst nach 26 Seiten an Holden Caulfield aus J.D. Salingers einzigem Roman The Catcher in the Rye.44
Eine weitere Adoleszenz-Thematik, wie auch Kaulen45 und Hecken46 sie in ihren Definitionen fordern, zeigt sich in Faserland in der impliziten Konsumkritik, wenn Markennamen wie Adjektive fungieren.47 „[Diese] gewisse Schönheit […] alltägliche[r] Objekte“,48 von der etwas verklausuliert auch Kaulen schreibt, wenn er von der Adaption popmusikalischer und audiovisuell-elektronischer Strukturen, also intertextuellen und intermedialen Bezügen spricht,49 und bei Hecken, wenn er ‚Pop‘ mit Oberflächlichkeit, Äußerlichkeit und Stilverbund definiert,50 evoziert eine Tiefe in der Romanhandlung, die den Einblick in den Niedergang der sogenannten harmonischen bürgerlichen Gesellschaft der Nachkriegszeit und die Identitätskrise des namenlosen Ich-Erzählers plastisch wirken lassen. Dieser Ich-Erzähler gehört zwar einer höher gestellten Gesellschaftsschicht an – so ließ Kracht ihn die Schule Schloss Salem besuchen,51 die er selbst auch besuchte, und lässt ihn Bourbon, Roederer und Ilbesheimer Herrlich gegen den Durst trinken,52 dennoch und vor allem dadurch, durch diese adjektivisch verwendeten Markennamen, rückt er aber die Innenwelt des Ich-Erzählers in den Fokus, besonders im Hinblick auf seine Affektlabilität53 und Verletzlichkeit.54
Die sprachliche Barrierefreiheit durch den einfachen, durchgetaktet wirkenden Syntax ohne Fremdworte und einem Mindestmaß an Variabilität bei der Interpunktion evoziert nicht zuletzt eine maximale Eingängigkeit und spricht damit ein breiter gefächertes Leserspektrum an, als Kaulen für seine Kategorisierung verlangt.55
Stilistisch schneiden sich dabei in der autodiegetischen Rollenprosa „kreative Originalität und überraschende Neurahmungen“,56 die sich in „eine[r] überaus artifizielle[n], das heißt: [einer] komplett unnatürliche[n] Erzählform [widerspiegeln], weil man ja nicht gleichzeitig erzählen und erleben kann“, wie es ein solcher Erzähler suggeriert57. „[Die] den Betrachter einbeziehende Exponierung des real präsenten Raumes bewirkt [aber], dass der in der dargestellten Szene fixierte Augenblick seinerseits das Zeitbewusstsein des Betrachters arretiert“, also seinen Blick auf das erzählerische Hier und Jetzt lenkt, wodurch sich der Roman in die Popliteratur und damit in die Pop-Art an sich einreiht, denn er kracht und provoziert.
Faserland kann also als transzendente Literatur oder literarische Transzendenz gelesen werden, mit dem Motiv des Crossovers als Grundprinzip:58 In jugendlichem Gestus ist neben Liebe, Freundschaft, Partys, Mode und Musik auch von Alkohol, Drogen und Ausgrenzung die Rede.59 Der Roman kann als eine „direkte Reaktion auf das alltägliche Leben“, das er abbildet, verstanden werden.60 Dazu nutzt Kracht in Faserland „populär-kulturelle Symbole“,61 mit denen sein „emphatische[r ] Gegenwartsbezug [...] vor allem durch die gesuchte Nähe zur modernen Konsum- und Medienkultur hergestellt“ wird.62 Hier liegt also ein Text vor, der Alltag so intensiv und detailliert exemplifiziert, dass sich das Außergewöhnliche erst auf den zweiten Blick zu erkennen gibt.
Krachts Affinität zur Medien- und Konsumkultur drückt sich dabei vor allem gestalterisch aus: Prestigeträchtige und prominente Orte63 finden drehbuchartig64 ebenso Eingang, wie Popmusik,65 Tageszeitung,66 Film und Fernsehen67 und werden wie selbstverständlich neben Weltliteratur zitiert oder auch einfach nur genannt.68 Diese intermediale Omnipräsenz stellt einen Bruch mit literarischen Traditionen dar, was viele Literaten als „Kultmarketing“ bezeichnen, durch das Literatur zur „Performance“ eines „Live-Erlebnis[ses]“ wird.69 Immerhin widerspricht Christian Kracht Denis Scheck nicht, wenn dieser behauptet, Kracht habe mit Faserland das mitbegründet, was später mit Popliteratur bezeichnet wurde.70
4. … Oder kann dat wech? Ein Fazit
Christian Krachts Aussage, er wisse nicht, was Popliteratur sein soll, muss mit Vorsicht gelesen werden, selbst wenn man sich seine Begründung, dass es sich bei Faserland allenfalls um ‚Literatur-Pop‘ handele, in die Augen wischen lässt. Denn die zahllosen Popversatzstücke wie Luxus- und Lifestyle-Obsessionen – Alkoholika als Durstlöscher, Holden-Caulfield-mäßiges Kettenrauchen, der Ort Sylt als Marke oder Image per se, Partys, Sex- und Drogenexzesse sowie Referenzen auf Weltliteratur neben Reminiszenzen und direkten Aufzählungen von Musik- und Filmtiteln erscheinen ebenso wie die In-Group/ Out-Group-Verschiebung nicht ganz zufällig gewählt.
In der Abbildung der Realität durch den inflationär adjektivisch verwendeten Markensymbolismus, durch die Intermedialität und durch das vollkommene Verharren des genial erzählten Plots im Surface Noise – im Oberflächenrauschen – zeigt sich eine Akribie, die den Text höchst artifiziell erscheinen lässt, nach der Maßgabe einer Popliteratur. Das Phänomen Popliteratur ohne Christian Krachts Faserland zu diskutieren erscheint undenkbar. Vielmehr verdichten sich die Hinweise um die Annahme, dass es sich hierbei um prototypische Popliteratur handelt.
5. Literatur- und Quellenverzeichnis
Primärliteratur
Illies, Florian: Generation Golf. Eine Inspektion. 13. Aufl. S. Fischer, Frankfurt am Main 2011.
Kracht, Christian: Faserland (1995), 4. Auflage, Frankfurt am Main, S. Fischer, 2015.
Salinger, Jerome David: Der Fänger im Roggen (1951), neuübers. von Eike Schönfeld, 11. Auflage, Reinbek bei Hamburg, 2010.
Sekundärliteratur
Baßler, Moritz: Der deutsche Pop-Roman. Die neuen Archivisten. C.H. Beck, München, 2002.
Baßler, Moritz: Deutsche Erzählprosa 1850-1950. Eine Geschichte literarischer Verfahren. Berlin, Erich Schmidt Verlag, 2015.
Beuse, Stefan: 154 schöne weiße leere Blätter. Christian Krachts „Faserland“ (1995). In: Der deutsche Roman der Gegenwart. Hrsg. von Wieland & Winfried Freund. München: Wilhelm Fink Verlag, München, 2001. S. 150-155.
Diederichsen, Diedrich: „Pop – deskriptiv, normativ, emphatisch” (1996) und „Ist was, Pop?“ (1999) in: Charis Goer, Stefan Greif, Christoph Jacke (Hrsg.): Texte zur Theorie des Pop. Stuttgart: Reclam, 2013.
Hasbach, Claudia: Christian Krachts „Faserland“ im Kontext der neuen deutschen Popliteratur. Düsseldorf 2010.
Hecken, Thomas: Pop.Geschichte eines Konzepts. 1955-2009. Bielefeld, transcript Verlag, 2009.
Jugendliche Lebenswelten im Spiegel der deutschsprachigen Popliteratur seit den 1990er Jahren, in: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes 55 (2008), H. 2: Literatur im 21. Jahrhundert, S. 120-142.
Kendel, Konstanze Maria: Let me entertain you! Die Inszenierung der Popliteratur im Literaturbetrieb der Gegenwart in: Materialien und Ergebnisse aus Forschungsprojekten des Instituts Heft 17, Bremen, 2005.
Obst, Helmut: Der deutsche Pop-Roman und die Postmoderne seit 1990. Dargestellt an Erzählprosa von Christian Kracht, Benjamin von Stuckrad-Barre und Benjamin Lebert. Stuttgart, 2002.
Paulokat, Ute, Degler/ Frank: Neue Deutsche Popliteratur, Paderborn; Stuttgart, Fink Verlag, 2008.
Überquert die Grenzen, schließt den Graben! (1968): Das Zeitalter der neuen Literatur. Die Wieder-Geburt der Kritik. In: Christ und Welt (13. 09. 1968) + Das Zeitalter der neuen Literatur. Indianer, Science Fiction und Pornographie. In: Christ und Welt (20. 09. 1968).
Presse
Diez, Georg: Christian Kracht: Faserland. Frankfurter Allgemeine Zeitung. 17. März 2002.
fis: Faserland hat das Zeug zum deutschen Kultbuch der 90er. In: Frankfurter Neue Presse, 5. April 1995.
Halter, Martin in: Tages-Anzeiger, Zürich, vom 29. April 1995.
Steinert, Hajo: Dandy, Schnösel oder Ekel, in: Die Weltwoche vom 30. März 1995.
Junge Hühner, alte Hasen. In: Stern 11 November 1995.
Kracht, Christian: Ich denke immer an den Krieg, Interview mit der Zeitschrift Neon, Oktober 2008.
Internetquellen
Weber, Stefanie: Der Bildungsroman im Zeitalter der Pop-Literatur. Wolfgang Herrndorf und Christian Kracht, München, GRIN Verlag, 2016. https://www.grin.com/document/351339
https://www.youtube.com/watch?v=Y3036n9hTXU ab 7:25min, abgerufen am 21.08.2019
https://www.zeit.de/1999/37/199937.reden_stuckrad_k.xml , abgerufen am 04.06.2019
https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/rezension-belletristik-christian-kracht-faserland-152146.html
[...]
1 fis: Faserland hat das Zeug zum deutschen Kultbuch der 90er. In: Frankfurter Neue Presse, 5. April 1995.
2 Junge Hühner, alte Hasen. In: Stern 11 November 1995.
3 Vgl. Halter, Martin in: Tages-Anzeiger, Zürich, vom 29. April 1995.
4 Vgl. Steinert Hajo: Dandy, Schnösel oder Ekel, in: Die Weltwoche vom 30. März 1995.
5 Beuse, Stefan: 154 schöne weiße leere Blätter. Christian Krachts „Faserland“ (1995). In: Der deutsche Roman der Gegenwart. Hrsg. von Wieland & Winfried Freund. Wilhelm Fink Verlag, München, 2001. S. 152.
6 Illies, Florian: Generation Golf. Eine Inspektion. 13. Aufl. S. Fischer, Frankfurt am Main 2011, S. 111.
7 Vgl. Baßler, Moritz: Der deutsche Pop-Roman. Die neuen Archivisten. München: C.H. Beck 2002, S. 110.
8 Es gibt zwei Schreibweisen: Erstens ‚Popliteratur‘, wobei hier ‚Pop‘ und ‚Literatur‘ zu einer Einheit verschmolzen sind und zweitens ‚ Pop-Literatur ‘, wobei der Bindestrich suggeriert, dass Pop-Literatur eine Strömung des Pop ist wie die Pop-Art oder die Pop-Musik. Der Einfachheit halber werde ich im Folgenden, außer in wörtlichen Zitaten nur die erste Schreibweise verwenden.
9 Diez, Georg: Christian Kracht: Faserland. Frankfurter Allgemeine Zeitung. 17. März 2002, in: https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/belletristik/rezension-belletristik-christian-kracht-faserland-152146.html abgerufen am 15.06.2019.
10 Diederichsen, Diedrich: „Pop – deskriptiv, normativ, emphatisch” (1996) und „Ist was, Pop?“ (1999) in: Charis Goer, Stefan Greif, Christoph Jacke (Hrsg.): Texte zur Theorie des Pop. Stuttgart: Reclam, 2013, hier S.188.
11 Kendel, Konstanze Maria: Let me entertain you! Die Inszenierung der Popliteratur im Literaturbetrieb der Gegenwart in: Materialien und Ergebnisse aus Forschungsprojekten des Instituts Heft 17, Bremen, 2005, S.31.
12 Ebd., S.32.
13 Ebd.
14 Hasbach, Claudia: Christian Krachts „Faserland“ im Kontext der neuen deutschen Popliteratur. Düsseldorf 2010, S.21.
15 Vgl.: Obst, Helmut: Der deutsche Pop-Roman und die Postmoderne seit 1990. Dargestellt an Erzählprosa von Christian Kracht, Benjamin von Stuckrad-Barre und Benjamin Lebert. Stuttgart, 2002, S.08f.
16 Obst, Helmut: Der deutsche Pop-Roman und die Postmoderne seit 1990. Dargestellt an Erzählprosa von Christian Kracht, Benjamin von Stuckrad-Barre und Benjamin Lebert. 2002, S.10.
17 Hasbach, Claudia: Christian Krachts „Faserland“ im Kontext der neuen deutschen Popliteratur. Düsseldorf 2010, S.13.
18 Diederichsen, Diedrich: „Pop – deskriptiv, normativ, emphatisch” (1996) und „Ist was, Pop?“ (1999) in: Charis Goer, Stefan Greif, Christoph Jacke (Hrsg.): Texte zur Theorie des Pop. Stuttgart: Reclam, 2013.S.10.
19 Ebd., S.192.
20 Ebd., S.242.
21 Vgl. Hasbach, Claudia: Christian Krachts „Faserland“ im Kontext der neuen deutschen Popliteratur. Düsseldorf 2010, S.14.
22 Kendel, Konstanze Maria: Let me entertain you! Die Inszenierung der Popliteratur im Literaturbetrieb der Gegenwart in: Materialien und Ergebnisse aus Forschungsprojekten des Instituts Heft 17, Bremen, 2005, S.33.
23 Hasbach, Claudia: Christian Krachts „Faserland“ im Kontext der neuen deutschen Popliteratur. Düsseldorf 2010, S.09.
24 https://www.zeit.de/1999/37/199937.reden_stuckrad_k.xml/seite-2 abgerufen am 04.06.2019.
25 Diese Zählungen beziehen sich ausschließlich auf die vorliegende Auflage. Bereits in der zweiten Auflage fehlte die Parisienne-Zigarette.
26 Kracht, Christian: Faserland (1995), 4. Auflage, Frankfurt am Main, S. Fischer, 2015, S.13.
27 Reiter 2011, S.12.
28 Beuse, Stefan: 154 schöne weiße leere Blätter. Christian Krachts „Faserland“ (1995). In: Der deutsche Roman der Gegenwart. Hrsg. von Wieland & Winfried Freund. München: Wilhelm Fink Verlag 2001. S. 150-155, hier S. 151.
29 Vgl. Paulokat, Ute, Degler/ Frank: Neue Deutsche Popliteratur, Paderborn; Stuttgart, Fink Verlag, 2008, S. 47.
30 Kracht, Christian: Faserland (1995), 4. Auflage, Frankfurt am Main, S. Fischer, 2015, S. 23, 33f.
31 Ebd., S. 32, 35f.
32 Ebd., S. 36-48.
33 Ebd., S. 40.
34 Ebd., S. 51f.
35 Vgl. Paulokat, Ute, Degler/ Frank: Neue Deutsche Popliteratur, Paderborn; Stuttgart, Fink Verlag, 2008, S. 07.
36 Ebd., S. 97.
37 Kracht, Christian: Faserland (1995), 4. Auflage, Frankfurt am Main, S. Fischer, 2015, S. 13.
38 Ebd., S. 21, 25, 60.
39 Ebd., S. 42f, 144f.
40 Ebd., S. 106, 108f, 144, 151, 156.
41 Beuse, Stefan: 154 schöne weiße leere Blätter. Christian Krachts „Faserland“. In: Wieland Freund/Winfried Freund (Hg.): Der deutsche Roman der Gegenwart. München: Fink 2001, S. 150–155, hier S. 154.
42 Kracht, Christian: Ich denke immer an den Krieg, Interview mit der Zeitschrift Neon, Oktober 2008.
43 Kracht, Christian: Faserland (1995), 4. Auflage, Frankfurt am Main, S. Fischer, 2015, S. 36.
44 Vgl. Salinger, Jerome David: Der Fänger im Roggen (1951), neuübers. von Eike Schönfeld, 11. Auflage, Reinbek bei Hamburg, 2010.
45 Jugendliche Lebenswelten im Spiegel der deutschsprachigen Popliteratur seit den 1990er Jahren, in: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes 55 (2008), H. 2: Literatur im 21. Jahrhundert, S. 120-142.
46 Überquert die Grenzen, schließt den Graben! (1968): Das Zeitalter der neuen Literatur. Die Wieder- Geburt der Kritik. In: Christ und Welt (13. 09. 1968) + Das Zeitalter der neuen Literatur. Indianer, Science Fiction und Pornographie. In: Christ und Welt (20. 09. 1968).
47 Eco, Umberto [zitiert nach Weber, Stefanie: Der Bildungsroman im Zeitalter der Pop-Literatur. Wolfgang Herrndorf und Christian Kracht, München, GRIN Verlag, 2016. https://www.grin.com/document/351339].
48 Eco, Umberto [zitiert nach Weber, Stefanie: Der Bildungsroman im Zeitalter der Pop-Literatur. Wolfgang Herrndorf und Christian Kracht, München, GRIN Verlag, 2016. https://www.grin.com/document/351339].
49 Jugendliche Lebenswelten im Spiegel der deutschsprachigen Popliteratur seit den 1990er Jahren, in: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes 55 (2008), H. 2: Literatur im 21. Jahrhundert, S. 120-142.
50 Überquert die Grenzen, schließt den Graben! (1968): Das Zeitalter der neuen Literatur. Die Wieder- Geburt der Kritik. In: Christ und Welt (13. 09. 1968) + Das Zeitalter der neuen Literatur. Indianer, Science Fiction und Pornographie. In: Christ und Welt (20. 09. 1968).
51 Kracht, Christian: Faserland (1995), 4. Auflage, Frankfurt am Main, S. Fischer, 2015, S. 13.
52 Ebd. S. 21, 25, 60.
53 Ebd. S. 16.
54 Paulokat, Ute, Degler/ Frank: Neue Deutsche Popliteratur, Paderborn; Stuttgart, Fink Verlag, 2008, S. 99.
55 Jugendliche Lebenswelten im Spiegel der deutschsprachigen Popliteratur seit den 1990er Jahren, in: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes 55 (2008), H. 2: Literatur im 21. Jahrhundert, S. 120-142.
56 Hecken, Thomas: Pop.Geschichte eines Konzepts. 1955-2009. Bielefeld, transcript Verlag, 2009, S. 446.
57 Baßler, Moritz: Deutsche Erzählprosa 1850-1950. Eine Geschichte literarischer Verfahren. Berlin, Erich Schmidt Verlag, 2015, S. 70.
58 Vgl. Diederichsen, Diedrich: „Pop – deskriptiv, normativ, emphatisch” (1996) und „Ist was, Pop?“ (1999) in: Charis Goer, Stefan Greif, Christoph Jacke (Hrsg.): Texte zur Theorie des Pop. Stuttgart: Reclam, 2013, S. 188.
59 Kracht, Christian: Faserland (1995), 4. Auflage, Frankfurt am Main, S. Fischer, 2015, S. 107f.
60 Kendel, Konstanze Maria: Let me entertain you! Die Inszenierung der Popliteratur im Literaturbetrieb der Gegenwart in: Materialien und Ergebnisse aus Forschungsprojekten des Instituts Heft 17, Bremen, 2005, S. 33.
61 Ebd., S. 66.
62 Borgstedt, Angela [zitiert nach Weber, Stefanie: Der Bildungsroman im Zeitalter der Pop-Literatur. Wolfgang Herrndorf und Christian Kracht, München, GRIN Verlag, 2016, S. 27.
63 Kracht, Christian: Faserland (1995), 4. Auflage, Frankfurt am Main, S. Fischer, 2015, S. 13.
64 Vgl. Baßler, Moritz: Deutsche Erzählprosa 1850-1950. Eine Geschichte literarischer Verfahren. Berlin, Erich Schmidt Verlag, 2015, S. 79.
65 Kracht, Christian: Faserland (1995), 4. Auflage, Frankfurt am Main, S. Fischer, 2015, S. 15.
66 Ebd., S. 56.
67 Ebd., S. 46 – 48.
68 Ebd., S. 61.
69 Paulokat, Ute, Degler/ Frank: Neue Deutsche Popliteratur, Paderborn; Stuttgart, Fink Verlag, 2008, S. 22f.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt des Textes über "Faserland" von Christian Kracht?
Der Text ist eine umfassende Analyse des Romans "Faserland" von Christian Kracht und dessen Einordnung in den Kontext der Popliteratur. Er beinhaltet eine Einleitung, die die Rezeption des Romans beleuchtet, sowie Kapitel, die sich mit den Merkmalen von Popliteratur, insbesondere im Hinblick auf "Faserland", auseinandersetzen. Der Text diskutiert die Bedeutung von Begriffen wie 'Pop', 'Surface Noise' und 'Zeitgeist' und untersucht, inwieweit "Faserland" als prototypisches Werk der Popliteratur gelten kann. Abschließend wird ein Fazit gezogen und ein Literatur- und Quellenverzeichnis bereitgestellt.
Welche Hauptthemen werden in der Analyse von "Faserland" behandelt?
Die Hauptthemen umfassen die Definition und Merkmale von Popliteratur, Konsumkritik, Identitätskrisen, Adoleszenz-Thematiken (Liebe, Freundschaft, Partys, Sex, Drogen), die Rolle von Markennamen und Intermedialität in der Literatur, sowie die Darstellung des Zeitgeistes und des gesellschaftlichen Klimas der 1990er Jahre.
Welche Kritik wurde an "Faserland" geäußert?
Ursprünglich wurde "Faserland" als handlungsarm, langweilig, arrogant und oberflächlich kritisiert. Einige Kritiker warfen dem Autor vor, Jay McInerney oder Bret Easton Ellis zu plagiieren und keine klare gesellschaftspolitische Position zu beziehen. Es wurde bemängelt, dass sich der Roman unkritisch in der Markenwelt einrichte.
Welche positiven Aspekte werden in der Analyse von "Faserland" hervorgehoben?
Die Analyse betont, dass "Faserland" als ein Gründungsphänomen des Literatur-Pop betrachtet werden kann. Die Ernsthaftigkeit, mit der Kracht Markenprodukte als Fundamente des Lebens darstellt, wird als befreiend empfunden. Der Roman wird als eine Darstellung aufklärerischer Dialektik und als eine Identifikationsfigur für eine ganze Generation gelobt.
Was bedeutet der Begriff "Surface Noise" im Kontext der Popliteratur?
"Surface Noise" bezieht sich auf die oberflächliche Darstellung der Dinge und die Betonung der Äußerlichkeiten in der Popliteratur. Es wird diskutiert, ob diese Oberflächlichkeit eine tiefere Bedeutungsebene verbergen kann, die das Leiden an der Welt auf andere Weise ausdrückt.
Wie wird "Faserland" mit anderen Werken der Literaturgeschichte in Verbindung gebracht?
"Faserland" wird im Kontext der Beat Generation und des Romans "The Catcher in the Rye" von J.D. Salinger betrachtet. Die Analyse vergleicht die Adoleszenz-Thematiken und die kritische Auseinandersetzung mit der Gesellschaft in diesen Werken.
Welche Rolle spielen Markennamen in "Faserland"?
Markennamen werden in "Faserland" nicht nur als Spiegel des Konsumerismus und Markenfetischismus verwendet, sondern auch, um die Oberfläche der Welt, in der sich der Ich-Erzähler bewegt, plastisch zu veranschaulichen. Sie fungieren teilweise als Adjektive und prägen die Wahrnehmung und Identität des Erzählers.
Was ist das Fazit der Analyse von "Faserland"?
Das Fazit ist, dass "Faserland" trotz Krachts eigener Aussage, er wisse nicht, was Popliteratur sei, prototypische Merkmale der Popliteratur aufweist. Durch die inflationäre Verwendung von Markensymbolismus, Intermedialität und das Verharren im "Surface Noise" entsteht ein höchst artifizieller Text, der das Phänomen Popliteratur maßgeblich mitgeprägt hat.
- Quote paper
- Nico Bornschein-Jäger (Author), 2019, Is dat Pop...literatur? Oder kann dat wech?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/501982