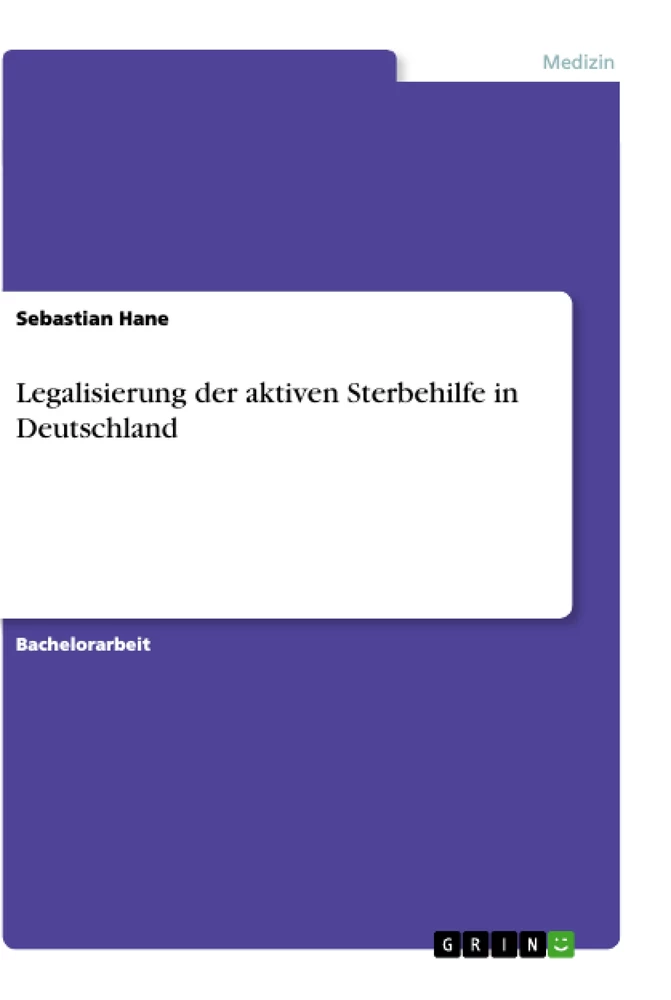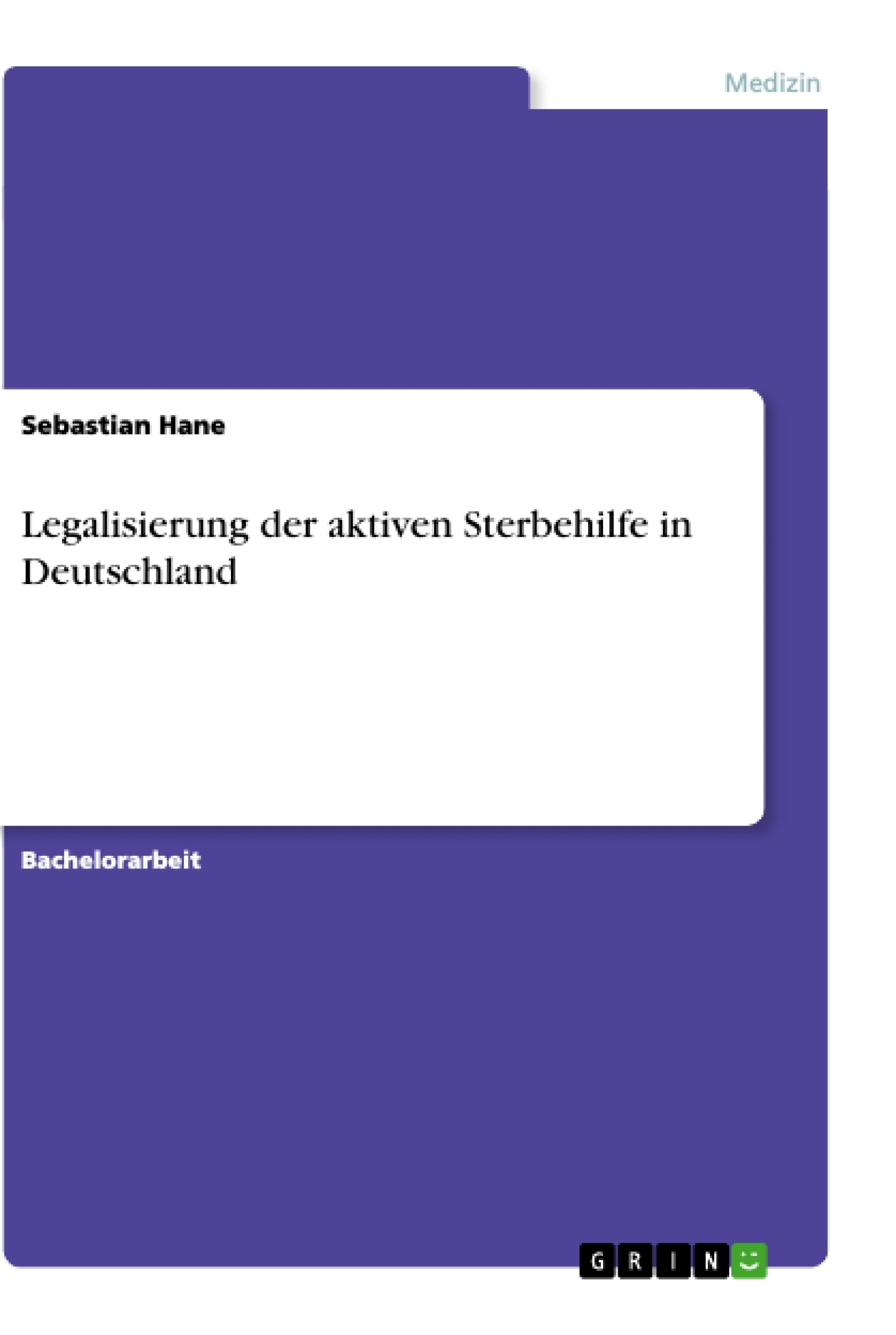Soll in Deutschland die aktive Sterbehilfe und/oder die Beihilfe zum Suizid nach dem schweizerischen Sterbehilfekonzept legalisiert werden? Diese Fragestellung untersucht diese Bachelor-Thesis. Gesetzlich zulässig sind in Deutschland heutzutage nur die passive und die indirekte Sterbehilfe, während die Schweiz neben diesen Formen auch die Beihilfe zum Suizid legalisiert hat. Beide Staaten verbieten hingegen die aktive Sterbehilfe.
Seit vielen Jahren ist die Einführung und Legalisierung der aktiven Sterbehilfe ein viel diskutiertes Thema, an dem sich die Meinungen scheiden. Dabei ist es keinesfalls neu. Schon der römische Philosoph Seneca (1 bis 65 n. Chr.) warf die Frage auf: "Wenn der eine Tod unter Qualen, der andere aber einfach und leicht sich vollzieht, warum sollte diesem nicht die Hand nachhelfen dürfen?". Bis in die heutige Zeit hat das Thema an Aktualität nicht verloren. Im Gegenteil haben in jüngster Zeit eine Vielzahl gerichtlicher Entscheidungen und Veröffentlichungen die Diskussion erneut beflügelt und das Thema wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.
Befürworter einer Legalisierung bestimmter Formen der Sterbehilfe verweisen immer wieder auf die gesetzlichen Regelungen in unseren Nachbarstaaten Schweiz und Niederlande. Häufig wird dabei die Schweiz als ein gelungenes Beispiel benannt, weshalb verschiedene Sterbehilfeorganisationen deutsche Sterbewillige dahingehend beraten, den assistierten Suizid in der Schweiz zu wählen. Und rein faktisch hat ein regelrechter Sterbehilfetourismus in der Schweiz längst Formen angenommen.
Die Legalisierung der Sterbehilfe wird teilweise hochemotional und brisant erörtert. Beteiligt sind in erster Linie Betroffenen- und Patientenverbände, Ärzte und Vertreter ärztlicher Standesorganisationen. Da das Thema nicht nur medizinische Aspekte hat, sondern auch ethische, erheben die Kirchen und Glaubensorganisationen ihrerseits moraltheologische und medizinisch-ethische Einwände. Die Beteiligung großer gesellschaftlicher Gruppen bewirkt zwangsläufig, dass sich Vertreter der politischen Gremien und Parteien ebenfalls sehr kontrovers an der Diskussion beteiligen. Die demografische Entwicklung und Überalterung unserer Gesellschaft werden voraussichtlich dazu beitragen, dass die Diskussion um die Erlaubnis der aktiven Sterbehilfe an Brisanz nicht verlieren, sondern eher zunehmen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Zielsetzung
- Vorgehensweise
- Theoretischer Teil
- Methodik der Literatursuche
- Sterbehilfemethoden, Palliativmedizin, Patientenverfügung
- Aktive Sterbehilfe
- Beihilfe zum Suizid
- Passive Sterbehilfe
- Indirekte Sterbehilfe
- Palliativmedizinische Versorgung
- Patientenverfügung
- Deutsche Geschichte der Sterbehilfe und Rechtsgrundlagen
- Jüngste Gesetzgebungsinitiativen und Urteile
- Rechtslage in der Schweiz
- Schweizerische und deutsche Sterbehilfeorganisationen
- EXIT
- DIGNITAS
- Sterbehilfe Deutschland e. V.
- DIGNITAS-Deutschland e. V.
- Ethische und moralische Erwägungen zur Sterbehilfe
- Definition Ethik
- Moralethische Gesichtspunkte
- Medizinethische Gesichtspunkte
- Religiöse Gesichtspunkte
- Empirischer Teil
- Konzeption der empirischen Untersuchung
- Untersuchungsmethode
- Aufbau des Fragebogens
- Herleitung der Fragen
- Teilnehmer
- Pilotierung des Fragebogens
- Durchführung der Untersuchung
- Ergebnisse
- Ergebnisse aus früheren Fremdstudien
- Ergebnisse der Häufigkeiten
- Ergebnisse der Kreuzungen
- Ergebnisse der Abhängigkeiten
- Diskussionsteil
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Frage der Legalisierung der aktiven Sterbehilfe und/oder der Beihilfe zum Suizid in Deutschland, basierend auf dem Schweizer Modell. Ziel ist es, die aktuelle Debatte zu beleuchten und die verschiedenen Perspektiven zu analysieren.
- Rechtslage der Sterbehilfe in Deutschland und der Schweiz
- Ethische und moralische Implikationen der aktiven Sterbehilfe
- Analyse verschiedener Sterbehilfemethoden
- Auswertung empirischer Daten zur öffentlichen Meinung
- Bewertung aktueller Gesetzgebungsinitiativen und Gerichtsurteile
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Legalisierung der aktiven Sterbehilfe und Beihilfe zum Suizid in Deutschland im Vergleich zum Schweizer Modell vor. Sie skizziert die aktuelle Rechtslage, die gesellschaftliche Relevanz des Themas und die aktuelle juristische Auseinandersetzung um § 217 StGB. Die Einleitung betont die Notwendigkeit einer umfassenden Untersuchung aufgrund der gegensätzlichen Meinungen und der wichtigen Rolle des Bundesverfassungsgerichts in dieser Debatte.
Theoretischer Teil: Dieser Teil bietet einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Formen der Sterbehilfe (aktiv, passiv, indirekt, Beihilfe zum Suizid), die Rolle der Palliativmedizin und Patientenverfügungen. Er analysiert die deutsche und Schweizer Rechtslage, untersucht die Geschichte der Sterbehilfe in Deutschland, bewertet jüngste Gesetzgebungsinitiativen und Gerichtsurteile und beschreibt die Aktivitäten relevanter Organisationen in beiden Ländern. Ein wichtiger Aspekt ist die Auseinandersetzung mit ethischen und moralischen Überlegungen, inklusive medizinischer, moralischer und religiöser Perspektiven.
Empirischer Teil: Der empirische Teil beschreibt die Methodik der durchgeführten Studie, den Aufbau und die Herleitung der Fragen im Fragebogen, die Auswahl der Teilnehmer und die Pilotierung des Fragebogens. Er präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung, unterteilt in Häufigkeiten, Kreuztabellen und die Analyse von Abhängigkeiten. Der Fokus liegt auf der quantitativen Auswertung der gesammelten Daten und deren Interpretation im Kontext der Forschungsfrage.
Schlüsselwörter
Aktive Sterbehilfe, Beihilfe zum Suizid, Passive Sterbehilfe, Palliativmedizin, Patientenverfügung, Rechtslage Deutschland, Rechtslage Schweiz, Ethik, Moral, Empirische Untersuchung, § 217 StGB, Bundesverfassungsgericht.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Sterbehilfe in Deutschland und der Schweiz
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Legalisierung der aktiven Sterbehilfe und/oder der Beihilfe zum Suizid in Deutschland, basierend auf dem Schweizer Modell. Sie beleuchtet die aktuelle Debatte und analysiert verschiedene Perspektiven.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Rechtslage der Sterbehilfe in Deutschland und der Schweiz, ethische und moralische Implikationen der aktiven Sterbehilfe, verschiedene Sterbehilfemethoden (aktiv, passiv, indirekt, Beihilfe zum Suizid), die Rolle der Palliativmedizin und Patientenverfügungen, die Auswertung empirischer Daten zur öffentlichen Meinung und die Bewertung aktueller Gesetzgebungsinitiativen und Gerichtsurteile.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen theoretischen Teil, einen empirischen Teil und einen Diskussionsteil. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage vor. Der theoretische Teil bietet einen Überblick über verschiedene Sterbehilfeformen, die Rechtslage und ethische Überlegungen. Der empirische Teil beschreibt eine durchgeführte Studie mit Auswertung der Ergebnisse. Der Diskussionsteil fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Methoden wurden im empirischen Teil verwendet?
Der empirische Teil beinhaltet eine quantitative Untersuchung mittels Fragebogen. Die Arbeit beschreibt die Konzeption der Untersuchung, den Aufbau des Fragebogens, die Auswahl der Teilnehmer, die Pilotierung und die Auswertung der Daten (Häufigkeiten, Kreuztabellen, Abhängigkeiten).
Welche Organisationen werden in der Arbeit erwähnt?
Die Arbeit erwähnt unter anderem die Organisationen EXIT, Dignitas, Sterbehilfe Deutschland e. V. und Dignitas-Deutschland e. V.
Welche Rechtsgrundlagen werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die deutsche und Schweizer Rechtslage zur Sterbehilfe, inklusive der jüngsten Gesetzgebungsinitiativen und Gerichtsurteile, insbesondere im Kontext von § 217 StGB und der Rolle des Bundesverfassungsgerichts.
Welche ethischen und moralischen Aspekte werden diskutiert?
Die Arbeit befasst sich mit ethischen und moralischen Erwägungen aus medizinischer, moralischer und religiöser Perspektive.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Aktive Sterbehilfe, Beihilfe zum Suizid, Passive Sterbehilfe, Palliativmedizin, Patientenverfügung, Rechtslage Deutschland, Rechtslage Schweiz, Ethik, Moral, Empirische Untersuchung, § 217 StGB, Bundesverfassungsgericht.
- Quote paper
- Sebastian Hane (Author), 2019, Legalisierung der aktiven Sterbehilfe in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/501813