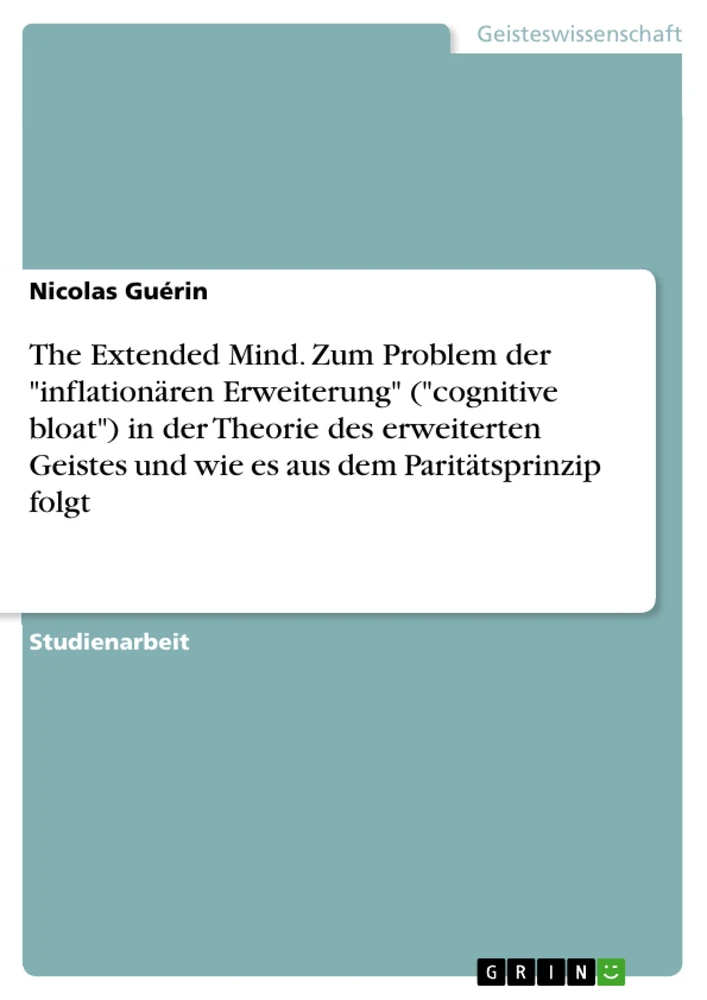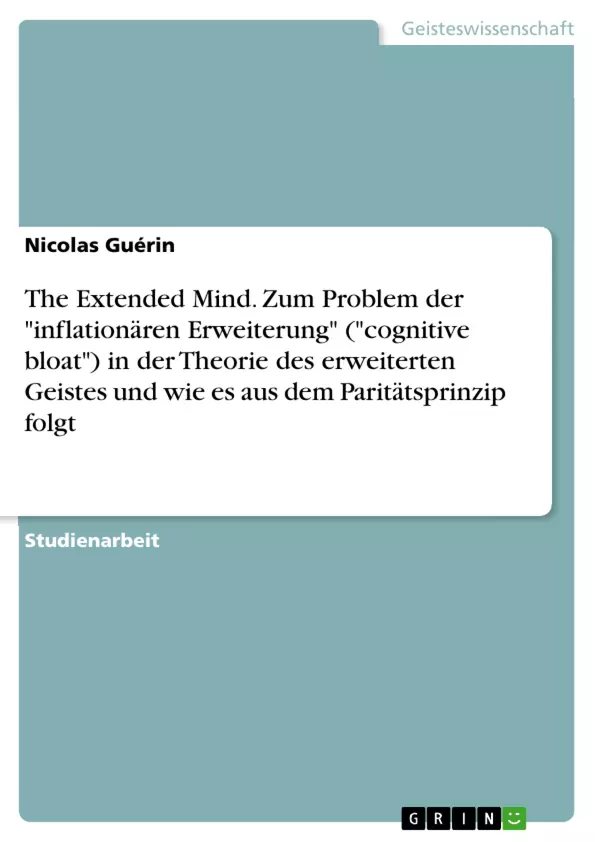Diese Hausarbeit wird zuerst zu einem tieferen Verständnis für die Theorie der erweiterten Kognition verhelfen, anschließend aufzeigen, wie aus dem Paritätsprinzip, welches im Aufsatz von Clark und Chalmers zu finden ist, das Problem der inflationären Erweiterung folgt und dieses Problem aus verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Wir können beobachten: Ein Mensch sieht einen Unfall und greift im Folgenden zum Telefon, wählt eine Rufnummer und kontaktiert einen Notarzt. Doch was geschieht zwischen diesen beiden Ereignissen? Das klassische „Sandwich-Modell“ der Kognition beschreibt diesen Prozess folgendermaßen: Auf einen perzeptuellen Input (jemand sieht einen Unfall) folgt die computationale Manipulation interner, mentaler Repräsentationen (Kognition), woraufhin ein motorischer Output folgt (das Rufen des Notarztes).
Nach klassischer Auffassung sind die kognitiven Prozesse im Gehirn lokalisiert und werden als Aktivitäten des neuronalen Systems im Gehirn verstanden. Die Ergebnisse neuerer Forschung zeigen jedoch: kognitive Systeme sind nicht auf die neuronale Maschinerie im Gehirn beschränkt, sondern sind wesentlich von nicht-neuronalen Prozessen und Umwelteinflüssen abhängig. Demzufolge sind sie auch nicht einfach auf einer abstrakten, informationsverarbeitenden Ebene charakterisierbar, sondern werden von der konkret gegebenen Körperlichkeit und Situiertheit mitbestimmt. Wo wir also die Grenzen eines kognitiven Systems ziehen können, zwischen dem, was sich im Geist und dem, was sich außerhalb des Geistes abspielt, ist nicht so klar, wie angenommen. Auch die Frage, ob der Inhalt kognitiver Prozesse nur von internen Zuständen des kognitiven Systems, oder aber auch von externen Faktoren abhängt, ist unklar.
Wenn also gilt, dass die Umwelt nicht nur eine kausal aktive Rolle bei der Steuerung kognitiver Prozesse spielt, sondern für einige Prozesse gilt, dass sie durch kausal aktive Merkmale der Umwelt konstituiert werden, dann sind kognitive Prozesse nicht nur auf die neuronale Maschinerie bzw. die Grenzen unseres Körpers beschränkt, sondern erstrecken sich über diese Grenze hinaus in die Welt. Dies ist der These der erweiterten Kognition („extended cognition“) und wurde erstmals durch den Aufsatz „The Extended Mind“ von Andy Clark und David Chalmers bekannt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Die These der erweiterten Kognition (EC-These)
- Paritätsprinzip und das Problem „inflationärer Erweiterung“
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der These der erweiterten Kognition (EC-These), die postuliert, dass kognitive Prozesse nicht nur auf das neuronale System im Gehirn beschränkt sind, sondern sich auch in die Umwelt und die Nutzung externer Werkzeuge erstrecken. Die Arbeit analysiert das Paritätsprinzip, das Clark und Chalmers in ihrer Theorie des erweiterten Geistes einführen, und untersucht, wie aus diesem Prinzip das Problem der inflationären Erweiterung entsteht.
- Die EC-These: Erweiterung des kognitiven Systems über das Gehirn hinaus
- Das Paritätsprinzip: Gleichwertigkeit interner und externer kognitiver Prozesse
- Das Problem der inflationären Erweiterung: Gefahr einer übermäßigen Ausweitung des kognitiven Systems
- Bedeutung von Körperlichkeit und Situiertheit für kognitive Prozesse
- Die Rolle externer Hilfsmittel und Werkzeuge in kognitiven Aktivitäten
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der erweiterten Kognition ein und stellt die Problematik der „inflationären Erweiterung“ im Kontext des Paritätsprinzips von Clark und Chalmers vor.
Hauptteil
Die These der erweiterten Kognition (EC-These)
Dieser Abschnitt erläutert die EC-These und ihre Kernaussage, dass kognitive Systeme über das Gehirn hinaus in die Umwelt und externe Hilfsmittel integriert sind. Anhand von Beispielen aus dem Alltag, wie der Nutzung von Stift und Papier bei mathematischen Aufgaben oder der Verwendung eines Taschenrechners, wird der Ansatz der EC-These veranschaulicht.
Paritätsprinzip und das Problem „inflationärer Erweiterung“
Der Abschnitt beleuchtet das Paritätsprinzip, das besagt, dass interne und externe kognitive Prozesse als gleichwertig betrachtet werden sollten. Im Kontext dieser Gleichwertigkeit diskutiert der Text die Problematik der inflationären Erweiterung, die darin besteht, dass die Definition des kognitiven Systems unnötig weit gefasst werden könnte.
Schlüsselwörter
Erweiterte Kognition, EC-These, Paritätsprinzip, Inflationäre Erweiterung, Körperlichkeit, Situiertheit, Kognitive Systeme, Neuronale Maschinerie, Externe Hilfsmittel, Werkzeuge, Umwelt, Epistemische Handlungen.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die These der erweiterten Kognition (Extended Mind)?
Sie besagt, dass kognitive Prozesse nicht auf das Gehirn beschränkt sind, sondern Merkmale der Umwelt (wie Notizbücher oder Smartphones) als Teil des kognitiven Systems konstituieren können.
Was ist das Paritätsprinzip von Clark und Chalmers?
Das Prinzip besagt: Wenn ein externer Prozess so funktioniert, dass wir ihn als kognitiv bezeichnen würden, falls er im Kopf stattfände, dann sollte er auch als Teil des Geistes anerkannt werden.
Was versteht man unter dem Problem der „inflationären Erweiterung“ (Cognitive Bloat)?
Es ist die Kritik, dass die Theorie zu weit geht: Wenn alles Externe kognitiv sein kann, droht der Begriff der Kognition seine Bedeutung zu verlieren (z. B. wäre dann das gesamte Internet Teil meines Geistes).
Was ist das „Sandwich-Modell“ der Kognition?
Ein klassisches Modell, das Kognition als isolierte Schicht zwischen perzeptuellem Input (Wahrnehmung) und motorischem Output (Handlung) betrachtet.
Welche Rolle spielt die „Situiertheit“ in dieser Theorie?
Situiertheit bedeutet, dass Denken immer in einem konkreten körperlichen und räumlichen Kontext stattfindet, der die Art der Informationsverarbeitung maßgeblich mitbestimmt.
- Arbeit zitieren
- Nicolas Guérin (Autor:in), 2019, The Extended Mind. Zum Problem der "inflationären Erweiterung" ("cognitive bloat") in der Theorie des erweiterten Geistes und wie es aus dem Paritätsprinzip folgt, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/501789