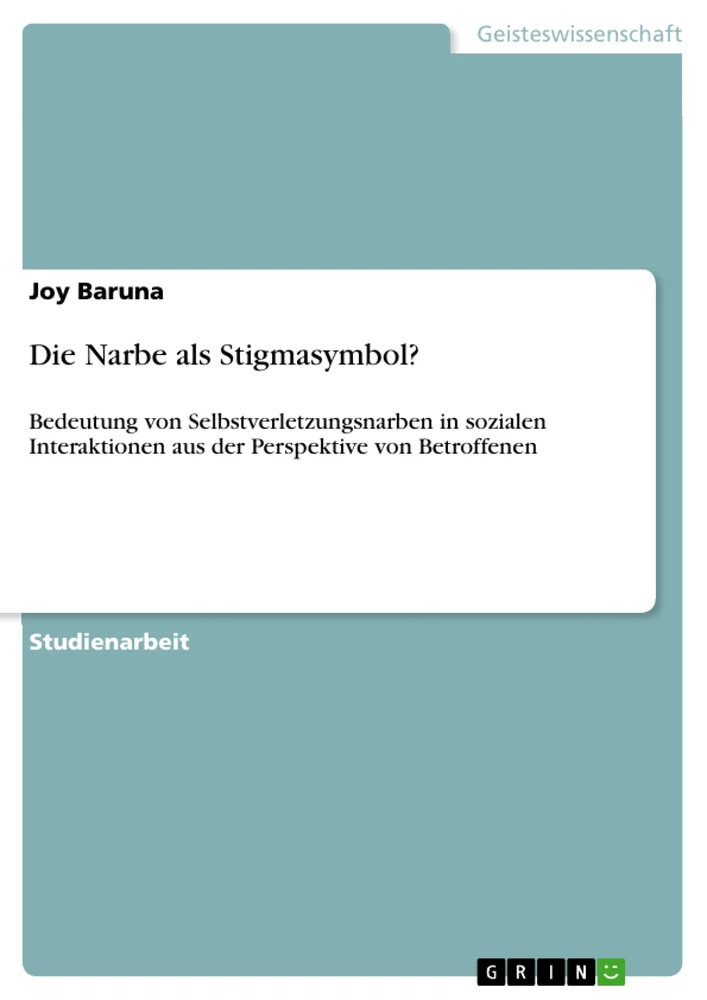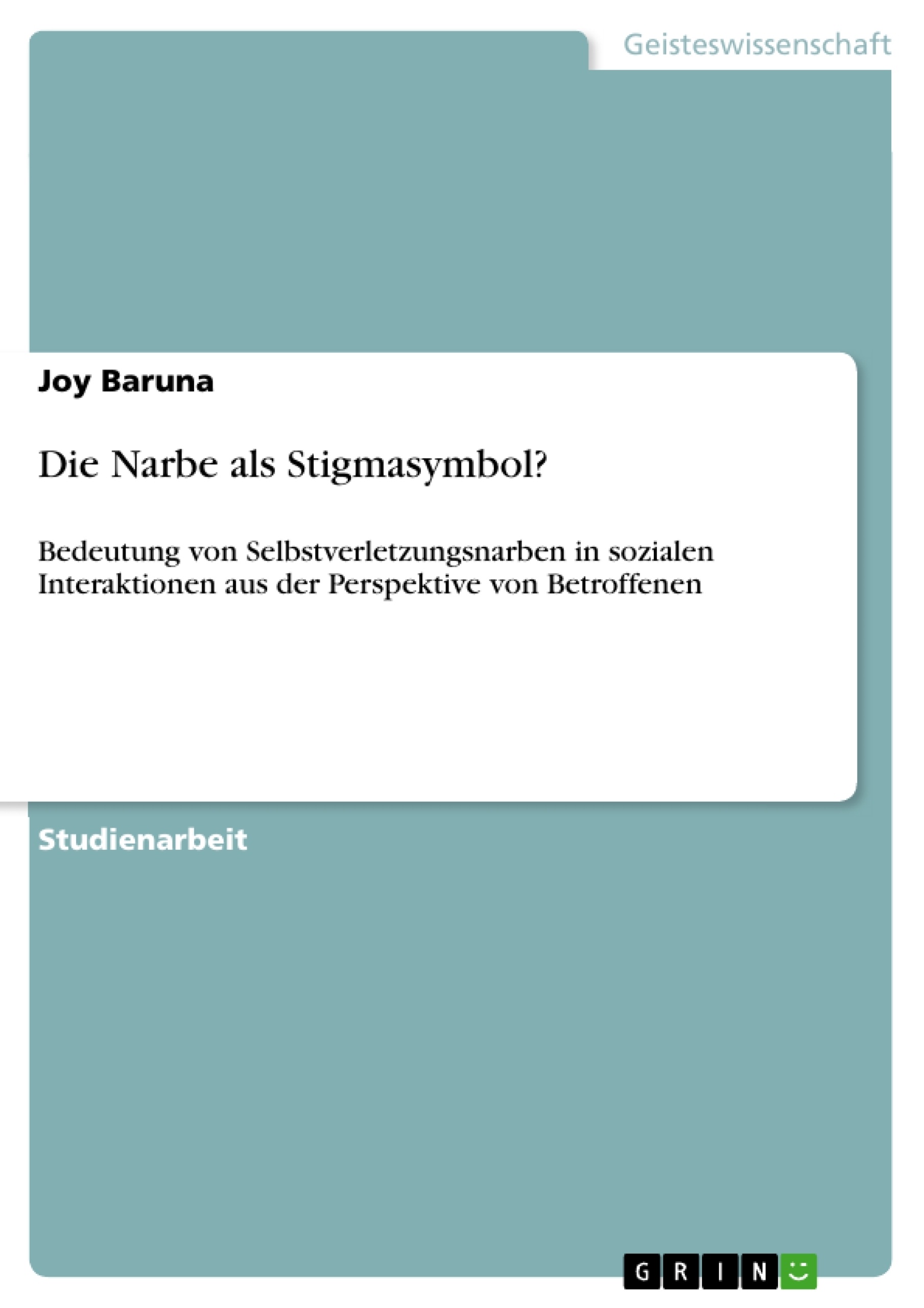In dieser Ausarbeitung soll explorativ die Wirkung von Selbstverletzungsnarben im Kontext sozialer Interaktionen verfolgt beziehungsweise nach einer literaturtheoretischen Auseinandersetzung mit der Narbe als ‚Reminder‘, Wegweiser und Stigmasymbol das methodische Vorgehen beziehungsweise Forschungsdesign zu der Frage skizziert werden, inwieweit durch nichtsuizidales selbstverletzendes Verhalten entstandene Narben in privaten und beruflichen sozialen Alltagssituationen aus Sicht von Betroffenen als Stigmasymbol empfunden werden und wie sich das Vorhandensein dieser Narben und gegebenenfalls stattfindende (Selbst-)Stigmatisierungsprozesse auf das Erleben und Handeln der Betroffenen in sozialen Interaktionen über die Lebensspanne hinweg auswirken. Es handelt sich um eine literaturtheoretische Ausarbeitung mit skizzenhafter Beschreibung einer fiktiven empirischen Untersuchungsplanung.
Die Haut verweist somit auf Vergangenheit und Zukunft. Als "Vermittler zwischen Innen und Außen, von Ich und Umwelt und umgekehrt" (Bidlo 2010) beeinflusst sie wesentlich die Wirkung eines Menschen und prägt demzufolge auch dessen Selbstwertgefühl. Wenn die Haut als "identity card" (Connor 2001) und (Zeit-)Zeuge gelten kann, inwieweit beeinflussen Selbstverletzungsnarben soziale Interaktionen? Was lösen diese Narben aus, einerseits im Kontext einer Zeit, in der das Bewusstsein für Ästhetik geschärft ist und das Ideal des makellosen, medial präsentierten Körper herrscht, andererseits hinsichtlich der Tatsache, dass diese Narben von gewaltvollen Handlungen gegen den Körper der ausführenden Person zeugen, von Wut, Rage, einem symbolischen Angriff und somit von Ausdrucksformen, welche der Entwicklung zunehmender Affektkontrolle im Zuge des Zivilisationsprozesses diametral entgegenstehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Bemerkungen zum Forschungsgegenstand und zur Forschungsfrage
- Soziologische Betrachtung der Selbstverletzungsnarbe
- Die soziale (Be-)Deutung der Narbe und ihr Verhältnis zu NSSV
- Die Narbe als Stigmasymbol
- Methodisches Vorgehen
- Vorannahmen und methodologische Überlegungen
- Das Forschungsdesign – ein Überblick
- Episodische Interviews mit Betroffenen
- Sampling
- Analyse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Bedeutung von Selbstverletzungsnarben in sozialen Interaktionen aus der Perspektive Betroffener. Ziel ist es, die soziale Konstruktion und Wirkung dieser Narben zu beleuchten, insbesondere im Hinblick auf mögliche Stigmatisierungsprozesse über die Lebensspanne. Die Studie berücksichtigt den gesellschaftlichen Kontext, in dem das Ideal eines makellosen Körpers vorherrscht und Selbstverletzung oft als deviantes Verhalten wahrgenommen wird.
- Soziale (Be-)Deutung von Selbstverletzungsnarben
- Die Narbe als Stigmasymbol und ihre Auswirkungen auf soziale Interaktionen
- Veränderungsprozesse der (Selbst-)Stigmatisierung über die Lebensspanne
- Einfluss gesellschaftlicher Normen und Ideale auf die Wahrnehmung von Narben
- Vergleich mit Stigmatisierungsprozessen bei psychischen Erkrankungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitende Bemerkungen zum Forschungsgegenstand und zur Forschungsfrage: Die Einleitung führt in die Thematik der Selbstverletzungsnarben und deren soziale Bedeutung ein. Sie stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss dieser Narben auf soziale Interaktionen und den möglichen Aspekt der Stigmatisierung in den Mittelpunkt. Der Bezug auf die Haut als "identity card" und "Zeitzeuge" verdeutlicht die Komplexität der Thematik. Die Einleitung hebt die Lücke in der Forschung hervor, die sich weniger auf die soziale Konstruktion und Wirkung der Narben konzentriert, als auf das selbstverletzende Verhalten an sich. Sie skizziert die Notwendigkeit, sozioökonomische Hintergründe und gesellschaftliche Kontexte miteinzubeziehen und kündigt das methodische Vorgehen an.
Soziologische Betrachtung der Selbstverletzungsnarbe: Dieses Kapitel analysiert die Selbstverletzungsnarbe soziologisch. Es beleuchtet die soziale Bedeutung der Narbe im Kontext von nichtsuizidalem selbstverletzenden Verhalten (NSSV) und untersucht die Narbe als potenzielles Stigmasymbol. Der Kapitelteil diskutiert verschiedene wissenschaftliche Perspektiven auf Selbstverletzung – von der psychopathologischen bis zur soziologischen Sichtweise. Es wird die Entwicklung von der "medicalization" hin zur "demedicalization" von NSSV und der damit verbundenen Veränderung der Stigmatisierung erörtert. Weiterhin werden verschiedene theoretische Ansätze besprochen, welche die Narbe als "Reminder", Wegweiser und Stigmasymbol betrachten.
Schlüsselwörter
Selbstverletzung, Selbstverletzungsnarben, Stigma, Stigmatisierung, soziale Interaktion, NSSV, Soziale Konstruktion, Körper, Identität, Gesellschaft, Soziologie, Stigmamanagement.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Soziologische Betrachtung von Selbstverletzungsnarben
Was ist der Gegenstand dieser Forschungsarbeit?
Die Arbeit untersucht die soziale Bedeutung von Selbstverletzungsnarben und deren Einfluss auf soziale Interaktionen. Der Fokus liegt auf der Frage, wie diese Narben sozial konstruiert werden und welche Auswirkungen sie – insbesondere im Hinblick auf Stigmatisierungsprozesse – über die Lebensspanne haben.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage befasst sich mit dem Einfluss von Selbstverletzungsnarben auf soziale Interaktionen und dem damit verbundenen Aspekt der Stigmatisierung. Es wird untersucht, wie die Narben sozial gedeutet werden und welche Rolle gesellschaftliche Normen und Ideale dabei spielen.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Studie verwendet ein qualitatives Forschungsdesign, das auf episodischen Interviews mit Betroffenen basiert. Die Auswahl der Teilnehmer (Sampling) und die anschließende Analyse der Interviews werden detailliert beschrieben. Die Arbeit berücksichtigt methodologische Überlegungen und Vorannahmen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die soziale Bedeutung von Selbstverletzungsnarben, ihre Funktion als potenzielles Stigmasymbol und die Auswirkungen auf soziale Interaktionen. Weitere Schwerpunkte sind die Veränderungsprozesse der (Selbst-)Stigmatisierung über die Lebensspanne, der Einfluss gesellschaftlicher Normen und Ideale sowie ein Vergleich mit Stigmatisierungsprozessen bei psychischen Erkrankungen.
Wie wird die Selbstverletzungsnarbe soziologisch betrachtet?
Das Kapitel zur soziologischen Betrachtung analysiert die Narbe im Kontext von nichtsuizidalem selbstverletzendem Verhalten (NSSV). Es untersucht sie als potenzielles Stigmasymbol und diskutiert verschiedene wissenschaftliche Perspektiven, einschließlich der Entwicklung von der "Medicalisierung" zur "Demedicalisierung" von NSSV und den damit verbundenen Veränderungen der Stigmatisierung. Theoretische Ansätze, die die Narbe als "Reminder", Wegweiser und Stigmasymbol betrachten, werden ebenfalls besprochen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur soziologischen Betrachtung der Selbstverletzungsnarbe, ein Kapitel zum methodischen Vorgehen und ein Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik ein, stellt die Forschungsfrage und skizziert das methodische Vorgehen. Das Kapitel zur soziologischen Betrachtung analysiert die soziale Bedeutung der Narbe. Das Kapitel zum methodischen Vorgehen beschreibt detailliert den Forschungsansatz. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Selbstverletzung, Selbstverletzungsnarben, Stigma, Stigmatisierung, soziale Interaktion, NSSV, Soziale Konstruktion, Körper, Identität, Gesellschaft, Soziologie, Stigmamanagement.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit Selbstverletzung, Stigmatisierung und sozialen Interaktionen beschäftigen. Sie bietet Einblicke in die soziale Konstruktion von Selbstverletzungsnarben und deren Auswirkungen auf das Leben Betroffener. Die Arbeit kann auch für Fachkräfte im Gesundheitswesen und in der Sozialarbeit von Interesse sein.
- Quote paper
- Joy Baruna (Author), 2019, Die Narbe als Stigmasymbol?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/501707