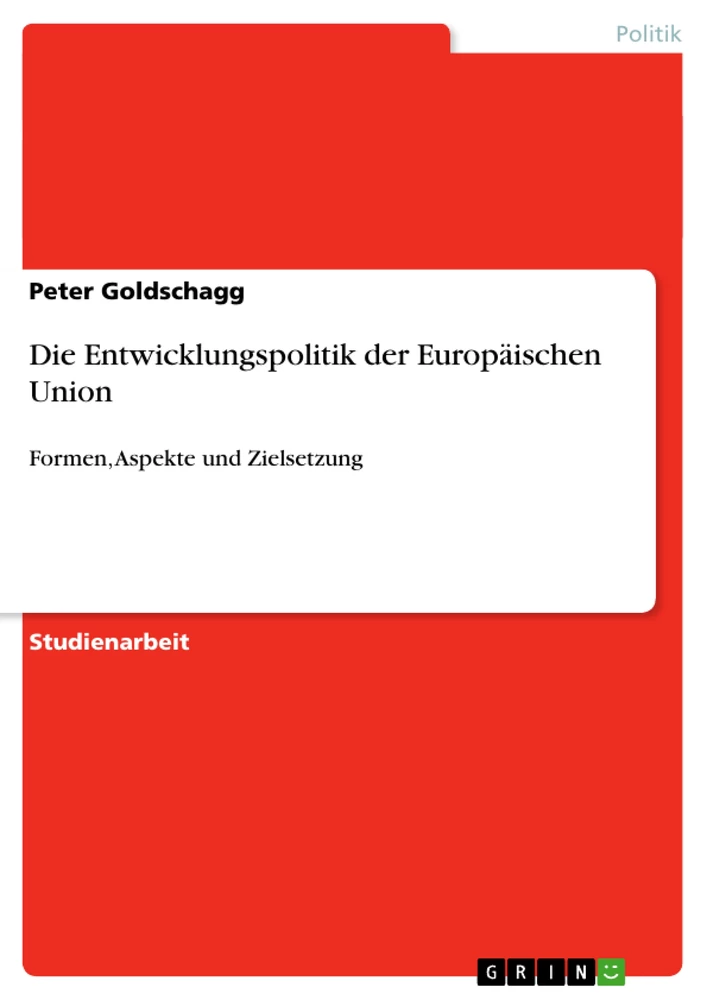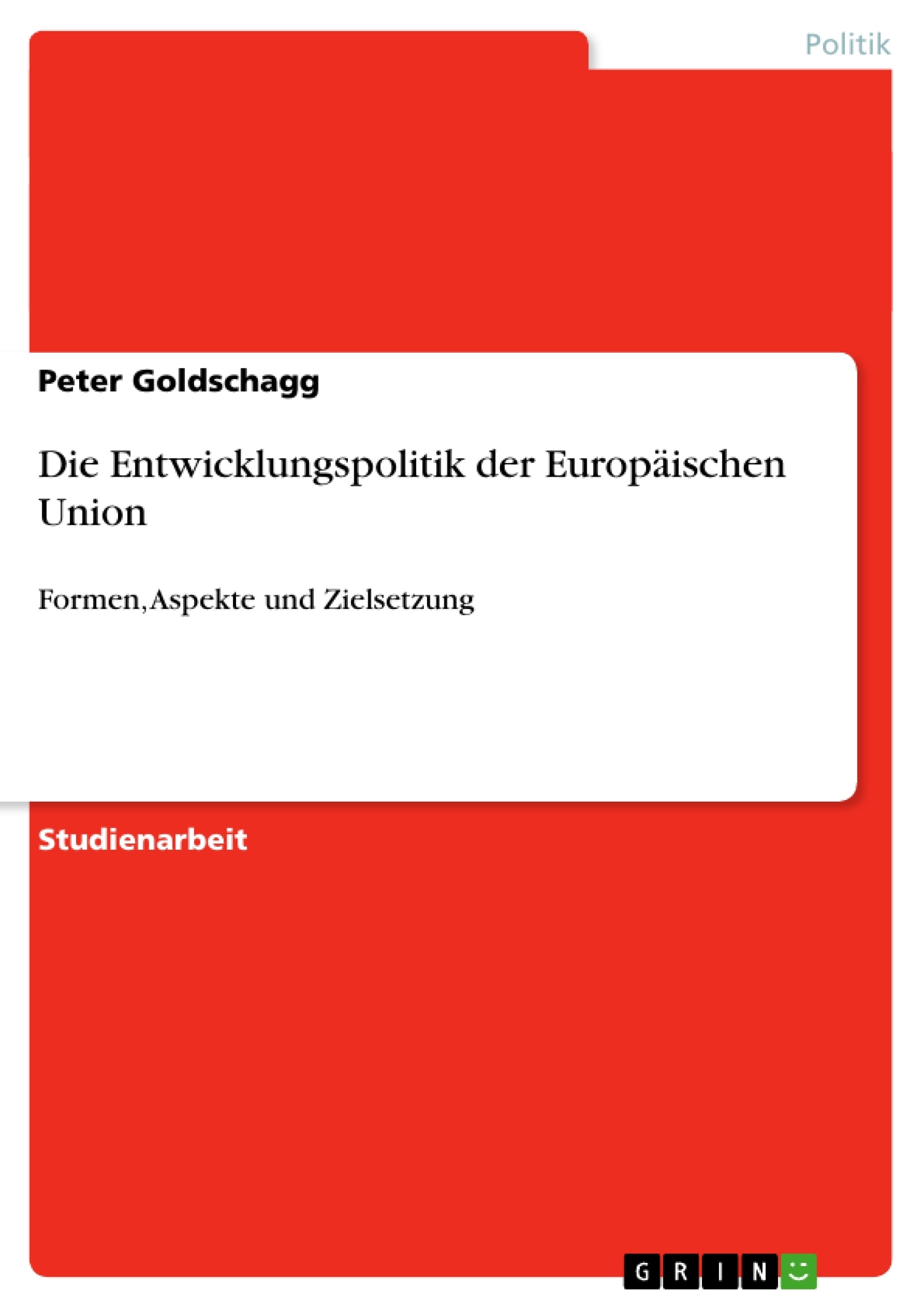Einleitung: Entwicklungspolitik auf dem Prüfstand
[...]
" Regieren besteht im Festsetzen von Prioritäten", erkannte schon Mitte des vergangenen Jahrhunderts der britische Premier Sir Harald Wilson. Und so bestimmten wichtige Wirtschaftsinteressen, geopolitische Einflusskalküle , innerstaatliche Kontroversen und nicht zuletzt bürokratische Eigeninteressen die Entwicklungspolitik stärker als die Suche nach globalen Lösungen zur Armuts- oder Migrations-, Terror- oder Umweltproblematik.
Es bleibt abzuwarten, ob sich die bisherigen Prioritäten durch die besagten Ereignisse in jüngster Vergangenheit nachhaltig geändert haben.
Probleme werden jedenfalls nicht gelöst, indem man sie ignoriert oder nur instrumentalisiert; eine triviale Tatsache, die Bundesaußenminister Joschka Fischer wenige Wochen nach den Anschlägen zu der treffenden, jedoch nicht minder trivialen Aussage veranlasste : " Wenn wir nicht zu den Problemen gehen, gehen die Probleme zu uns "
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Leitfrage dieser Arbeit soll folglich die Frage sein, inwieweit sich die auf globaler Bühne gerne als Zivilmacht präsentierende Europäische Union bisher bemüht " zu den Problemen zu gehen " - nicht nur im Eigeninteresse, sondern auch im Bewusstsein ihrer besonderen geschichtlichen Verantwortung gegenüber ihren ehemaligen Kolonien.
Nach einer ausführlichen Darstellung der aktuellen Volumen, Formen, Strukturen und Inhalte vergemeinschafteter europäischer Entwicklungszusammenarbeit, wird näher auf die Evolution ihrer entwicklungspolitischen Kernbeziehung eingegangen: die postkolonial bedingte AKP-Assoziierung. Einen besonderen Schwerpunkt soll in der Folge die Illustrierung und Bewertung des im Juni 2000 in Cotonou (Benin) abgeschlossenen Lomé- Folgeabkommens erfahren.
In einem abschließenden Kapitel wird die realpolitische Bilanz ihrer nunmehr 45 Jahre währenden Entwicklungspolitik diskutiert, im Vordergrund steht hierbei die entwicklungspolitische Bewertung der Gesamtauswirkungen der EU-Politiken auf die Entwicklungsländer dar.
INHALTSVERZEICHNIS
1. Einleitung
Entwicklungspolitik auf dem Prüfstand
2. Die Europäischen ODA-Leistungen im weltweiten Vergleich
3. Formen und Instrumente gemeinsamer europäischer Entwicklungspolitik
3.1 Entwicklungsprogramme des gemeinschaftlichen Haushalts
3.1.1 Regionale Kooperationsabkommen
3.1.2 Regional ungebundene Kooperationsabkommen
3.2 Das AKP-Assoziierungsabkommen
3.2.1 Die Assoziierungsabkommen im Wandel
3.2.2 Die Cotonou- Konvention
4. Anspruch und Wirklichkeit gemeinsamer europäischer Entwicklungspolitik
4.1 Bilanz der bisherigen AKP-Zusammenarbeit
4.2 Kohärenz und Zielkonflikte
5. Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Entwicklungspolitik auf dem Prüfstand
Die Ereignisse des Elften September 2001 haben in bisher noch nie da gewesenem Ausmaß den weltweiten entwicklungspolitischen Handlungsbedarf offensichtlich werden lassen. Die Reaktionen auf die Anschläge waren vielfältig, der entwicklungspolitische Grundtenor eher eindeutig: die alte Unterscheidung zwischen Außen- und Innenpolitik ist hinfällig geworden. Humanitäre Krisen oder Menschenrechtsverletzungen in irgendeinem Teil der Welt sind von nationalen Sicherheitskrisen in einem anderen Teil nicht mehr zu trennen.[1]
Beispielhaft wurde das neue Schlagwort der Weltinnenpolitik geprägt .
Diese Erkenntnis ist nicht neu, äußerte doch schon 1991 der Friedensforscher Dieter Senghaas, dass ohne Bestrebungen eines ökonomischen Ausgleichs internationaler Frieden nicht erreichbar ist. Er ergänzt somit die alte Feststellung von Willy Brandt, der schon 1980 in seinem Vorwort zum Bericht der Nord- Süd- Kommission prägnant formuliert hat, dass " dort wo Hunger herrscht, Friede nicht bestand haben [kann]"[2]. Die letzte Dekade des vergangenen Jahrhunderts gehörte zu den gewaltträchtigsten der Geschichte. Jedes Jahr wurden im Durchschnitt 25 bis 30 Kriege oder gewalttätige Krisen gezählt.[3] So vielfältig und komplex deren Ursachen auch sein mögen; ob es sich um soziale oder politische Spannungen, ethnische oder religiöse Differenzen, Autonomiebestrebungen, Flucht vor Umweltschäden oder Streit um Ressourcen handelt - stets kann der Kern der Notstände auch auf eine marginalisierte oder ineffektive Entwicklungspolitik zurückgeführt werden.[4]
Doch Entwicklungspolitik bewegt sich mit ihren zentralen Zielen der nachhaltigen wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung, der Demokratisierung und Justizialisierung sowie der weltwirtschaftlichen Integration der Entwicklungsländer in einem Umfeld äußerst vielfältiger und komplexer Interessen, die sich nicht widerspruchslos und ohne ökonomische Verlierer verwirklichen lassen.[5]
" Regieren besteht im Festsetzen von Prioritäten", erkannte schon Mitte des vergangenen Jahrhunderts der britische Premier Sir Harald Wilson. Und so bestimmten wichtige Wirtschaftsinteressen, geopolitische Einflusskalküle , innerstaatliche Kontroversen und nicht zuletzt bürokratische Eigeninteressen die Entwicklungspolitik stärker als die Suche nach globalen Lösungen zur Armuts- oder Migrations-, Terror- oder Umweltproblematik.[6]
Es bleibt abzuwarten, ob sich die bisherigen Prioritäten durch die besagten Ereignisse in jüngster Vergangenheit nachhaltig geändert haben.
Probleme werden jedenfalls nicht gelöst, indem man sie ignoriert oder nur instrumentalisiert; eine triviale Tatsache, die Bundesaußenminister Joschka Fischer wenige Wochen nach den Anschlägen zu der treffenden, jedoch nicht minder trivialen Aussage veranlasste : " Wenn wir nicht zu den Problemen gehen, gehen die Probleme zu uns "[7]
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Leitfrage dieser Arbeit soll folglich die Frage sein, inwieweit sich die auf globaler Bühne gerne als Zivilmacht präsentierende Europäische Union bisher bemüht " zu den Problemen zu gehen " - nicht nur im Eigeninteresse, sondern auch im Bewusstsein ihrer besonderen geschichtlichen Verantwortung gegenüber ihren ehemaligen Kolonien.
Nach einer ausführlichen Darstellung der aktuellen Volumen, Formen, Strukturen und Inhalte vergemeinschafteter europäischer Entwicklungszusammenarbeit, wird näher auf die Evolution ihrer entwicklungspolitischen Kernbeziehung eingegangen: die postkolonial bedingte AKP-Assoziierung. Einen besonderen Schwerpunkt soll in der Folge die Illustrierung und Bewertung des im Juni 2000 in Cotonou (Benin) abgeschlossenen Lomé- Folgeabkommens erfahren.
In einem abschließenden Kapitel wird die realpolitische Bilanz ihrer nunmehr 45 Jahre währenden Entwicklungspolitik diskutiert, im Vordergrund steht hierbei die entwicklungspolitische Bewertung der Gesamtauswirkungen der EU-Politiken auf die Entwicklungsländer dar.
2. Die europäischen ODA- Leistungenim weltweiten Vergleich
Die gesamteuropäischen[8] ODA-Leistungen, die sowohl nationalstaatlich verwaltete, als auch vergemeinschaftete Gelder umfassen, stellen mit 56 % mehr als die Hälfte der weltweiten Entwicklungshilfe.[9]
Die EU-Kommission ist mit über 9 % beteiligt - mit einem Finanzbudget von 4,88 Mrd. US$ im Jahr 2000 zählt sie somit zu den fünf größten OECD- Gebern. Obwohl die EU-Kommission ihren Anteil an der gesamteuropäischen Entwicklungshilfe seit 1970 schrittweise von 7% auf über 17 % steigern konnte[10] zeigt dieser doch vergleichsweise geringe Anteil, wie weit die Europäische Union - besonders in Bezug auf ihr Maastrichter Ziel einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik - noch von einer vergemeinschafteten Entwicklungspolitik entfernt ist.[11]
Dasselbe gilt für die 1970 von der UN-Vollversammlung verabschiedete Resolution 0,7% des BSP der Industrieländer für ODA-Leistungen aufzubringen.[12] Die Entwicklungshilfe ist seit Ende des Ost-West Konfliktes stark rückläufig, Nord- Süd Politik gerät zunehmend ins interessenpolitische Abseits; es fehlt, besonders in Afrika, das langjährige geostrategische Hauptinteresse: die Eindämmung des Kommunismus.[13] Ob die jüngsten Terrorerfahrungen die Prioritäten nachhaltig zugunsten voluminöserer Entwicklungshilfe geändert haben, bleibt abzuwarten.
Das Verhältnis der ODA-Auszahlungen zum Bruttosozialprodukt ist in den letzten Jahren jedenfalls stetig abgefallen, im Durchschnitt investieren die Mitgliedsstaaten der EU nur noch 0,32 % in Entwicklungshilfe, im ganzen OECD-Raum sind es sogar noch weniger: 0,27%[14]. Doch selbst in absoluten Zahlen sinken die weltweiten ODA- Leistungen, in der letzten Dekade um über 10 Prozent (von 60 Mrd. US$ 1992 auf 53,7 Mrd. US$ im Jahr 2000). Inflationsbereinigt ist der Verlust für die Empfängerländer noch weitaus größer. Auch der gesamteuropäische Anteil fiel in relativen, wie in absoluten Zahlen ab. Beliefen sich die aggregierten europäischen Entwicklungsetats 1993[15] mit 34,5 Mrd. US$ noch auf über 60 % der weltweiten ODA, so sank dieser Anteil im Jahr 2000 mit 30,3 Mrd. US$ auf 56 %. Nur der Etat der Europäischen Kommission konnte durch die anhaltenden Vergemeinschaftungstendenzen leicht gesteigert werden. Inflationsbereinigt nimmt jedoch auch er ab. Darüber hinaus ist der Zahlungsrückgang mit einer starken Umschichtung der Süd- zugunsten der Osthilfe verbunden.[16] Da ODA- Leistungen in Schwellenländern - besonders in Osteuropa - bessere ökonomische Renditen als in Low Income Countries[17] versprechen, nimmt deren Anteil an der EU- Entwicklungshilfe deutlich ab.
Gehörten 1985 noch 75% der Empfängerländer der Gruppe der LICs an, so waren es 1997 nur noch etwas mehr als die Hälfte (51%); im Jahr 2000 lag ihr proportionaler Anteil sogar nur noch bei 42% - ein historischer Tiefstand.[18]
3. Formen und Instrumente der EU-Entwicklungspolitik
Die Entwicklungszusammenarbeit der Europäischen Union lässt sich nach ihrer Finanzierungsquelle in zwei Hauptformen gliedern. Zum einen verwaltet sie den Europäischen Entwicklungsfonds (EEF), der sich aus den nationalen Beiträgen der Mitgliedsstaaten zusammensetzt und für die Finanzierung der Assoziierungsabkommen mit den AKP-Staaten[19] verantwortlich ist. Mit ihm wird die sogenannte Cotonou- Konvention durchgeführt, die als Lomé- Konvention lange Zeit den absoluten Kernpunkt der EU-Entwicklungszusammenarbeit gebildet hat und im nachfolgenden Kapitel 3.2 näher erläutert wird.
Alle weiteren entwicklungspolitischen Maßnahmen werden aus dem normalen EU- Haushalt finanziert. Ihr Kern umfasst eine Vielzahl an bi- und multilateralen Programmen zur regionalen wirtschaftlichen Stabilisierung in Lateinamerika und Asien, Nordafrika und Osteuropa. Unabhängig von diesen regionalen Kooperationsabkommen stellt die Kommission ferner sektorale oder thematische Kooperationsprogramme im Bereich der Aufklärung (Menschenrechte, Demokratie, Umwelt), der nachhaltigen Entwicklung, wie auch der humanitären Hilfe. Letztere umfasst neben der Nahrungsmittelhilfe das Büro für humanitäre Hilfe "ECHO", dass jedoch rein formal aus dem Entwicklungsetat ausgegliedert ist. Da diese Unterscheidung allerdings im Hinblick auf die Darstellung und Evaluierung der entwicklungspolitischen Leistungen der EU - besonders im (offiziellen) Kontext ihrer krisenpräventiven Zielsetzung - unzweckmäßig erscheint, wird ECHO im folgenden Abschnitt 3.1, zusammen mit den wichtigsten anderen Programmen kurz erläutert.
3.1. Entwicklungsprogramme des gemeinschaftlichen Haushalts
3.1.1 Regionale Kooperationsabkommen
Neben einer Vielzahl von finanzwirksamen regionalen Kooperations-abkommen konnten sich im Laufe der letzten Dekaden vier entwicklungspolitisch vergleichsweise voluminöse "Partnerships" außerhalb des Europäischen Entwicklungsfonds herauskristallisieren.
a) MEDA (Euro- Me diterr a nean Partnership)
Den Anfang machte die EU bereits 1972 mit der Unterzeichnung bilateraler Kooperationsabkommen mit den Drittstaaten des Mittelmeerraumes .[20] Kernpunkt der einzelnen Abkommen wurde neben der finanziellen, technischen und handelspolitischen Kooperation - die institutionelle und sozialpolitische Zusammenarbeit. Vor dem Hintergrund der damals akuten Algerienkrise spielte letztere besonders für die Maghrebstaaten und ihre einstige Kolonialmacht Frankreich eine große Rolle. Doch die anhaltende Angst vor dem Erstarken fundamentalistischer Bewegungen und den damit verbundenen Terrorgefahren, wie auch der stetig anwachsende Migrationsdruck machten Anfang der 1990er Jahre einen neue Programmatik notwendig[21]. Die bisherigen bilateral abgeschlossenen Abkommen erfuhren in der Folge einen weitreichenden paradigmatischen Wechsel, der seinen Ausdruck in der "New Mediterranean Policy " findet.
Einerseits sollen Freihandelsabkommen für Industriegüter und das Ziel der Schaffung einer umfassenden Freihandelszone bis zum Jahr 2010 die bisherigen Wirtschaftsbeziehungen stimulieren, andererseits sollen mit EU-Mitteln geförderte NGOs[22] die Kooperation und regionale Integration zwischen den entsprechenden Staaten weit stärker als bisher forcieren.
Die finanziellen Mittel von jährlich 940 Mio. €[23] entfallen darüber hinaus noch auf öko- und agrarwirtschaftliche Projekte, Bildungs- und
Forschungskooperationen sowie auf weitreichende Zuschüsse zur Investitionsförderung.
[...]
[1] UNO- Generalsekretär Kofi Annan anlässlich seiner Nobelpreisrede am 10. Dezember 2001 in Oslo
[2] zitiert aus der Rede der Bundesentwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul anlässlich des 40 jährigen Jubiläums des
Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) am 7. November 2001 in Bonn
[3] Vgl. Konflikte und Krisenprävention in: Globale Trends 2000 S. 421
[4] Vgl. Entwicklungspolitik als Friedenspolitik in: Friedensgutachten 2000, Hrsg. Ulrich Ratsch, Reinhard Mutz, Bruno Schoch S.13
[5] Vgl. Stefan Brüne, Europas Entwicklungspolitiken in: Aus Politik und Zeitgeschichte 45 (1995) 29, S.35
[6] Vgl. Franz Nuscheler: Internationale Migration. Flucht und Asyl, Opladen (1995) S.262
[7] Bundesaußenminister Joschka Fischer in seiner Rede zum Bundeswehreinsatz in Afghanistan am 8. November 2001 im deutschen Bundestag
[8] Zur ODA (Official Development Aid) zählen sämtliche öffentliche Leistungen, die den Entwicklungsländern zur Unterstützung ihrer
ökonomischen Entwicklung und Wohlfahrt zu grundsätzlich vergünstigten Bedingungen ( bei Darlehen und Krediten mit einem
Zuschusselement von mindestens 25 Prozent) zur Verfügung gestellt werden. [ Definition des Development Assistance Committee der OECD]
[9] Alle unter Punkt 2 "Umfang und Entwicklung der europäischen ODA-Leistungen im weltweiten Vergleich" angeführten statistischen Werte
entstammen - soweit nicht anders aufgeführt - der aktuellsten (Daten von 2000) online verfügbaren Statistik der OECD [URL: www.oecd.org]
[10] Vgl. DIE Publikationen 3/1999: Ein neuer Anlauf zu einer europäischen Entwicklungszusammenarbeit
[11] Vgl. Nuscheler, Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1995, S. 471
[12] Vgl. Nuscheler, Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 1995, S. 44
[13] Vgl. Nuscheler: Wandlungen im Nord-Süd- Verhältnis Jahrbuch Internationale Politik 1994 S.183
[14] Quelle: Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in seiner Statistik zur ODA aller DAC-Länder
[15] gemeint ist in diesem Fall die gesamteuropäische ODA; ist nur die Kommission betroffen wird von ( vergemeinschafteter) EU-ODA
gesprochen, bezieht sich der Kontext nur auf ihre Mitgliedsstaaten werden explizit nur die ODA-Leistungen der EU-Mitgliedsstaaten zitiert.
[16] Vgl. van Reisen: Global Player EU - Die Nord-Süd Politik der Europäischen Union, Bonn 1999 S. 12
[17] Zu den Low Income Countries (LIC) gehören nach Definition der Weltbank alle Länder mit einem BSP/Kopf unter 500 US$ im Jahr
[18] Vgl. Statistik der OECD 2000
[19] Die AKP-Staaten umfassen mittlerweile 77 Staaten in A frika, der K aribik und im P azifik
[20] Vgl. Onlinepräsentation der EU zu MEDA [URL http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/conf/marseilles/info]
[21] Vgl. Nuscheler Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik S.472
[22] N on G overnmental O rganizations sind Nichtregierungsorganisationen (bspw. Greenpeace oder Amnesty International)
[23] Quelle: Österreichische Wirtschaftskammern in ihrem Bericht zu EU-Förderprogrammen [ URL: http://aw.wk.or.at/awo/thema/foerderung ]
- Citar trabajo
- Peter Goldschagg (Autor), 2002, Die Entwicklungspolitik der Europäischen Union, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5003