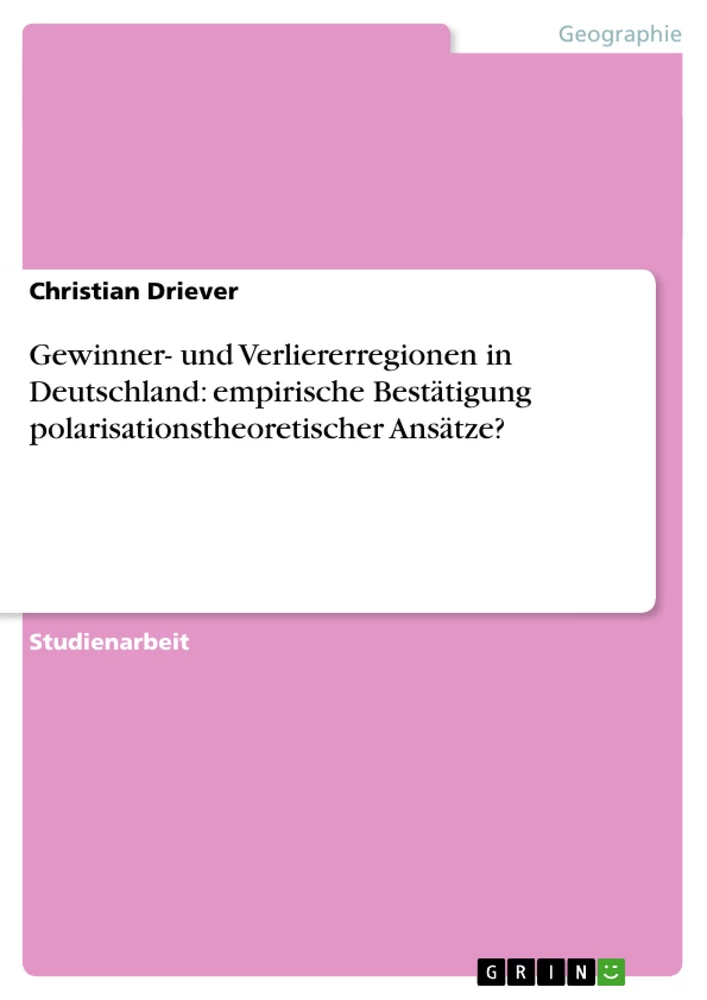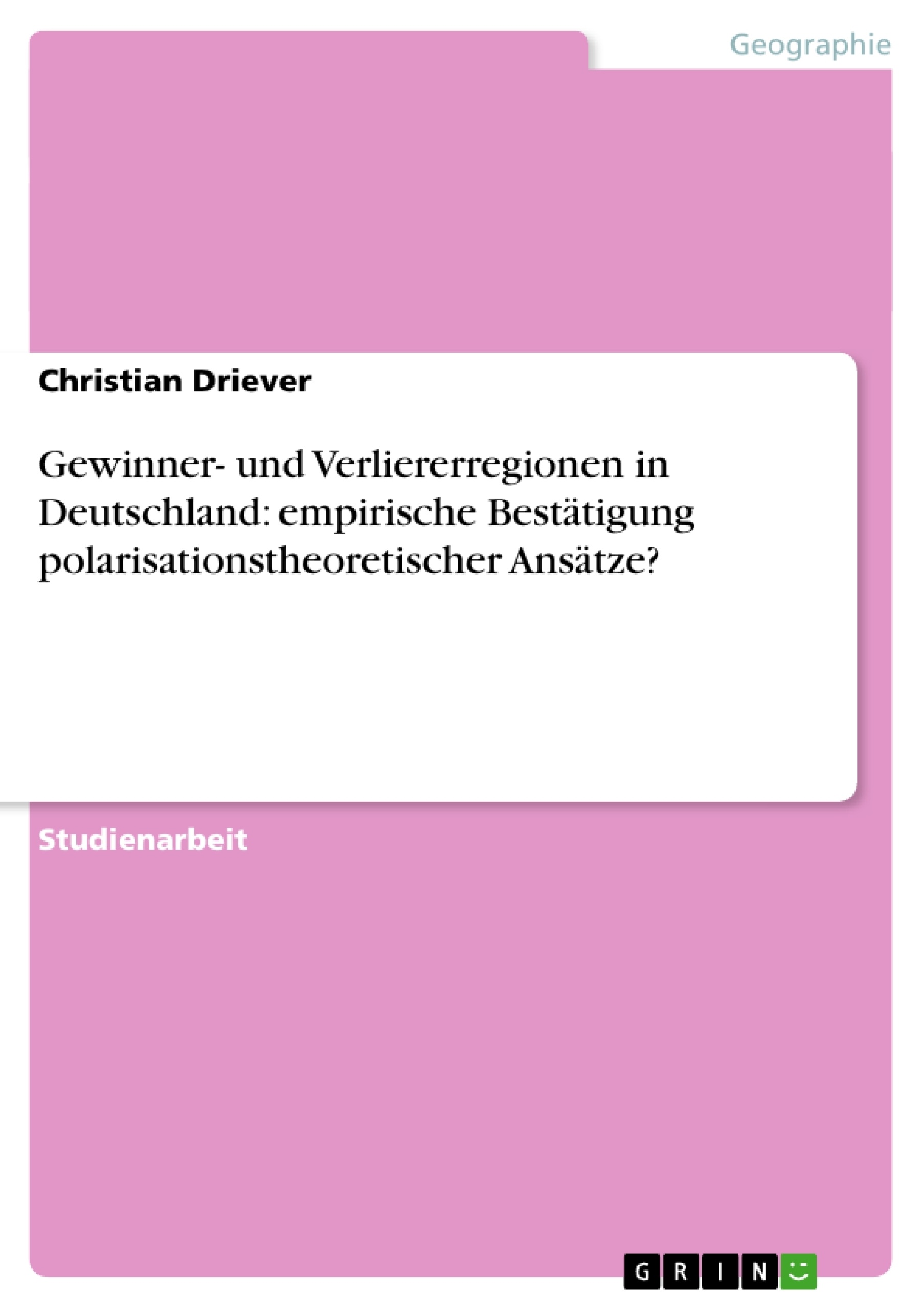In der vorliegenden Arbeit soll die Polarisationstheorie der Wirtschaftsgeographie dargestellt werden und anhand von praktischen Beispielen überprüft werden, ob in der Theorie geschilderte Phänomene und Tendenzen in Gewinner- und Verliererregionen in Deutschland zu erkennen sind.
Die Polarisationstheorie wird dabei zunächst in den wissenschaftlichen Kontext raumwirtschaftlicher Theorien eingeordnet um ihren Ansatz zu verdeutlichen. Im anschließenden Kapitel soll die Theorie ausführlich erläutert und mit Musterbeispielen dargestellt werden. Im Anschluss daran folgt eine Kritik der Theorie.
In den dann folgenden Kapiteln werden je eine Gewinner- und eine Verliererregion aus Deutschland im Hinblick darauf untersucht, was diese Regionen zu Gewinnern bzw. Verlieren macht und ob sich eine Entwicklung im Sinne der Polarisationstheorie abgespielt hat. Im abschließenden Kapitel sollen die Ergebnisse der Arbeit noch einmal kurz zusammengefasst und bewertet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ansatz der Polarisationstheorie
- Polarisationstheorie
- Sektorale Polarisation
- Regionale Polarisation
- Kritik
- Weiterentwickelte polarisationstheoretische Ansätze
- Wachstumspolkonzepte
- Zentrum-Peripherie-Modelle
- Gewinnerregion Regensburg
- Neuere Geschichte
- Technologiestandort Regensburg
- Infrastruktur und Wirtschaftskraft
- Verliererregion Flensburg
- Einleitung
- Ursachen der negativen Entwicklung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Polarisationstheorie der Wirtschaftsgeographie und untersucht anhand praktischer Beispiele, ob die in der Theorie beschriebenen Phänomene und Tendenzen in Gewinner- und Verliererregionen in Deutschland zu erkennen sind.
- Einordnung der Polarisationstheorie in den wissenschaftlichen Kontext raumwirtschaftlicher Theorien
- Ausführliche Erläuterung der Theorie und Darstellung mit Musterbeispielen
- Kritik der Polarisationstheorie
- Analyse einer Gewinner- und einer Verliererregion in Deutschland
- Bewertung der Ergebnisse im Hinblick auf die Polarisationstheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Arbeit stellt die Polarisationstheorie im wissenschaftlichen Kontext raumwirtschaftlicher Theorien vor und verdeutlicht ihren Ansatz. Anschließend wird die Theorie ausführlich erläutert und mit Musterbeispielen dargestellt. Im Anschluss erfolgt eine Kritik der Theorie. Die Arbeit untersucht dann eine Gewinner- und eine Verliererregion in Deutschland im Hinblick auf ihre Entwicklung und ob sich eine Entwicklung im Sinne der Polarisationstheorie abgespielt hat.
2. Polarisationstheorie
2.1 Sektorale Polarisation
Die sektorale Polarisation basiert auf Überlegungen Schumpeters, der eine wellenförmige Entwicklung der Wirtschaft durch Innovationen beschreibt. Perroux entwickelte die Theorie weiter und identifizierte "motorische Einheiten", wie die Automobilindustrie und Petrochemie, die als Träger wirtschaftlichen Wachstums dienen und zu einer sektoralen Polarisation führen.
2.2 Regionale Polarisation
Myrdal entwickelte die Polarisationshypothese, die einen räumlichen Bezug hat. Er erklärt die zirkuläre Verursachung eines kumulativen sozioökonomischen Prozesses, der zu wirtschaftlicher Entwicklung und Unterentwicklung führt. Dieser Prozess führt zu räumlicher Differenzierung in Wachstumszentren und zurückgebliebenen Regionen.
3. Gewinnerregion Regensburg
Das Kapitel beleuchtet die neuere Geschichte, den Technologiestandort Regensburg und die Infrastruktur und Wirtschaftskraft der Region. Die Analyse soll zeigen, welche Faktoren Regensburg zu einer Gewinnerregion gemacht haben.
4. Verliererregion Flensburg
Das Kapitel befasst sich mit den Ursachen der negativen Entwicklung in Flensburg und untersucht, ob sich eine Entwicklung im Sinne der Polarisationstheorie abgespielt hat.
Schlüsselwörter
Polarisationstheorie, Wirtschaftsgeographie, Raumwirtschaft, Sektorale Polarisation, Regionale Polarisation, Gewinnerregionen, Verliererregionen, Deutschland, Schumpeter, Perroux, Myrdal, Wachstumspolkonzepte, Zentrum-Peripherie-Modelle, Entzugseffekte, Ausbreitungseffekte, mobile Produktionsfaktoren, Arbeitskräfte, Kapital, technischer Fortschritt, Handel, interregionale Interaktion.
- Quote paper
- Christian Driever (Author), 2005, Gewinner- und Verliererregionen in Deutschland: empirische Bestätigung polarisationstheoretischer Ansätze?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49971