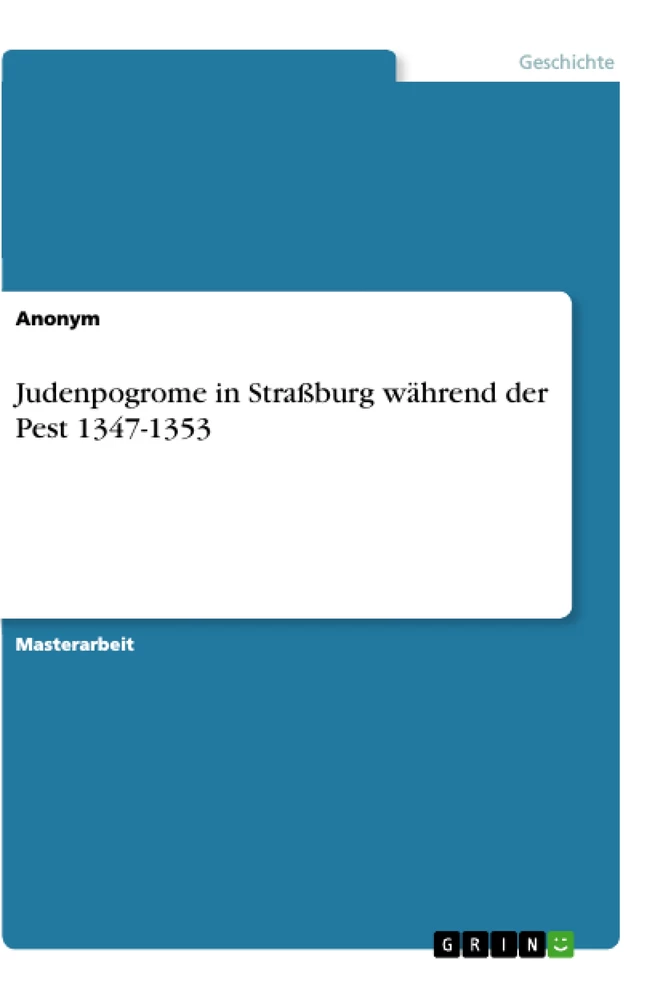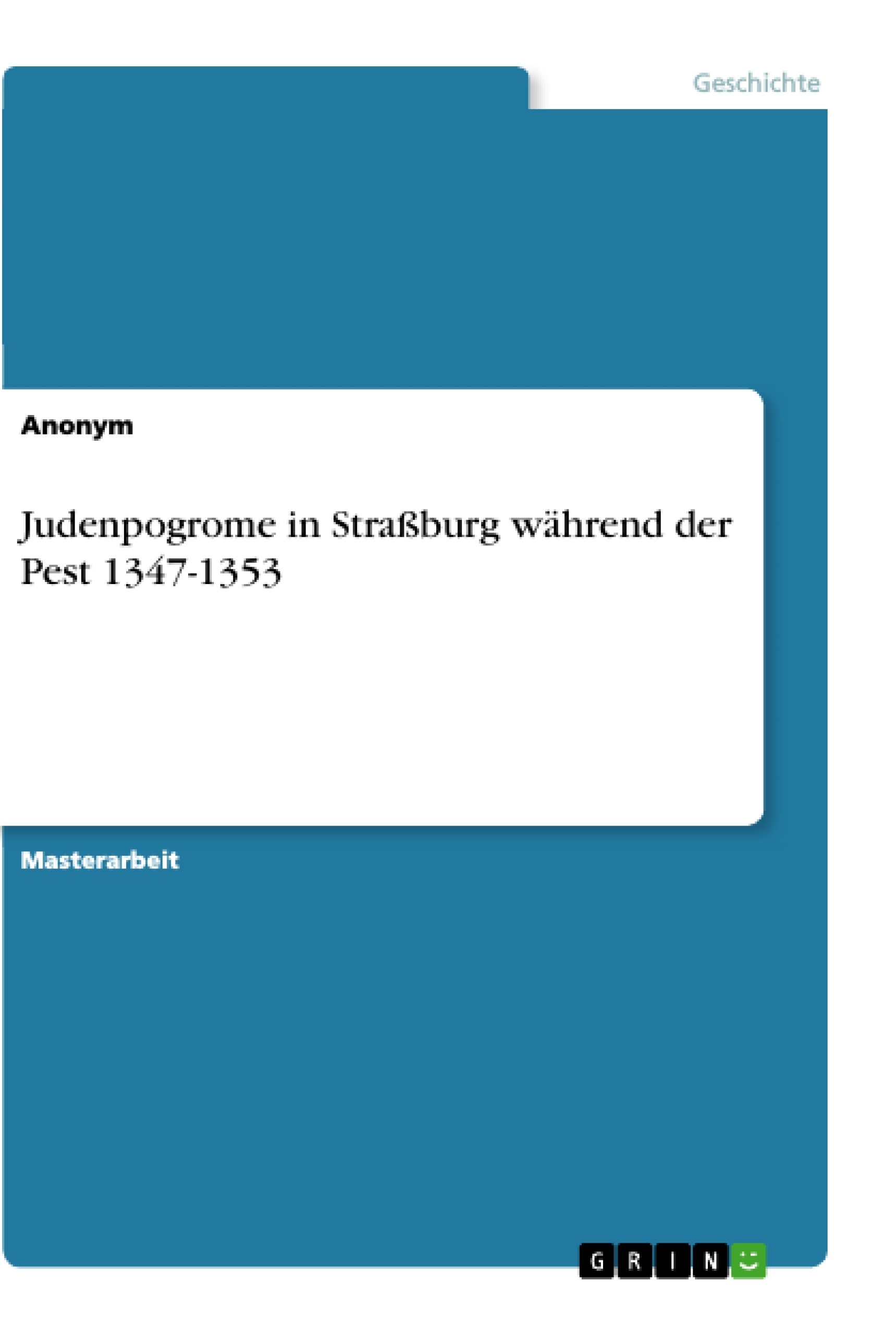In der vorliegenden Arbeit soll nun konkret der den sozialgeschichtlichen Bereich betreffenden Fragestellung nachgegangen werden, ob die Pest von 1347 bis 1353 Auslöser des Judenpogroms zu Straßburg war oder ob diese einen bloßen Vorwand darstellte. Dabei ergibt sich die Relevanz der exemplarischen Betrachtung Straßburgs im Hinblick auf die vorangestellte Fragestellung bereits aus der Tatsache, dass die elsässische Metropole alle anderen Siedlungen der Region an Größe und Differenzierung überragte, was sich auch auf die dortige Judengemeinde bezog. Denn Straßburg gehörte durch seine Lage am Rhein zu den wichtigsten Handelsmetropolen des Spätmittelalters, war führend im Weinhandel und bildete ein lokales Zentrum der Tuchproduktion, was zu Ruhm und Reichtum geführt hatte.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- II Zwischen Akzeptanz und Ablehnung – gesellschaftlich religiöse Wahrnehmung von Juden im Mittelalter bis zum Jahre 1349 unter besonderer Berücksichtigung der Stadt Straßburg
- II.1 Jüdisches Leben im christlich geprägten Umfeld des Mittelalters
- II.1.1 Die rechtlich-soziale Stellung der Juden in Straßburg vor 1349
- II.1.1.1 Viertes Laterankonzil von 1215
- II.1.1.2 Der Schutzbrief Karls IV. von 1347
- II.1.2 Die wirtschaftliche Bedeutung der Juden für die Stadt Straßburg
- II.2 Mittelalterliche Judenfeindschaft
- II.2.1 Klerikale Begründungen von mittelalterlicher Judenfeindschaft
- II.2.1.1 Die Juden als Gottesmörder
- II.2.1.2 Die Juden als Ritualmörder
- II.2.1.3 Die Juden als Hostienschänder
- II.2.2 Weltliche und klerikale Begründungen mittelalterlicher Judenfeindschaft
- II.2.2.1 Die Juden als „Wucherer“
- II.2.2.2 Die Juden als Brunnenvergifter zur Zeit der Pest von 1348-1353
- II.2.2.2.1 Das Motiv der Brunnenvergiftung erreicht Straßburg
- II.2.2.2.2 Die Juden als „Sündenbock“ – Phänomen des Sündenbocks
- III Der Judenpogrom von 1349 in der Stadt Straßburg
- III.1 Politische und gesellschaftliche Unruhen in Straßburg im Vorfeld des Judenpogroms im Jahre 1349
- III.2 Die Realisierung des Judenpogroms zu Straßburg 1349
- III.3 Das Resultat des Judenpogroms zu Straßburg im Jahre 1349
- III.3.1 Die Sicherung des Judenerbes und die Reaktion von König Karl IV.
- III.3.2 Effekte des Straßburger Judenpogroms
- III.4 Wiederansiedlung der Juden in Straßburg nach dem Pogrom
- IV Eintreffen und Ausbruch der Pest in Straßburg im Jahre 1349
- V Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Judenpogrome in Straßburg während der Pest von 1347-1353. Die Arbeit zielt darauf ab, die sozialen, religiösen und politischen Faktoren zu analysieren, die zu den Pogromen führten, sowie deren Auswirkungen auf die jüdische Gemeinde und die Stadt Straßburg zu beleuchten.
- Die rechtliche und soziale Stellung der Juden in Straßburg vor 1349.
- Die Rolle der mittelalterlichen Judenfeindschaft und ihre klerikalen und weltlichen Begründungen.
- Der Ablauf und die Ursachen des Judenpogroms von 1349 in Straßburg.
- Die Folgen des Pogroms für die jüdische Gemeinde und die Stadt.
- Die Wiederansiedlung der Juden in Straßburg nach dem Pogrom.
Zusammenfassung der Kapitel
I Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und beschreibt den Kontext der Judenpogrome in Straßburg während der Pest von 1347-1353 anhand von Auszügen aus den Chroniken von Fritsche Closener und Jacob Twinger von Königshofen. Sie hebt die Bedeutung dieser Quellen für das Verständnis des Geschehens hervor und betont die Perspektive der Chronisten.
II Zwischen Akzeptanz und Ablehnung – gesellschaftlich religiöse Wahrnehmung von Juden im Mittelalter bis zum Jahre 1349 unter besonderer Berücksichtigung der Stadt Straßburg: Dieses Kapitel analysiert die komplexe Beziehung zwischen der jüdischen und der christlichen Bevölkerung in Straßburg vor dem Pogrom. Es beleuchtet die rechtliche und soziale Stellung der Juden, ihre wirtschaftliche Bedeutung für die Stadt und die sich entwickelnde Judenfeindschaft, die durch klerikale und weltliche Argumente genährt wurde, einschließlich der Anschuldigungen der Gottesmord, Ritualmord und Hostienschändung. Die zunehmende Verfolgung der Juden im Kontext der Pest wird prägnant dargestellt, mit dem Fokus auf die Verbreitung von Gerüchten über Brunnenvergiftung und die Juden als Sündenböcke.
III Der Judenpogrom von 1349 in der Stadt Straßburg: Dieses Kapitel beschreibt detailliert den Verlauf des Judenpogroms im Jahr 1349. Es untersucht die politischen und gesellschaftlichen Unruhen, die zum Pogrom führten, und analysiert die konkrete Umsetzung der Gewalt gegen die jüdische Bevölkerung. Weiterhin werden die Folgen des Pogroms in Bezug auf die Sicherung des Judenerbes und die Reaktion König Karls IV. sowie die langfristigen Auswirkungen auf die Stadt Straßburg untersucht. Die Wiederansiedlung der Juden nach dem Pogrom wird ebenfalls in diesem Kapitel betrachtet.
IV Eintreffen und Ausbruch der Pest in Straßburg im Jahre 1349: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Ausbruch der Pest in Straßburg im Jahr 1349 und ihre Auswirkungen auf die Bevölkerung. Die Schilderungen der Chronisten werden analysiert und in den Kontext des damaligen gesellschaftlichen und medizinischen Wissens eingeordnet. Die Darstellung der Pest bildet den Hintergrund für das Verständnis der Pogrome.
Schlüsselwörter
Judenpogrome, Straßburg, Pest, Mittelalter, Judenfeindschaft, Klerikalismus, Weltliche Herrschaft, König Karl IV., Brunnenvergiftung, Sündenbock, Fritsche Closener, Jacob Twinger von Königshofen, Rechtliche Stellung der Juden, Wirtschaftliche Bedeutung der Juden.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Masterarbeit: "Zwischen Akzeptanz und Ablehnung – gesellschaftlich religiöse Wahrnehmung von Juden im Mittelalter bis zum Jahre 1349 unter besonderer Berücksichtigung der Stadt Straßburg"
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Judenpogrome in Straßburg während der Pest von 1347-1353. Sie analysiert die sozialen, religiösen und politischen Faktoren, die zu den Pogromen führten, und beleuchtet deren Auswirkungen auf die jüdische Gemeinde und die Stadt Straßburg.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit stützt sich unter anderem auf Auszüge aus den Chroniken von Fritsche Closener und Jacob Twinger von Königshofen. Die Bedeutung dieser Quellen für das Verständnis des Geschehens wird hervorgehoben.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, die gesellschaftlich-religiöse Wahrnehmung von Juden in Straßburg bis 1349, der Judenpogrom von 1349, der Ausbruch der Pest in Straßburg 1349 und ein Fazit. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Themas, beginnend mit der rechtlichen und sozialen Stellung der Juden in Straßburg vor dem Pogrom und endend mit den langfristigen Folgen des Pogroms.
Welche Aspekte der rechtlichen und sozialen Stellung der Juden in Straßburg werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die rechtlich-soziale Stellung der Juden vor 1349, einschließlich des Einflusses des Vierten Laterankonzils von 1215 und des Schutzbriefs Karls IV. von 1347. Die wirtschaftliche Bedeutung der Juden für die Stadt wird ebenfalls analysiert.
Welche Rolle spielt die mittelalterliche Judenfeindschaft in der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die mittelalterliche Judenfeindschaft und deren klerikale und weltliche Begründungen, wie z.B. die Anschuldigungen des Gottesmords, Ritualmords und der Hostienschändung. Die Verbreitung von Gerüchten über Brunnenvergiftung und die Juden als Sündenböcke im Kontext der Pest wird ebenfalls betrachtet.
Wie wird der Judenpogrom von 1349 in Straßburg dargestellt?
Das Kapitel zum Pogrom von 1349 beschreibt detailliert den Verlauf, die politischen und gesellschaftlichen Unruhen, die ihn verursachten, und die konkrete Umsetzung der Gewalt gegen die jüdische Bevölkerung. Die Folgen des Pogroms, die Sicherung des Judenerbes, die Reaktion König Karls IV. und die langfristigen Auswirkungen auf die Stadt werden analysiert. Die Wiederansiedlung der Juden nach dem Pogrom wird ebenfalls behandelt.
Welche Bedeutung hat der Ausbruch der Pest im Jahr 1349?
Der Ausbruch der Pest in Straßburg und ihre Auswirkungen auf die Bevölkerung werden im Kontext des damaligen gesellschaftlichen und medizinischen Wissens analysiert. Die Schilderungen der Chronisten werden eingeordnet und bilden den Hintergrund für das Verständnis der Pogrome.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Judenpogrome, Straßburg, Pest, Mittelalter, Judenfeindschaft, Klerikalismus, Weltliche Herrschaft, König Karl IV., Brunnenvergiftung, Sündenbock, Fritsche Closener, Jacob Twinger von Königshofen, Rechtliche Stellung der Juden, Wirtschaftliche Bedeutung der Juden.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2017, Judenpogrome in Straßburg während der Pest 1347-1353, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/498912