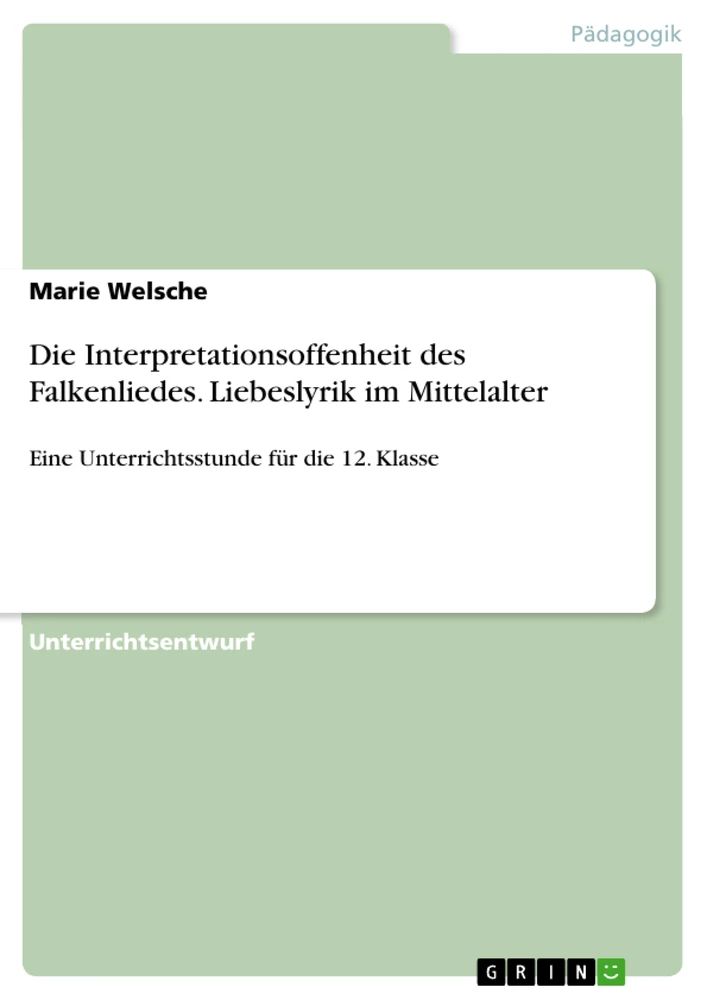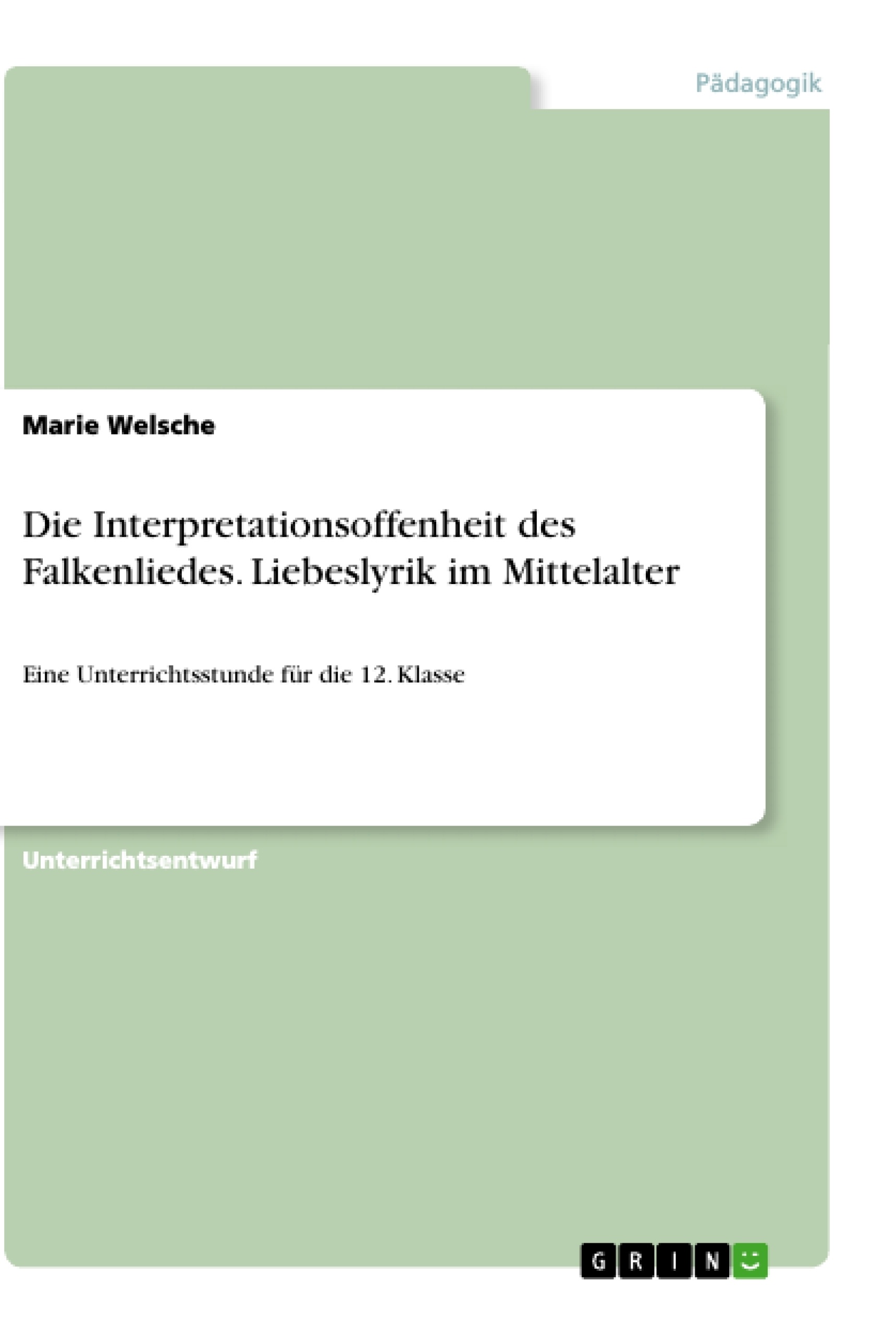Diese Arbeit stellt einen Unterrichtsentwurf für den Leistungskurs einer 12. Klasse zur Interpretation des Falkenliedes vor. Nach Ende der Stunde sollen die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass das Falkenlied keine eindeutige Interpretation zulässt, was das lyrische Ich, den Falken, seinen Auszug sowie den letzten Vers betrifft. Ein weiteres Ziel der Unterrichtsstunde besteht darin, dass die Kinder erkennen, wie wichtig es ist, sich unabhängig von vorliegenden Meinungen eine eigene zu bilden.
Im Lehrplan der Sekundarstufe II steht das Mittelalter mit den Textformen Epik und Lyrik. So kann aufgrund des Textes eine Reflexion über Sprache vertieft werden. Die Andersartigkeit der eigenen Sprache durch die Historie kann für die Selbstentwicklung der Schüler förderlich sein und sie zu einer genaueren Auseinandersetzung mit der Muttersprache anregen und für den Umgang mit ihr sensibilisieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einbettung in die Unterrichtsreihe
- Sprachwandel am Beispiel: Dû bist mîn
- Interpretation von Dû bist mîn
- Mittelhochdeutsch übersetzen und vortragen: Albrecht von Johansdorf: Ich vant sî âne houte
- Standbilder zur Beziehung der Sprechenden: Ich vant si âne houte:
- Verzichtliebe statt Happy End: Ich vant si âne houte
- Fiktion und Realität: Frauenverehrung vs. Frauenverachtung: Alles Liebe (faz)
- Die Interpretationsoffenheit des Falkenlieds: Ich zoch mir einen valken
- Mündlich tradierte Lieder: Ich zoch mir einen valken
- Erfüllte Liebe: Walther von der Vogelweide: Unter der Linde
- Naturdarstellung und Motive: Unter der Linde
- Hohe Minne- niedere Minne: Hartmann von Aue Maniger grüezet mich alsô
- Maniger grüezet mich alsô: Kritik an hoher Minne
- Vergleich der Lieder zueinander: Unterschiede und Gemeinsamkeiten
- Vergleich mit aktuellem Liebeslied: Namika Lieblingsmensch
- Abschlussdiskussion und Reflexion
- Kompetenzen / Lernziele
- Geplanter Unterrichtsverlauf
- Sachanalyse
- Didaktische Analyse
- Methodische Entscheidungen
- Literatur
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Unterrichtsbesuch befasst sich mit der Interpretationsoffenheit des Falkenlieds und zielt darauf ab, den Schülerinnen und Schülern die Vielschichtigkeit und Ambivalenz dieses mittelalterlichen Liedes aufzuzeigen. Dabei soll ihnen die Fähigkeit vermittelt werden, unterschiedliche Deutungsansätze zu erkennen und selbstständig zu interpretieren.
- Die Interpretationsvielfalt des Falkenlieds
- Die Bedeutung des Falken als Symbol
- Die Rolle des lyrischen Ichs
- Die Bedeutung des Schlussverses
- Die Einordnung des Falkenlieds in den Kontext des Minnesangs
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Unterrichtseinheit behandelt das Falkenlied im Detail. Die Schülerinnen und Schüler werden mit den verschiedenen Interpretationen vertraut gemacht, die sich aufgrund der offenen Struktur und der Mehrdeutigkeit des Textes ergeben. Dabei wird insbesondere der Schlussvers beleuchtet, der unterschiedliche Auslegungen zulässt.
Die zweite Phase des Unterrichts fokussiert auf die unterschiedlichen Interpretationen des Falkenlieds, die durch den Vergleich mit dem Budapester Fragment noch verstärkt werden. Die Schüler erarbeiten und diskutieren verschiedene Deutungsansätze und lernen, wie die Mehrdeutigkeit des Textes verschiedene Sichtweisen ermöglicht.
Der dritte Teil der Einheit setzt sich mit der Bedeutung des Falkenlieds im Kontext des Minnesangs auseinander. Hier werden die Besonderheiten des Liedes, wie seine Struktur und Form, sowie die Rolle des lyrischen Ichs und die Interpretation von Motiven wie Liebe, Verlust und Freiheit diskutiert.
Schlüsselwörter
Das Falkenlied, Minnesang, Interpretationsoffenheit, Mehrdeutigkeit, lyrisches Ich, Falke, Symbol, Deutungsansätze, Budapester Fragment, Hohe Minne, Schlussvers, Liebe, Verlust, Freiheit, mittelalterliche Lyrik
- Citar trabajo
- Marie Welsche (Autor), 2016, Die Interpretationsoffenheit des Falkenliedes. Liebeslyrik im Mittelalter, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/498485