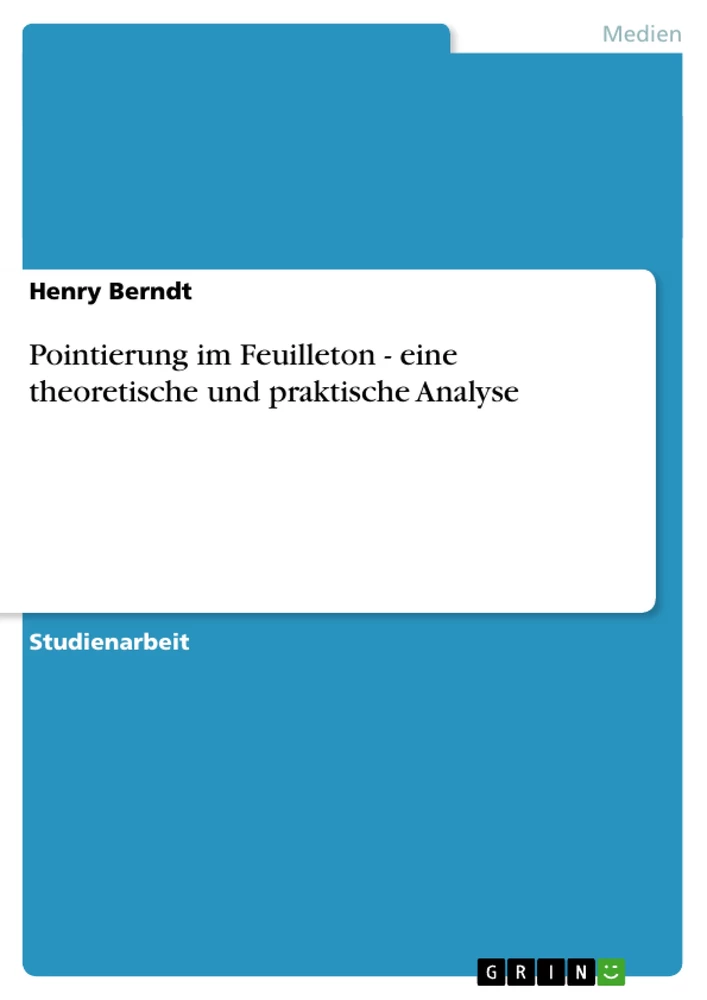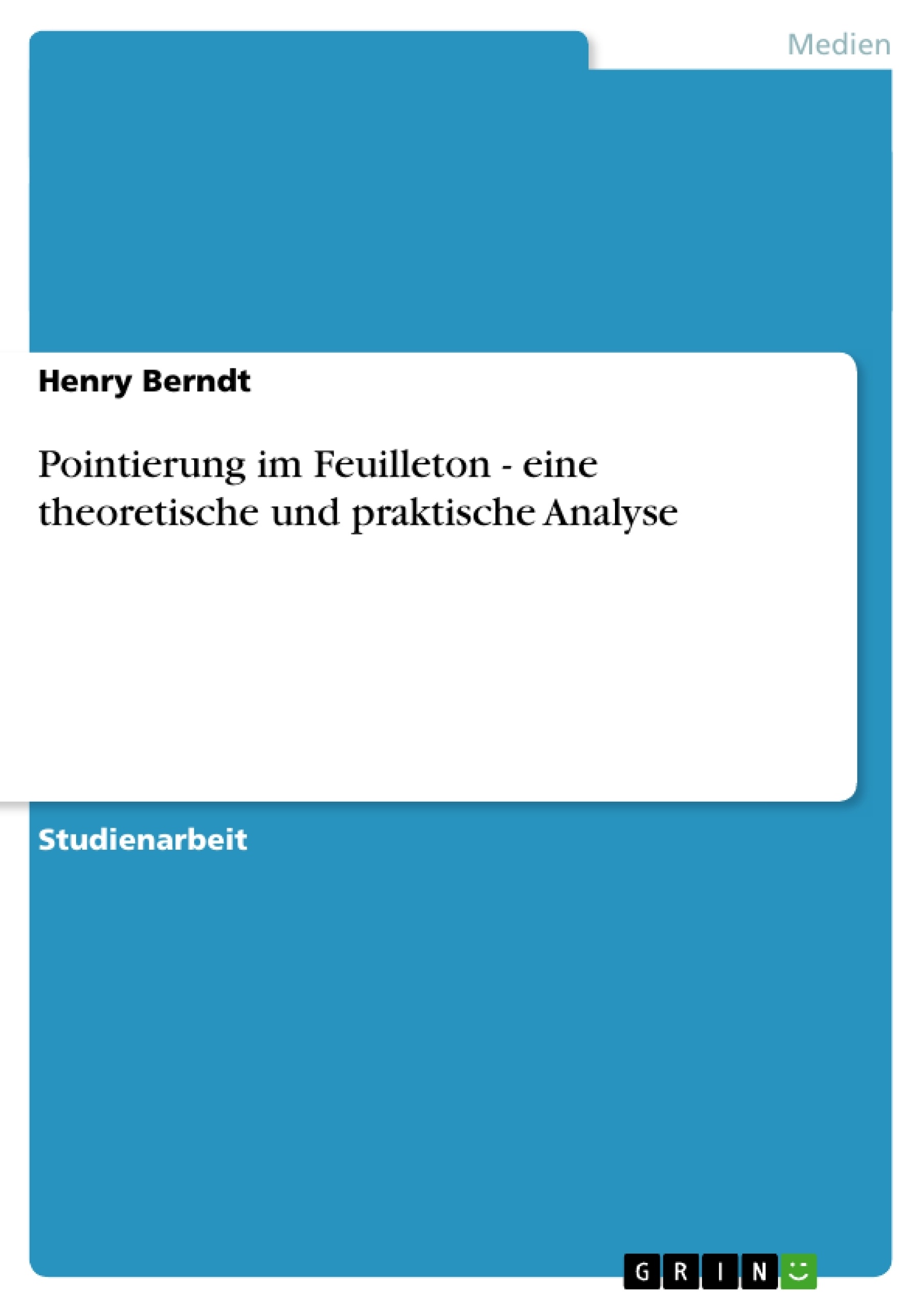„Lieber mach’ ich mir einen Feind, als daß ich auf eine Pointe verzichte“, sagte einst der irische Lyriker und Dramatiker Oscar Wilde. Für viele belletristische und subjektiv journalistische Texte sind Pointen das Salz in der Suppe. Mit ihnen steht und fällt oftmals die Relevanz für den Leser, die Spannung und nicht zuletzt auch die Aussagekraft des gesamten Textes. In der wissenschaftlichen Literatur jedoch muss man schon sehr gründlich suchen, um Analysen und Definitionen zum Phänomen „Pointe“ zu finden. Ihre bis heute erst ansatzweise begonnene wissenschaftliche Aufarbeitung wird ihrem hohen Stellenwert in der literarischen und journalistischen Realität nicht gerecht. Auch Wenzel konstatiert ein „Theoriedefizit der Erzählsschlußanalayse“ (Wenzel 1989, 10).
Nicht viel weiter unten in der Hitliste der am meisten vernachlässigten medienwissenschaftlichen Themen folgt die journalistische Darstellungsform Feuilleton. Die heute als oft Standardliteratur herangezogenen Werke stammen fast ausschließlich aus den Sechziger und Siebziger Jahren, einer Zeit, in der diese Textgattung zugegeben auch einen entsprechend höheren Stellenwert hatte. Aktuelle Abhandlungen zum Feuilleton lassen sich in den Buchhandlungen und Bibliotheken ähnlich schwer finden, wie zur Pointe. So bleibt das Feuilleton in dem Standardwerk „Einführung in den praktischen Journalismus“ von Walther von La Roche gänzlich unerwähnt. An anderen Stellen in der Literatur taucht es zumindest als Stichwort auf, einige Werke widmen ihm vielleicht gar ein Kapitel – doch die wissenschaftlichen Standard-Definitionen und Analysen sind zum größten Teil älter als vierzig Jahre. So stellt Kauffmann fest: „Die Feuilletonfor- schung ist niemals zum dem geplanten Großunternehmen geworden, das ebenso systematisch wie interdisziplinär hätten arbeiten sollen und müssen. […] Lehrer wie Emil Dovivat, Wilmont Haacke […] sind ohne Nachfolger geblieben“ (Kauffmann 2000, 11). Dieser Umstand muss andererseits aber auch als Zeichen dafür gewertet werden, dass die Aussagen vergangener Jahre bis heute Gültigkeit beanspruchen dürfen.
Was nun aber geschieht, wenn man die Themen „Pointe“ und „Feuilleton“ in einem Hausarbeitsthema kombiniert, liegt leider auf der Hand: Wenige und alte wissenschaftliche Quellen lassen die Beschäftigung mit der „Pointierung im Feuilleton“ zu einem gewagten Experiment mit ungewissem Ausgang werden; eine Tatsache, aus der dieses Experiment aber auch seinen Reiz bezieht. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffdefinitionen
- Feuilleton
- Pointe
- Die Pointe im Feuilleton
- Der pointierte Schreibstil
- Die Schlusspointe im Feuilleton
- Unterschiede zur Pointierung in anderen Textsorten
- Befreiung von der Zwangsjacke - der pointenlose Schluss
- Analyse der Pointierung in der ZEIT-Kolumne „Das Letzte“
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Pointierung im Feuilleton, wobei der Fokus auf der Unterscheidung zwischen „Pointe“ und „Pointierung“ bzw. „pointiertem Schreibstil“ liegt. Ziel ist es aufzuzeigen, dass der Begriff „Pointe“ vielschichtiger ist als gemeinhin angenommen. Das Feuilleton wird als besonders geeignete Darstellungsform für diese Analyse betrachtet, aufgrund seines spezifischen Verhältnisses zur Pointe. Die Arbeit analysiert die Funktion von Pointen im Feuilleton, untersucht den pointierten Schreibstil und veranschaulicht die theoretischen Ausführungen anhand von Beispielen aus der ZEIT-Kolumne „Das Letzte“.
- Definition und Abgrenzung der Begriffe „Pointe“ und „Pointierung“
- Analyse der Funktion von Pointen im Feuilleton
- Untersuchung des pointierten Schreibstils im Feuilleton
- Vergleich der Pointierung im Feuilleton mit anderen Textsorten
- Praktische Analyse anhand von Beispielen aus der ZEIT-Kolumne „Das Letzte“
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Pointierung im Feuilleton ein und betont das Theoriedefizit in der wissenschaftlichen Literatur bezüglich beider Begriffe. Sie erläutert die Zielsetzung der Arbeit, die darin besteht, die Unterscheidung zwischen „Pointe“ und „Pointierung“ herauszuarbeiten und das Feuilleton als geeignete Darstellungsform für diese Analyse zu nutzen. Die methodische Vorgehensweise wird skizziert: Definition der Begriffe, Analyse der Pointierung im Feuilleton, praktische Unterfütterung anhand von Beispielen und abschließendes Fazit.
Begriffdefinitionen: Dieses Kapitel definiert die Begriffe „Feuilleton“ und „Pointe“. „Feuilleton“ wird als journalistische Darstellungsform beschrieben, die sich schwer von anderen Genres abgrenzen lässt und vielfältige Themen und Stimmungen behandeln kann. Die Definition von „Pointe“ wird vorbereitet für die spätere Analyse ihrer Verwendung im Feuilleton. Der Abschnitt betont die Schwierigkeit, eindeutige Definitionen für beide Begriffe in der Literatur zu finden und die damit verbundenen Herausforderungen für die wissenschaftliche Auseinandersetzung.
Die Pointe im Feuilleton: Dieses Kapitel analysiert das Auftreten und die Funktion von Pointen im Feuilleton. Es geht über die gängige Vorstellung der Schlusspointe hinaus und untersucht den „pointierten Schreibstil“ als charakteristisches Merkmal feuilletonistischer Texte. Es werden verschiedene Arten der Pointierung diskutiert und im Kontext des Feuilletons eingeordnet. Der Abschnitt beleuchtet auch die Möglichkeit eines pointenlosen Schlusses im Feuilleton und seine Bedeutung.
Schlüsselwörter
Pointe, Pointierung, pointierter Schreibstil, Feuilleton, journalistische Darstellungsform, Textsortenvergleich, ZEIT-Kolumne „Das Letzte“, Stilanalyse, literarische Analyse.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Pointierung im Feuilleton
Was ist der Gegenstand der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Pointierung im Feuilleton. Der Fokus liegt dabei auf der Unterscheidung zwischen den Begriffen „Pointe“ und „Pointierung“ bzw. „pointiertem Schreibstil“. Ziel ist es, die Vielschichtigkeit des Begriffs „Pointe“ aufzuzeigen und das Feuilleton als besonders geeignete Darstellungsform für diese Analyse zu betrachten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von „Pointe“ und „Pointierung“, Analyse der Funktion von Pointen im Feuilleton, Untersuchung des pointierten Schreibstils im Feuilleton, Vergleich der Pointierung im Feuilleton mit anderen Textsorten und eine praktische Analyse anhand von Beispielen aus der ZEIT-Kolumne „Das Letzte“.
Wie ist die Hausarbeit aufgebaut?
Die Hausarbeit umfasst eine Einleitung, Kapitel zu Begriffdefinitionen (Feuilleton und Pointe), die Analyse der Pointe im Feuilleton (inkl. pointierter Schreibstil und pointenloser Schluss), eine Analyse der Pointierung in der ZEIT-Kolumne „Das Letzte“ und ein Fazit. Jedes Kapitel fasst seine Kernaussagen zusammen.
Welche Begriffe werden definiert?
Die Hausarbeit definiert die Begriffe „Feuilleton“ als journalistische Darstellungsform und „Pointe“ im Kontext ihres Gebrauchs im Feuilleton. Die Schwierigkeit, eindeutige Definitionen in der Literatur zu finden, wird hervorgehoben.
Welche Rolle spielt die ZEIT-Kolumne „Das Letzte“?
Die ZEIT-Kolumne „Das Letzte“ dient als Grundlage für eine praktische Analyse der theoretischen Ausführungen. Beispiele aus dieser Kolumne veranschaulichen die Anwendung von Pointen und dem pointierten Schreibstil im Feuilleton.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und bewertet die Bedeutung der Unterscheidung zwischen „Pointe“ und „Pointierung“ für das Verständnis des Feuilletons. Es wird auf das Theoriedefizit in der wissenschaftlichen Literatur hingewiesen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Pointe, Pointierung, pointierter Schreibstil, Feuilleton, journalistische Darstellungsform, Textsortenvergleich, ZEIT-Kolumne „Das Letzte“, Stilanalyse, literarische Analyse.
- Citar trabajo
- Henry Berndt (Autor), 2005, Pointierung im Feuilleton - eine theoretische und praktische Analyse, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49835