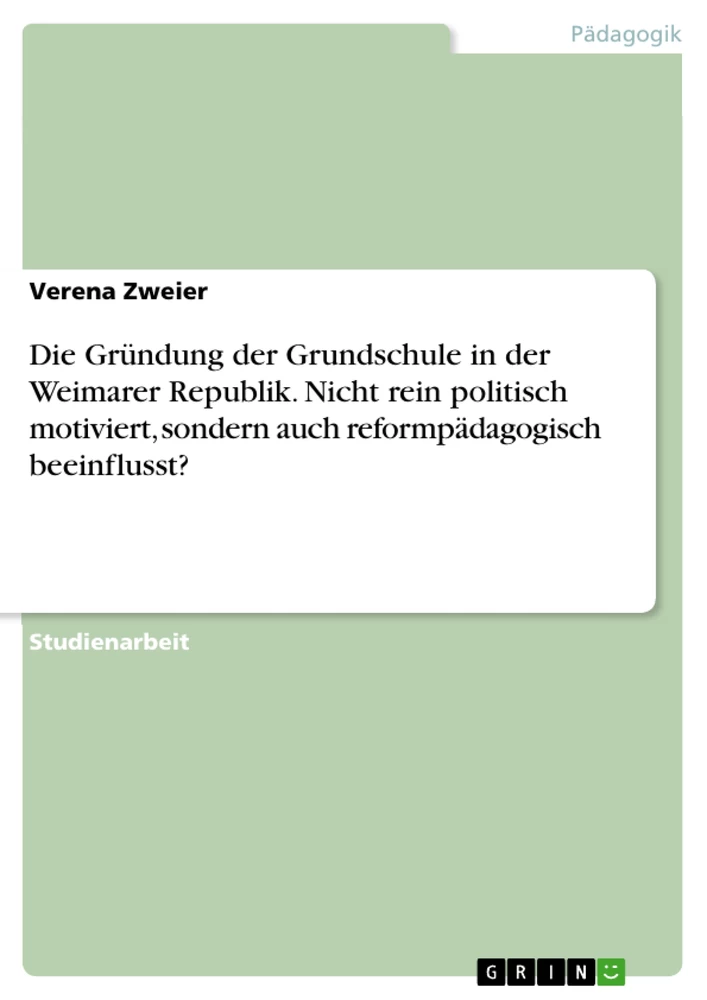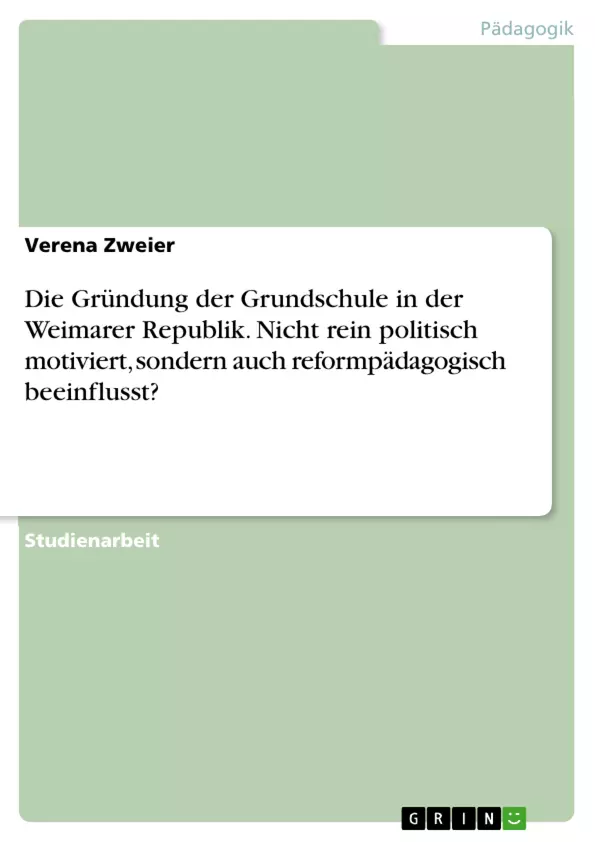In der hier vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, inwieweit die reformpädagogischen Vorstellungen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts die Grundschule in der Weimarer Republik beeinflussten. Nach einem kurzen Überblick über wichtige reformpädagogische Strömungen wird zuerst die Gesetzgebung in den Blick genommen. Hierzu werden wichtige Richtlinien, an denen man sich bei der Erstellung der Lehrpläne orientieren sollte, im Hinblick auf die Frage nach erkennbaren reformpädagogischen Einflüssen untersucht.
Zur Verdeutlichung der Ergebnisse dient die anschließende Analyse der Ausführungen Eckhardts über die Gestaltung der Grundschule. Begründet sich die damalige wie die heutige Grundschule auf einem durch politische Willkür und Kompromisse zustande gekommenen Gesetz? Und spielten bildungsbezogene und pädagogische Fragen überhaupt eine Rolle? Diese Fragen werden in der vorliegenden Arbeit beantwortet.
Inhaltsverzeichnis
- Beitrag der politischen Situation sowie pädagogischer Motive zur Gründung der Grundschule.
- Überblick über reformpädagogische Strömungen
- Pädagogik vom Kinde aus.
- Arbeitsschulbewegung.
- Kunsterziehungsbewegung.
- Gesamtunterrichtliche Bewegung
- Auswirkungen reformpädagogischer Ansprüche auf die Schulgesetzgebung.
- Einfluss der Reformpädagogik auf die innere Ausgestaltung der Grundschule – eine Analyse Eckhardts „Theorie der Schule“
- Die Gestaltung der Weimarer Grundschule als erfolgreiches Beispiel der Verstaatlichung pädagogischer Ansprüche
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss reformpädagogischer Strömungen auf die Gründung und Ausgestaltung der Grundschule in der Weimarer Republik. Es soll geklärt werden, inwieweit die reformpädagogischen Ideen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts die Gesetzgebung und die praktische Schulgestaltung prägten. Die Arbeit stellt dabei die Frage nach der Bedeutung von politischen und pädagogischen Motiven bei der Entstehung der Grundschule.
- Politische und pädagogische Einflussfaktoren auf die Gründung der Grundschule.
- Reformpädagogische Strömungen in der Weimarer Republik.
- Auswirkungen der Reformpädagogik auf die Schulgesetzgebung.
- Einfluss der Reformpädagogik auf die praktische Schulgestaltung.
- Die Weimarer Grundschule als Beispiel der Verstaatlichung pädagogischer Ansprüche.
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel untersucht die politische Situation und die pädagogischen Motive, die zur Gründung der Grundschule in der Weimarer Republik führten. Es werden die politischen Mehrheitsverhältnisse, das gesellschaftliche Klima und die Kompromisse bei der Entstehung des Grundschulgesetzes beleuchtet.
- Das zweite Kapitel gibt einen Überblick über wichtige reformpädagogische Strömungen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Die Arbeit stellt dabei die Pädagogik vom Kinde aus, die Arbeitsschulbewegung und die Kunsterziehungsbewegung vor.
- Das dritte Kapitel analysiert die Auswirkungen reformpädagogischer Ansprüche auf die Schulgesetzgebung der Weimarer Republik. Es werden wichtige Richtlinien der Lehrplanerstellung im Hinblick auf erkennbare reformpädagogische Einflüsse untersucht.
- Das vierte Kapitel analysiert Eckhardts "Theorie der Schule" und zeigt den Einfluss der Reformpädagogik auf die innere Ausgestaltung der Grundschule.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Grundschule, Reformpädagogik, Weimarer Republik, Schulgesetzgebung, Lehrplan, pädagogische Strömungen, Arbeitsschule, Pädagogik vom Kinde aus, politische Einflussfaktoren.
Häufig gestellte Fragen
Warum wurde die Grundschule in der Weimarer Republik gegründet?
Die Gründung war ein politischer Kompromiss zur Überwindung des ständischen Schulwesens und sollte eine gemeinsame Basiserziehung für alle Kinder unabhängig von ihrer Herkunft schaffen.
Welchen Einfluss hatte die Reformpädagogik auf die Grundschule?
Strömungen wie die "Pädagogik vom Kinde aus" und die "Arbeitsschulbewegung" prägten die Lehrpläne und führten zu kindgerechteren Unterrichtsmethoden.
Was ist die Arbeitsschulbewegung?
Ein reformpädagogischer Ansatz, der aktives Handeln, Selbsttätigkeit und manuelles Arbeiten der Schüler in den Mittelpunkt des Lernprozesses stellt.
Was besagt das Reichsgrundschulgesetz von 1920?
Es legte fest, dass die Grundschule als vierjährige gemeinsame Unterstufe für alle Kinder verpflichtend ist und die privaten Vorschulen abgeschafft werden.
Was versteht man unter "Gesamtunterricht"?
Ein methodisches Prinzip der Weimarer Grundschule, bei dem Themen fächerübergreifend und ganzheitlich behandelt werden, statt in streng getrennten Einzelfächern.
- Quote paper
- Verena Zweier (Author), 2015, Die Gründung der Grundschule in der Weimarer Republik. Nicht rein politisch motiviert, sondern auch reformpädagogisch beeinflusst?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/498232