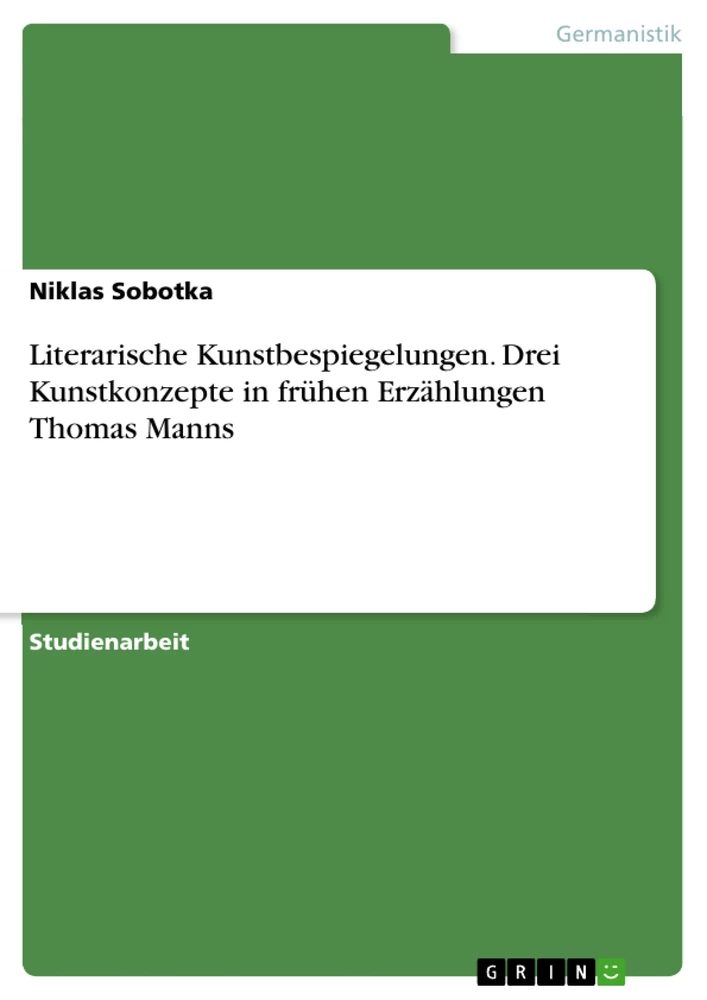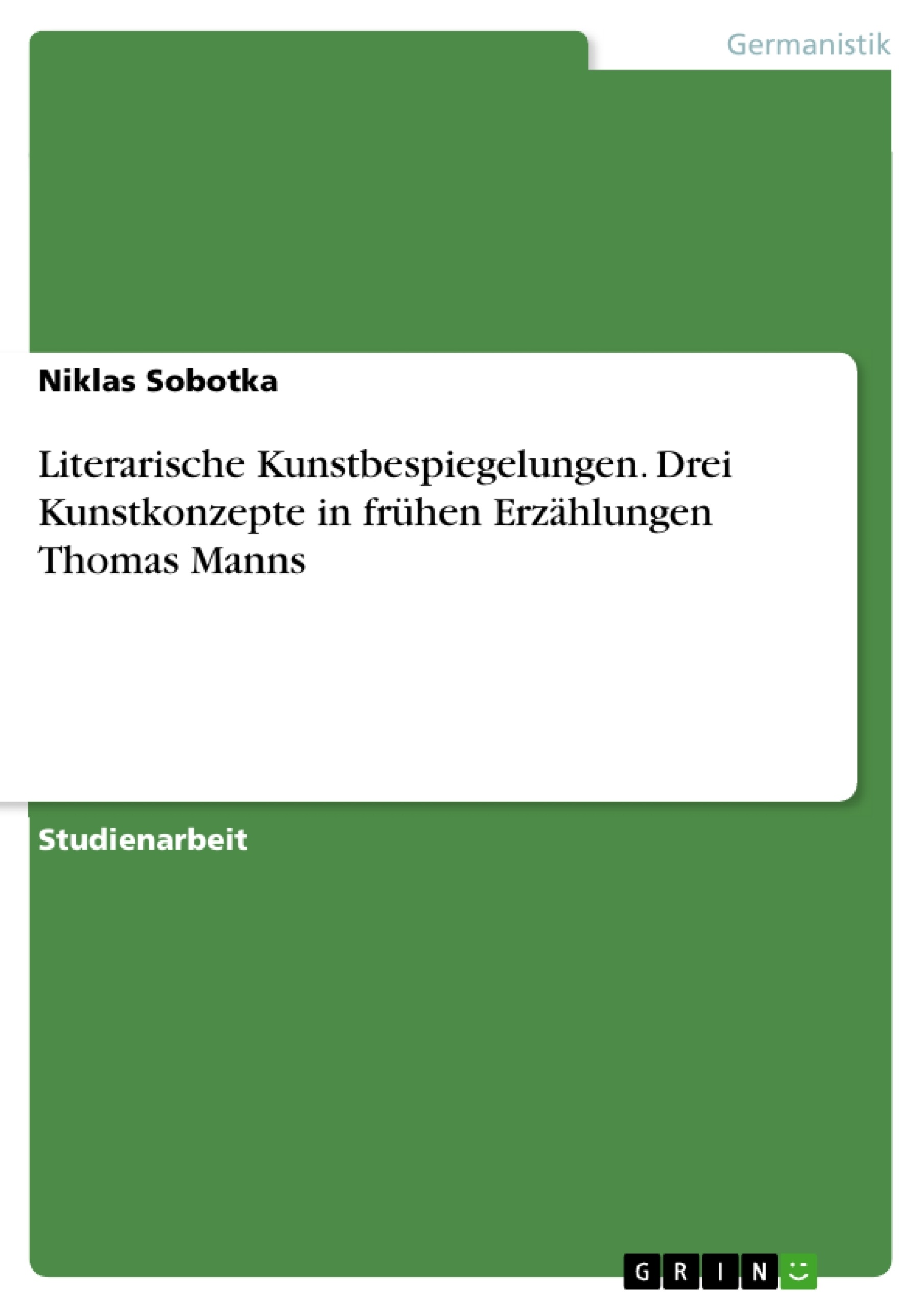Die Arbeit wirft einen Blick auf das Schaffen Thomas Manns, der seit 1894 in München lebte und Teil der Münchner Moderne war. Diese setzte neben der bekannteren Wiener Moderne Maßstäbe darin, wie Kunst in Zeiten großer Umbrüche und Neuorientierungen Ausdrucksformen erhalten könne, die den alltäglichen Erfahrungen adäquat waren. Kulturkrise galt als ein Zeichen der Zeit. Doch vielerorts wurde das freie Spiel mit den Möglichkeiten auch begrüßt und man übte sich darin, seinem Geist freien Lauf zu lassen oder aber sich am Schönen zu erfreuen.
Thomas Mann schrieb in der Zeit drei Erzählungen, die in mal kritischer mal ironischer Weise das Leben im München der Jahrhundertwende um 1900 illustrieren. In der Arbeit werden diese vorgestellt und in den Zusammenhang der gesellschaftlichen Entwicklungen gebracht. Drei Kunstkonzepte, die jeweils einen Teil eines übergeordneten Phänomens darstellen, dienen als Interpretationsschlüssel, um sich der Kultur als antwortende Sphäre auf die Gesellschaft zu nähern.
Inhaltsverzeichnis
- Kulturkrise und kulturelle Moderne.
- Das Konzept kommerzialisierter und, sensationalisierter Kunst innerhalb der Erzählungen „Gladius Dei\" (1902) und „Das Wunderkind“ (1903)
- Zur bildenden Kunst in „Gladius Dei“ (1902).
- Zur Musik in,,Das Wunderkind“ (1903).
- Das Konzept der Kunstreligion in der Erzählung „Beim Propheten\" (1904)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Wandel der Kunstvermittlung um 1900 und beleuchtet anhand von drei frühen Erzählungen Thomas Manns, wie sich die Kunst in den Großstädten der Jahrhundertwende präsentierte. Die Arbeit analysiert unterschiedliche Kunstkonzepte, die Mann in seinen Erzählungen verarbeitet und untersucht, wie sich die Kunst im Spannungsfeld von Kommerzialisierung, Sensation und elitärer Kunstauffassung bewegte.
- Die Kulturkrise um 1900 als Ausgangspunkt für die Analyse der Kunstvermittlung
- Die Kommerzialisierung der Kunst und ihre Darstellung in „Gladius Dei“ und „Das Wunderkind“
- Die Inszenierung von Kunst als Sensation in den frühen Erzählungen Manns
- Die Vorstellung einer Kunstreligion in der Erzählung „Beim Propheten“
- Das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft im Kontext der kulturellen Moderne
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet das Konzept der Kulturkrise als ein zentrales Narrativ der Moderne um 1900. Es skizziert die Bedeutung dieses Konzepts für die Kunst und die gesellschaftliche Entwicklung der Zeit. Das zweite Kapitel analysiert die Erzählungen „Gladius Dei“ und „Das Wunderkind“, die die Kommerzialisierung der Kunst und deren Inszenierung als Sensation thematisieren. Der Fokus liegt dabei auf der Rolle der bildenden Kunst in „Gladius Dei“ und der Musik in „Das Wunderkind“. Das dritte Kapitel widmet sich der Erzählung „Beim Propheten“ und untersucht das Konzept der Kunstreligion, das in diesem Text ironisch dargestellt wird.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit den Themen Kunstvermittlung, Kulturkrise, Kommerzialisierung, Sensation, Kunstreligion, Moderne, Thomas Mann, frühe Erzählungen, „Gladius Dei“, „Das Wunderkind“, „Beim Propheten“.
- Quote paper
- Niklas Sobotka (Author), 2015, Literarische Kunstbespiegelungen. Drei Kunstkonzepte in frühen Erzählungen Thomas Manns, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/497764