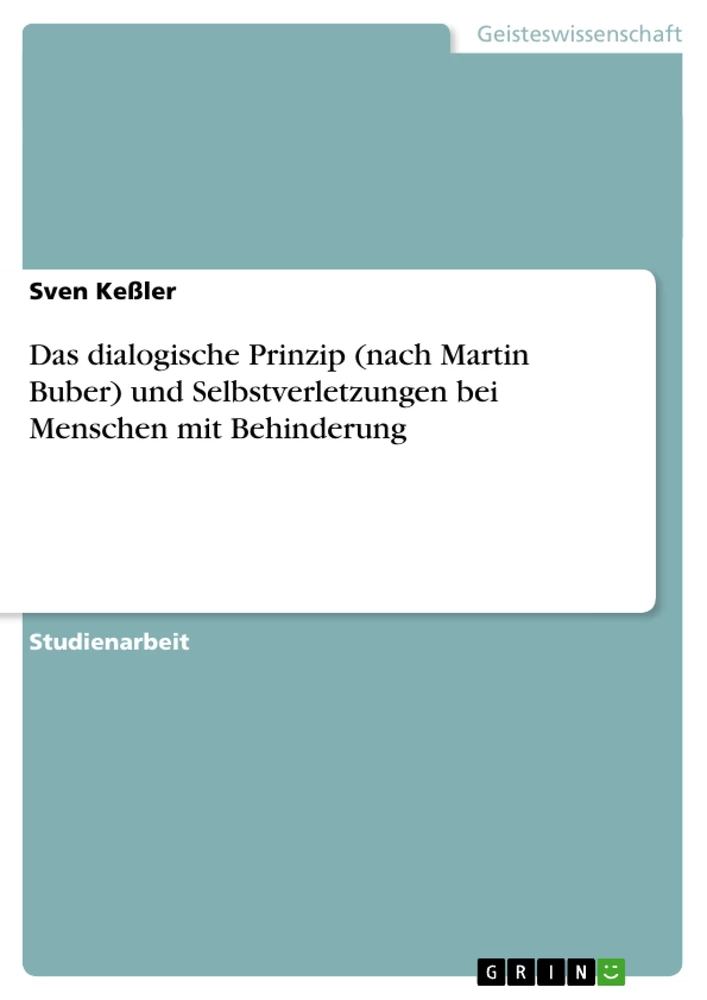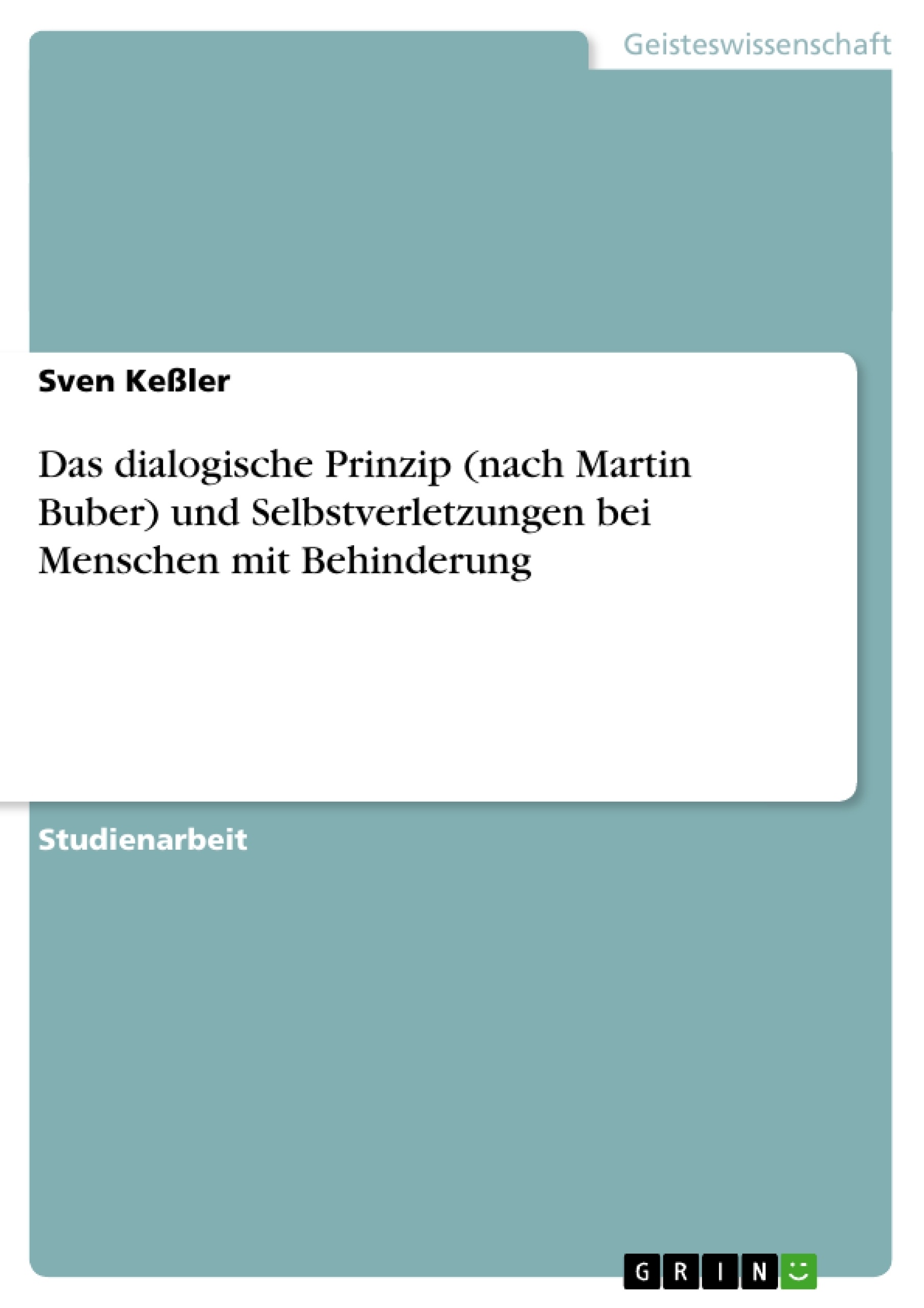„Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“
„Der Mensch wird am Du zum Ich.“ (Martin Buber)
In meiner letzten Praxisphase in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen von Juni bis Oktober 2004 stieß ich in einer Zeitschrift auf diese beiden Zitate von dem Philosophen Martin Buber. Sie regten mich dazu an, mehr über den Verfasser und sein Werk zu lesen, um Einzelheiten über seine Gedanken zu erfahren. Dabei fiel mir sein Thema „das Dialogische Prinzip“ auf. Ich habe die theoretischen Auffassungen auf die Gruppe, in der ich gearbeitet habe, übertragen und festgestellt, dass ein Mann völlig gegensätzlich zu den Auffassungen Bubers gelebt hat bzw. z.T. immer noch lebt. Dieser Mann zeigt häufig Autoaggressionen, indem er sich z.B. am Kopf Verletzungen beibringt.
In dieser Arbeit mit dem Thema „Das dialogische Prinzip (nach Martin Buber) und Selbstverletzungen bei Menschen mit Behinderung“ behandele ich die Fragen, was nach Buber der Mensch ist und was erforderlich ist, damit sich der Mensch verwirklichen kann. Diese Fragen setze ich anschließend mit dem Leben von Herrn Schmidt in Beziehung und beantworte auch die Frage, warum es bei ihm zu selbstverletzendem Verhalten kommt.
Unter 2. werde ich zunächst einen Überblick über das Leben und die Werke von Martin Buber geben, um ihn als Verfasser zu kennzeichnen. Daraufhin folgen seine philosophischen Gedanken zum dialogischen Prinzip. Anschließend beschreibe ich unter 3. den „Fall“ aus meiner Praxisphase (Herr Schmidt). Dabei gehe ich zunächst zum besseren Verständnis des „Falls“ allgemein auf das Problem Selbstverletzungen bei behinderten Menschen ein. Es folgt eine Darstellung der Person von Herrn Schmidt und seiner Lebenssituation.
Zum Schluss werde ich unter 4. die theoretischen Erörterungen zum dialogischen Prinzip auf den „Fall“ aus der Praxis übertragen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Motiv für die Themenwahl
- 2. Martin Buber
- 2.1 Sein Lebenslauf
- 2.2 Seine Werke
- 2.3 Wurzeln des dialogischen Prinzips
- 2.4 Das dialogische Prinzip
- 2.4.1 Das anthropologische Problem in unserem Zeitalter
- 2.4.2 Urdistanz und Beziehung
- 2.4.3 Die beiden Grundworte
- 2.4.3.1 Das Grundwort „Ich-Es“
- 2.4.3.2 Das Grundwort,,Ich-Du“
- 2.4.4 Phänomene der „Ich-Du-Beziehung“
- 2.4.4.1 Anerkennung und Bestätigung der „Anderheit“
- 2.4.4.2 Unmittelbarkeit und Ausschließlichkeit
- 2.4.4.3 Gegenseitigkeit, Zwischen und Umfassung
- 2.4.4.4 Vergegenwärtigung und Erschließung
- 2.4.4.5 Dialogische Verantwortung
- 2.4.4.6 Aktualität und Latenz der Dialogik
- 3. Ein „Fall\" aus der Praxis
- 3.1 Selbstverletzungen bei Menschen mit einer Behinderung
- 3.2 Person und Lebenssituation eines Bewohners (Herr Schmidt)
- 4. Das dialogische Prinzip in Übertragung auf den „Fall“
- 4.1,,Vergegnung“
- 4.2 Das erzieherische Verhältnis zwischen den Mitarbeitern und Herrn Schmidt
- 4.3 Dialogische Gestalttherapie
- 5. Quellenverzeichnis
- Das dialogische Prinzip nach Martin Buber
- Die Rolle des Dialogs in der Begegnung mit Menschen mit Behinderung
- Das Problem von Selbstverletzungen bei Menschen mit Behinderung
- Die Bedeutung des Dialogs für die Entwicklung einer gesunden Selbstwahrnehmung
- Anwendung des dialogischen Prinzips in der praktischen Arbeit mit Menschen mit Behinderung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Studienarbeit zielt darauf ab, das dialogische Prinzip von Martin Buber zu untersuchen und seine Relevanz für die Arbeit mit Menschen mit Behinderung zu beleuchten. Hierbei wird insbesondere das Phänomen von Selbstverletzungen bei Menschen mit Behinderung in den Fokus gerückt.
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Einleitung und das Motiv für die Themenwahl dargelegt. Die Arbeit beleuchtet das dialogische Prinzip von Martin Buber und untersucht dessen Relevanz für Selbstverletzungen bei Menschen mit Behinderung. Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit Martin Buber und seinem Lebenslauf, seinen Werken sowie den Wurzeln seines dialogischen Prinzips. Dieses Prinzip wird im Detail erläutert, wobei insbesondere die Bedeutung der "Ich-Du"-Beziehung und deren Auswirkungen auf die menschliche Existenz im Mittelpunkt stehen. Das dritte Kapitel präsentiert einen "Fall" aus der Praxis, wobei es um Selbstverletzungen bei Menschen mit Behinderung und die Lebenssituation eines Bewohners, Herrn Schmidt, geht. Abschließend wird im vierten Kapitel das dialogische Prinzip auf den "Fall" aus der Praxis übertragen und die Anwendung des Prinzips in der Arbeit mit Herrn Schmidt diskutiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind das dialogische Prinzip, Martin Buber, Selbstverletzung, Behinderung, "Ich-Du"-Beziehung, menschliche Begegnung, empathische Kommunikation, Selbstwahrnehmung, Anerkennung, Bestätigung, Verantwortung, und Praxisrelevanz.
- Quote paper
- Sven Keßler (Author), 2004, Das dialogische Prinzip (nach Martin Buber) und Selbstverletzungen bei Menschen mit Behinderung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49765