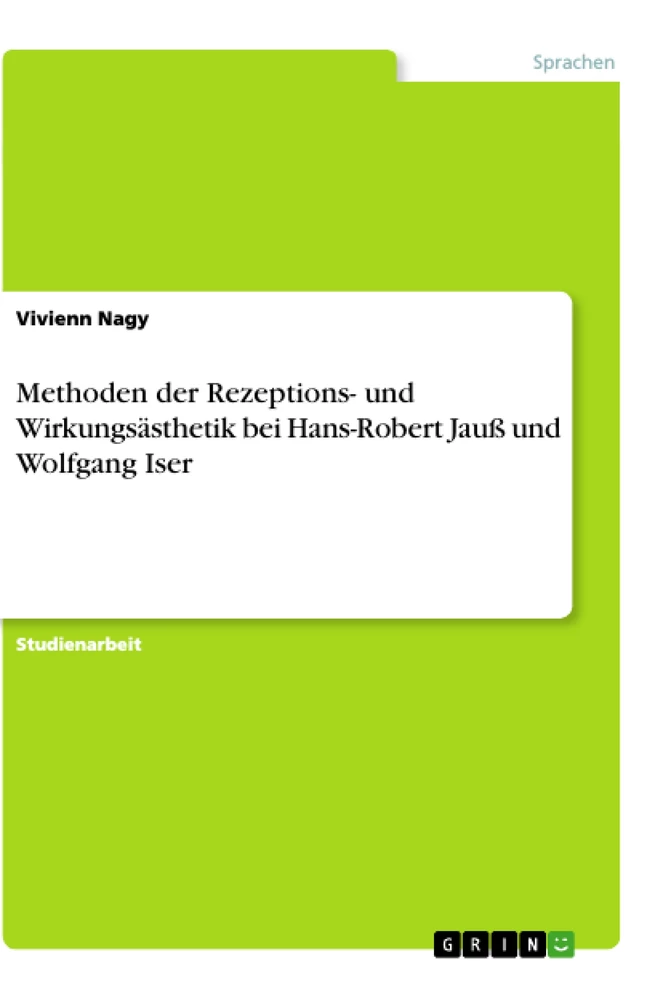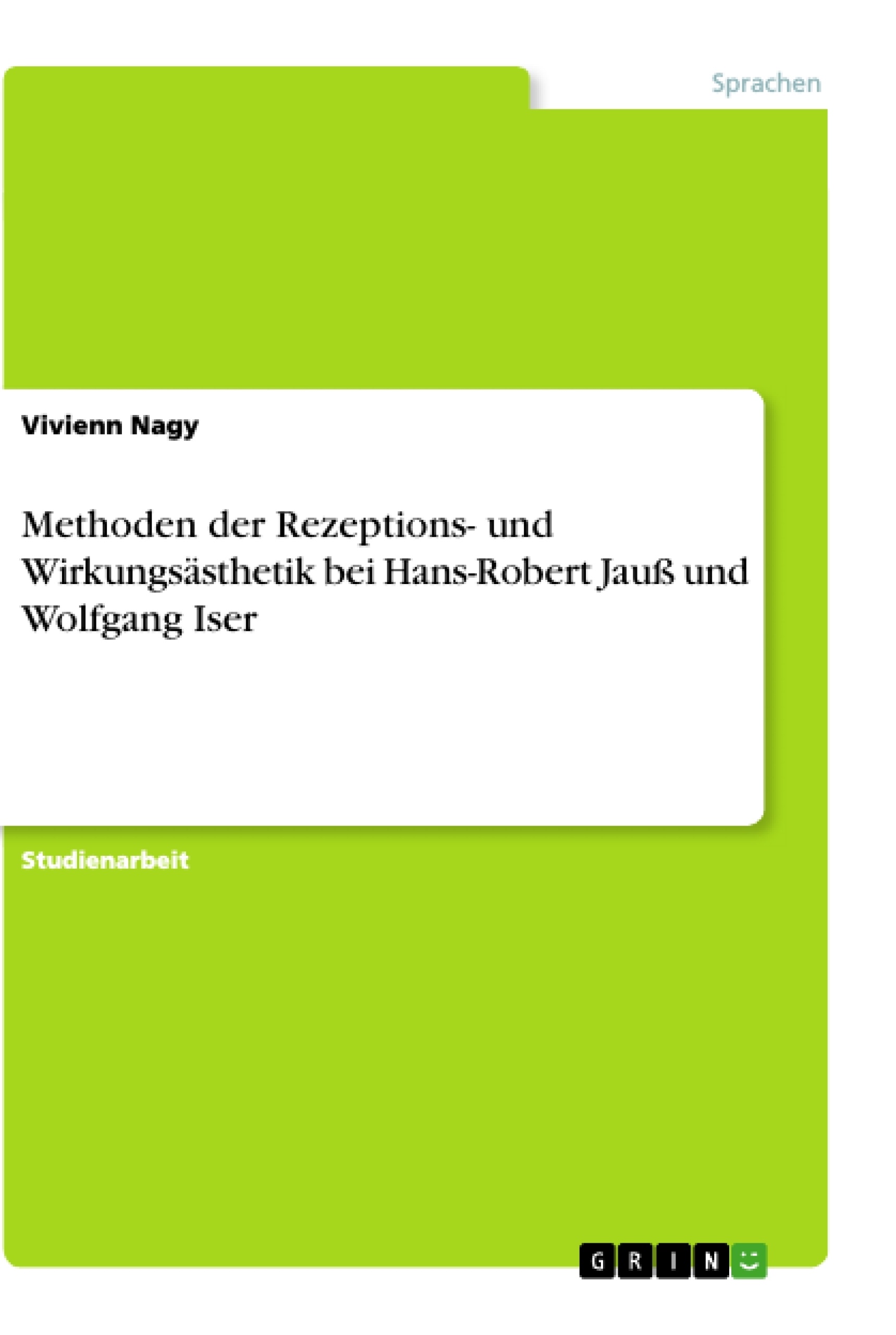Thema dieser Arbeit sind die Geschichte und Anwendung der Rezeptions- und Wirkungsästhetik mit Bezug auf den Literaturwissenschaftler und Romanisten Hans-Robert Jauß (1921-1997) und den Literaturwissenschaftler und Anglisten Wolfgang Iser (1926-2007).
Rezeption bezeichnet im Allgemeinen die Aufnahme und Übernahme von fremden Ideen, Normen und Wertvorstellungen bzw. Verhaltensweisen. Die Rezeptionsgeschichte untersucht die Aufnahme, die ein literarischer Text im Laufe der Zeit bei seinem Publikum gefunden hat. Sie ist historisch beziehungsweise literaturgeschichtlich orientiert. Rezeptionsästhetik untersucht die Bedingungen dieser Aufnahme.
Die Wirkungsästhetik entwirft eine Theorie des Leseprozesses, wobei dem Leser eine besondere Rolle in der Sinnkonstitution zukommt. Wirkungsästhetik ist weniger an den historischen Rezeptionsbedingungen interessiert. Der Ausgangspunkt ist die Kritik an der positivistisch ausgerichteten, marxistischen Literaturwissenschaft und die Kritik an der ausschließlichen Untersuchung von Textstrukturen, die außertextuelle Komponenten des Verstehens vernachlässigt.
Die Methoden von Rezeptions- und Wirkungsästhetik begreifen das literarische Faktum im geschlossenen Kreis einer Produktions- und Darstellungsästhetik. Sie verkürzen die Literatur damit um eine Dimension, die unerlässlich zu ihrem ästhetischen Charakter und gesellschaftlichen Funktion gehört: die Dimension ihrer Rezeption und Wirkung.
Das Interesse wird nicht auf den Autor und das Werk, sondern auf den Leser gelenkt. Denn erst durch seine Vermittlung tritt das Werk in den sich wandelnden Erfahrungshorizont einer Kontinuität, in der sich die ständige Umsetzung von einfacher Aufnahme in kritisches Verstehen, von passiver in aktive Rezeption, von anerkannten ästhetischen Normen in neue, sie übersteigende Produktion vollzieht.
Das Interesse an Leser und Leseakt verändert und ergänzt die traditionelle Felder der Literaturwissenschaft. Den Anstoß gab die Konstanzer Antrittsvorlesung des Romanisten Hans-Robert Jauß "Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft" im Jahre 1967.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hans-Robert Jauß (1921-1997) und seine Rezeptionsästhetik
- Wolfgang Iser (1926-2007) und seine Wirkungsästhetik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Rezeptions- und Wirkungsästhetik, insbesondere mit den Theorien von Hans-Robert Jauß und Wolfgang Iser. Ziel ist es, die zentralen Konzepte und Methoden beider Ansätze darzustellen und zu vergleichen.
- Rezeptionsgeschichte und ihre Methoden
- Der Erwartungshorizont des Lesers
- Der hermeneutische Zirkel im Leseprozess
- Die Rolle des Lesers in der Sinnkonstitution
- Die ästhetischen und historischen Implikationen der Literaturrezeption
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Rezeptions- und Wirkungsästhetik ein. Sie definiert den Begriff der Rezeption und hebt den Unterschied zwischen rezeptionsgeschichtlicher und wirkungsästhetischer Betrachtungsweise hervor. Besonders wird der Fokus auf die Rolle des Lesers bei der Sinnkonstitution und die Kritik an positivistischen und strukturalistischen Ansätzen in der Literaturwissenschaft gelegt. Die Arbeit von Hans Robert Jauß wird als Ausgangspunkt der modernen Rezeptionsästhetik hervorgehoben.
Hans-Robert Jauß (1921-1997) und seine Rezeptionsästhetik: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Jauß' Rezeptionsästhetik, die den hermeneutischen Ansatz Gadamer aufgreift und ihn auf die Kommunikationssituation zwischen Text und Leser anwendet. Es wird der Begriff des Horizonts erläutert – die Summe der Erwartungen und des Vorverständnisses des Lesers – und wie dieser im Verstehensprozess mit dem Horizont des Textes verschmilzt. Der hermeneutische Zirkel und die Bedeutung des Vorverständnisses werden detailliert beschrieben. Die ästhetischen und historischen Implikationen des Verhältnisses von Literatur und Leser werden diskutiert, wobei die Bedeutung der Rezeptionsgeschichte für die Wertung eines literarischen Werks betont wird. Jauß' Werkbegriff wird als dynamisch und rezeptionsabhängig dargestellt, im Gegensatz zu einem statischen Monument.
Schlüsselwörter
Rezeptionsästhetik, Wirkungsästhetik, Hans-Robert Jauß, Wolfgang Iser, Hermeneutik, Erwartungshorizont, Leseprozess, Sinnkonstitution, Literaturgeschichte, Rezeptionsgeschichte.
Häufig gestellte Fragen zu: Rezeptions- und Wirkungsästhetik nach Jauß und Iser
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich mit der Rezeptions- und Wirkungsästhetik, insbesondere mit den Theorien von Hans-Robert Jauß und Wolfgang Iser. Ziel ist ein Vergleich der zentralen Konzepte und Methoden beider Ansätze.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt Themen wie Rezeptionsgeschichte und ihre Methoden, den Erwartungshorizont des Lesers, den hermeneutischen Zirkel im Leseprozess, die Rolle des Lesers in der Sinnkonstitution und die ästhetischen und historischen Implikationen der Literaturrezeption.
Wer sind die zentralen Figuren der Arbeit?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Theorien von Hans-Robert Jauß (1921-1997) und seiner Rezeptionsästhetik sowie Wolfgang Iser (1926-2007) und seiner Wirkungsästhetik.
Was ist der Ansatz von Hans-Robert Jauß?
Jauß' Rezeptionsästhetik greift den hermeneutischen Ansatz Gadamer auf und wendet ihn auf die Kommunikationssituation zwischen Text und Leser an. Zentral ist der Begriff des Horizonts (Erwartungen und Vorverständnis des Lesers), der im Verstehensprozess mit dem Horizont des Textes verschmilzt. Der hermeneutische Zirkel und die Bedeutung des Vorverständnisses werden detailliert beschrieben. Die Rezeptionsgeschichte wird als entscheidend für die Wertung eines literarischen Werks betrachtet.
Wie wird der Leser in Jauß' Theorie gesehen?
Bei Jauß spielt der Leser eine aktive Rolle in der Sinnkonstitution. Sein Erwartungshorizont beeinflusst maßgeblich das Verständnis des Textes. Der Text wird nicht als statisches Monument, sondern als dynamisches Gebilde verstanden, das durch die Rezeption erst seine Bedeutung erhält.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind Rezeptionsästhetik, Wirkungsästhetik, Hans-Robert Jauß, Wolfgang Iser, Hermeneutik, Erwartungshorizont, Leseprozess, Sinnkonstitution, Literaturgeschichte und Rezeptionsgeschichte.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zu Hans-Robert Jauß und seiner Rezeptionsästhetik, und ein Kapitel zu Wolfgang Iser und seiner Wirkungsästhetik (obwohl der Inhalt zu Iser in der vorliegenden Vorschau fehlt).
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die zentralen Konzepte und Methoden der Rezeptions- und Wirkungsästhetik nach Jauß und Iser darzustellen und zu vergleichen. Sie beleuchtet die Rolle des Lesers bei der Sinnkonstitution und kritisiert positivistische und strukturalistische Ansätze in der Literaturwissenschaft.
- Quote paper
- Vivienn Nagy (Author), 2019, Methoden der Rezeptions- und Wirkungsästhetik bei Hans-Robert Jauß und Wolfgang Iser, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/497619