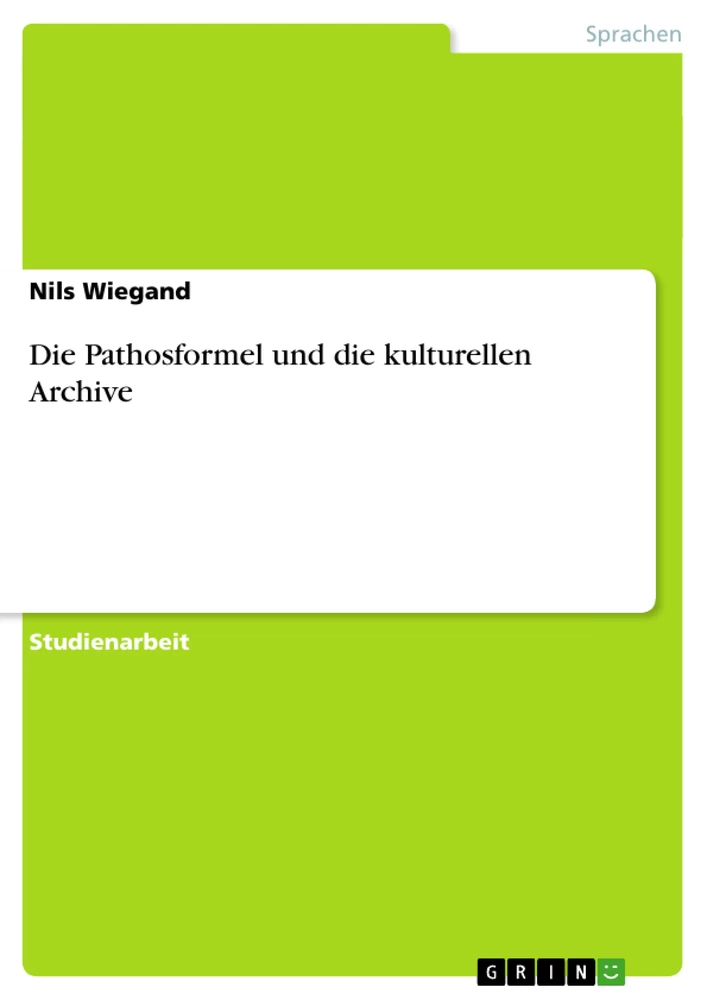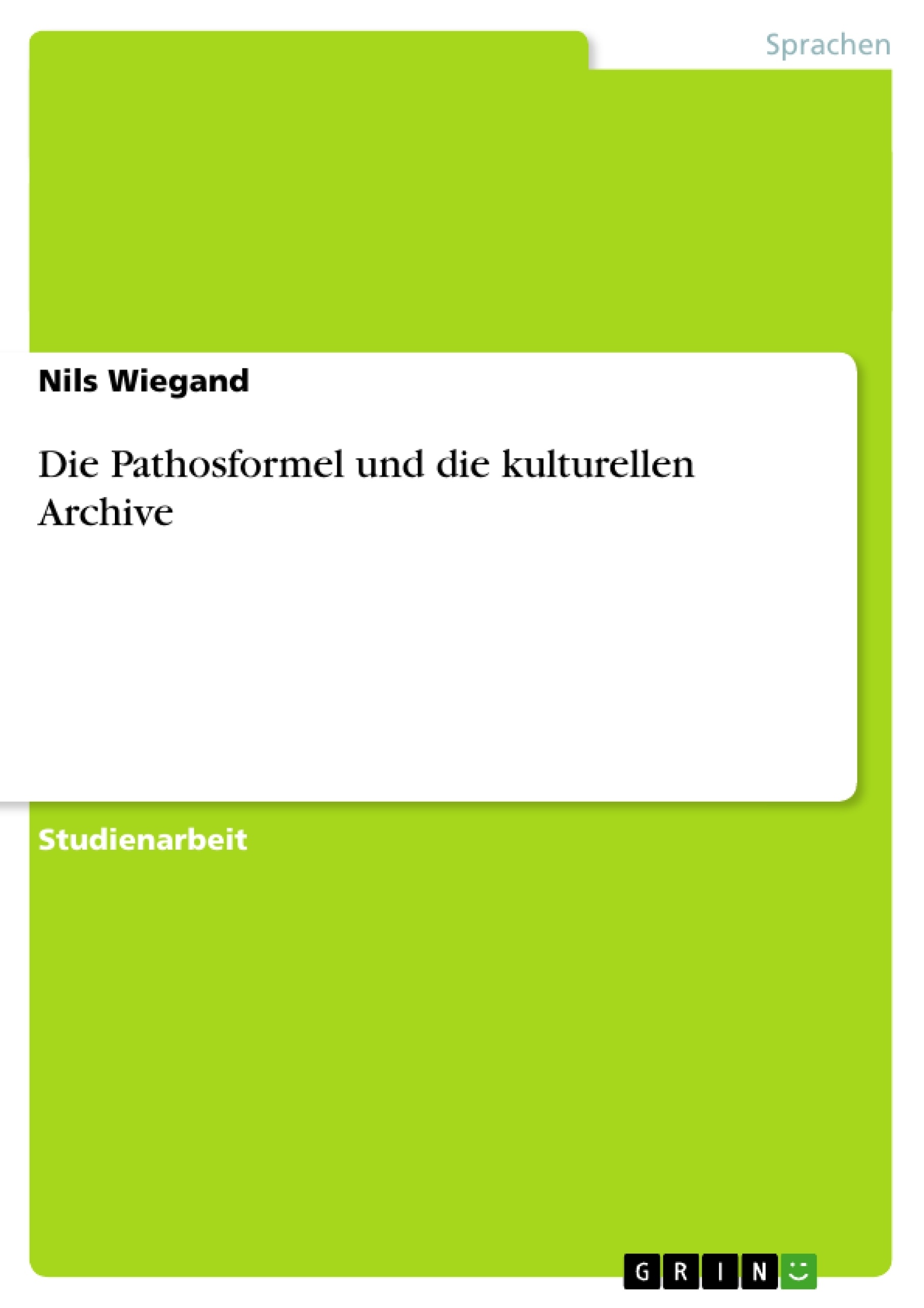Der Neologismus „Pathosformel“, den Aby Warburg zu Beginn des 20. Jahrhunderts prägt, verweist bereits namentlich auf zwei wichtige Strukturmerkmale. Pathos ist in der rhetorischen Theorie ein Komplex, der „ein dialektisches Spannungsverhältnis zwischen passiver Seelenerfahrung und aktiver Gefühlsäußerung“ ergibt. Hinsichtlich des ersten Strukturmerkmals wird Pathos mit einer Semantik aufgeladen, die wir unter dem Begriff der Passion fassen können, der „ursprünglich einen Seelenzustand, in dem man sich passiv leidend und nicht aktiv wirkend vorfindet“ meint und den Analysekern bezüglich der Pathosformel entsprechend fokussiert. Das zweite Merkmal verweist demnach auf eine Codierung der passiven Leidenssemantik, d.h.: „Es handelt sich nicht um eine unvermittelte, gleichsam natürwüchsige Artikulation von Affekten und Leidenschaften, sondern um eine kulturell überformte und codierte Inszenierung derselben (…).“ Als Codierung wird Pathos also als Mittel zur Ausdruckssteigerung verwandt und für Aby Warburg bildet dies den Kern antiker Kunst, deren formale Eigenschaften in der Renaissancekunst wieder auftauchen, indem spezielle Ausdrucksgebärden nach antikem Muster vergleichsweise heftiger werden und demnach einen entgrenzteren Leidenscode aufgreifen. Warburgs kunsthistorische Frage besteht daher in der Bedeutung des antiken Einflusses in der Renaissance, den diese Arbeit nach Warburg analysiert und darüber hinaus sein psychologisch konnotiertes Pathos-Konzept hinsichtlich seiner Beurteilung der Affekte konturiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Themenanalyse
- Aby Warburgs Konzept des Nachlebens der Antike
- Pathosformeln
- Mnemosyne, Sophrosyne und Energetische Inversion
- Das Kollektivgedächtnis: vom Linearen zum Zyklischen
- Memoria: vom kollektiven Unbewussten zum kulturellen Gedächtnis
- memoria und das kollektive Gedächtnis
- Kulturelle Speichermedien als Archive
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Aby Warburgs Konzept der Pathosformeln und deren Bedeutung für das Verständnis des Nachlebens der Antike in der Renaissance. Sie untersucht Warburgs ikonologische Methode und seine Auseinandersetzung mit der Bedeutung antiker Darstellungskonventionen in der Kunst der Frührenaissance. Die Arbeit beleuchtet den Einfluss antiker Bildmotive und deren kulturelle Überformung.
- Warburgs Konzept der Pathosformeln
- Das Nachleben der Antike in der Renaissancekunst
- Ikonologische Bildanalyse nach Warburg
- Kulturelle Überformung antiker Motive
- Die Rolle von Affekten und Leidenschaften in der Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitende Themenanalyse: Die Einleitung führt den Neologismus „Pathosformel“ ein und erläutert dessen zentrale Bedeutung in Warburgs Werk. Pathos wird als ein dialektisches Spannungsverhältnis zwischen passiver Seelenerfahrung und aktiver Gefühlsäußerung definiert, wobei der Fokus auf der passiven Leidenssemantik und deren kulturellen Codierung liegt. Warburgs kunsthistorische Fragestellung nach dem Einfluss der Antike auf die Renaissance und seine psychologisch konnotierte Pathos-Konzeption werden als zentrale Themen der Arbeit herausgestellt.
Aby Warburgs Konzept des Nachlebens der Antike: Dieses Kapitel beschreibt Warburgs ikonologische Methode, die über die ikonographische Analyse hinausgeht und die tieferen, kulturellen Bedeutungen von Kunstwerken untersucht. Warburgs Analyse von Botticellis „Primavera“ und die Beobachtung der Rekurrenzen zur Antike im kulturellen Diskurs der Renaissance werden diskutiert. Das Prinzip der Kompatibilität zwischen traditionellen und paganen Strömungen im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit wird als zentraler Aspekt von Warburgs Ansatz hervorgehoben. Die Analyse von Domenico Ghirlandaios Darstellung der Geburt Christi inmitten römischer Ruinen veranschaulicht Warburgs These vom Nachleben der Antike und seiner Integration in die christliche Kunst.
Pathosformeln: Dieses Kapitel analysiert Warburgs Konzeption der Pathosformeln anhand von Dürers „Tod des Orpheus“ und dessen Bezug zu antiken Vorbildern. Warburg kritisiert das kunsthistorische Versäumnis, die Bedeutung antiker Vorbilder für pathetisch gesteigerte Mimik zu berücksichtigen. Die Analyse von Domenico Ghirlandaios „Geburt Johannes des Täufers“ zeigt die Verwendung antiker Bildmotive (Ninfa) und deren Funktion innerhalb der christlichen Komposition. Warburgs Schlussfolgerung, dass das künstlerische Ideal der Renaissance in der Eingliederung antiker Ausdrucksformeln in den Renaissancestil bestand, wird erläutert. Die Pathosformeln werden als antik vorgeprägte Bildsymbole beschrieben, die heftige Leidenschaften codieren und von Renaissancekünstlern aktualisiert wurden.
Schlüsselwörter
Pathosformeln, Aby Warburg, Ikonologie, Renaissancekunst, Antike, Kulturelles Gedächtnis, Affekte, Leidenschaften, Bildanalyse, Dürer, Botticelli, Ghirlandaio.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse des Nachlebens der Antike in der Renaissancekunst nach Aby Warburg
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Aby Warburgs Konzept der Pathosformeln und deren Bedeutung für das Verständnis des Nachlebens der Antike in der Renaissance. Im Fokus steht die ikonologische Methode Warburgs und die Untersuchung des Einflusses antiker Darstellungskonventionen und Bildmotive auf die Kunst der Frührenaissance, inklusive deren kulturelle Überformung.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit Warburgs Konzept der Pathosformeln, dem Nachleben der Antike in der Renaissancekunst, der ikonologischen Bildanalyse nach Warburg, der kulturellen Überformung antiker Motive, und der Rolle von Affekten und Leidenschaften in der Kunst. Konkrete Beispiele aus Werken von Botticelli, Dürer und Ghirlandaio veranschaulichen die theoretischen Konzepte.
Was sind Pathosformeln nach Aby Warburg?
Pathosformeln werden als antik vorgeprägte Bildsymbole beschrieben, die heftige Leidenschaften codieren und von Renaissancekünstlern aktualisiert wurden. Warburg versteht Pathos als ein dialektisches Spannungsverhältnis zwischen passiver Seelenerfahrung und aktiver Gefühlsäußerung, wobei der Fokus auf der passiven Leidenssemantik und deren kulturellen Codierung liegt.
Welche Methode verwendet die Arbeit?
Die Arbeit verwendet Warburgs ikonologische Methode, die über die bloße ikonographische Analyse hinausgeht und die tieferen, kulturellen Bedeutungen von Kunstwerken untersucht. Sie betrachtet die Rekurrenzen zur Antike im kulturellen Diskurs der Renaissance und das Prinzip der Kompatibilität zwischen traditionellen und paganen Strömungen im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit.
Welche Künstler und Werke werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Werke von Botticelli ("Primavera"), Dürer ("Tod des Orpheus") und Ghirlandaio ("Geburt Christi", "Geburt Johannes des Täufers"). Diese dienen als Beispiele zur Veranschaulichung von Warburgs Konzepten und seiner Methode.
Welche Rolle spielt das kulturelle Gedächtnis?
Die Arbeit berührt das Konzept des kulturellen Gedächtnisses, indem sie untersucht, wie antike Bildmotive und -konventionen über Jahrhunderte hinweg tradiert und in neue kulturelle Kontexte integriert wurden. Warburgs Konzept des "Nachlebens der Antike" veranschaulicht diesen Prozess.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine einleitende Themenanalyse, ein Kapitel zu Warburgs Konzept des Nachlebens der Antike (inkl. Unterkapiteln zu Pathosformeln, Mnemosyne etc.), ein Kapitel zu Memoria und kulturellem Gedächtnis, und eine Schlussbetrachtung. Jedes Kapitel fasst die wesentlichen Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Pathosformeln, Aby Warburg, Ikonologie, Renaissancekunst, Antike, Kulturelles Gedächtnis, Affekte, Leidenschaften, Bildanalyse, Dürer, Botticelli, Ghirlandaio.
- Quote paper
- Nils Wiegand (Author), 2005, Die Pathosformel und die kulturellen Archive, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49698