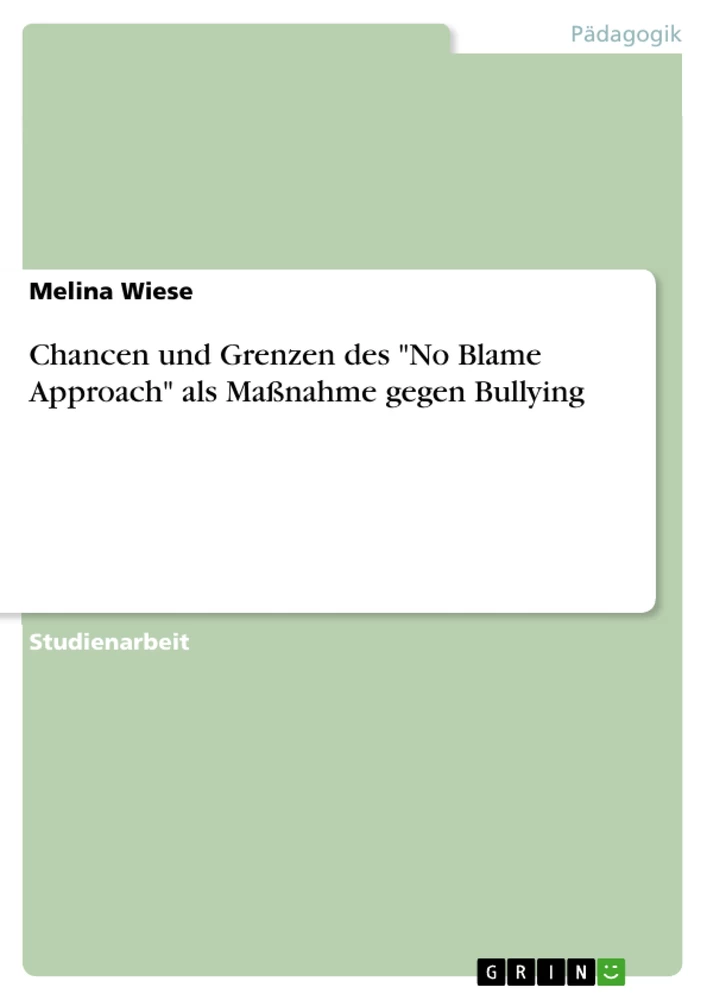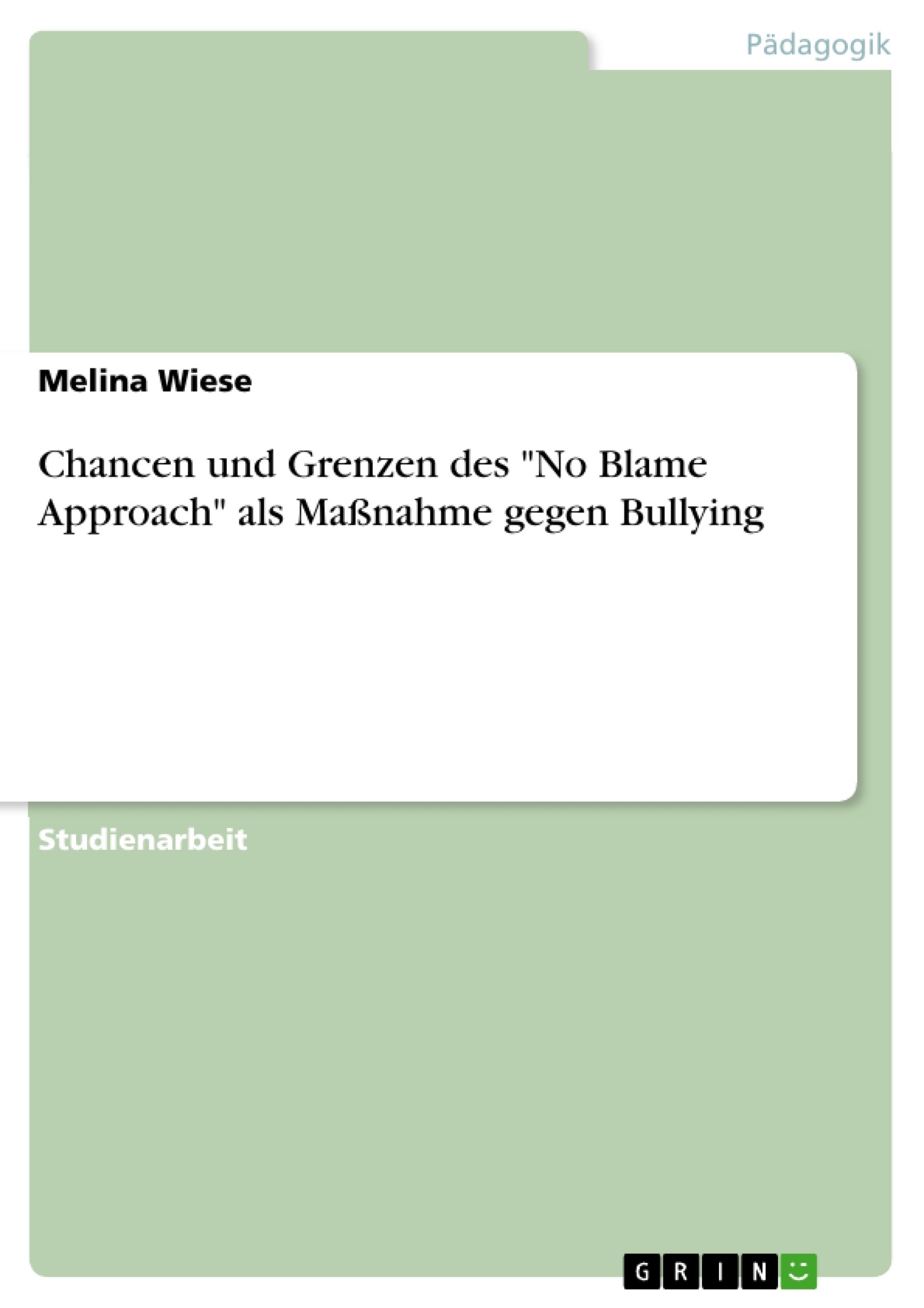"Hilfe ein Schüler von mir wird gemobbt!" – Mobbing in der Schule ist eine Realität, die in den meisten Fällen viel zu spät erkannt wird. Nach wie vor begegnet man im heutigen Schulkontext immer noch einer Reihe von Mythen bezüglich des Themas Mobbing – „Es handelt sich nur um eine kleine Hänselei“ oder „Mobbing – das gibt es nicht in meiner Klasse“. Letztlich ist das Thema Mobbing heute aber aktueller denn je. Nicht zuletzt aufgrund des grausamen Vorfalls in Berlin Reinickendorf der erst kürzlich durch die Schlagzeilen gegangen ist, sondern auch durch die gehäuften Vorkommnisse von Mobbing an deutschen Schulen.
Aber was kann man tun, wenn man Mobbing vermutet oder beobachtet? Schulen stehen in der Verantwortung sicherzustellen, dass Schülerinnen und Schüler ohne Angst in die Schule gehen, daher muss im Fall eines Mobbingverdachts immer überprüft werden, ob es sich im Fall einer Schülerin bzw. eines Schülers wirklich um eine Mobbingproblematik handelt oder nicht.
Es benötigt also ein Bewusstsein für Mobbing – ausgezeichnet durch ein geschultes Lehrpersonal und ein schlüssiges Präventionskonzept. Schulen benötigen also klar definierte, festgelegte Präventionsprogramme und Interventionsinstrumente. Aber welche Methoden gibt es? Und wie effektiv und nachhaltig sind diese?
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. BULLYING ALS SYSTEM
- 2.1 DEFINITION VON BULLYING
- 2.2 DAS SYSTEM BULLYING
- 2.3 BULLYING-SIGNALE: DIE MOBBINGBRILLE
- 3. NO BLAME APPROACH
- 3.1 HERKUNFT DES ANSATZES UND EINFLUSS ANDERER ANSÄTZE
- 3.2 VORGEHENSWEISE DES NO BLAME APPROACHES: DER DREISCHRITT
- 3.4 CHANCEN UND SCHWIERIGKEITEN
- 3.5 AUSBLICK FÜR DIE PRAXIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem „No Blame Approach“ als Interventionsstrategie gegen Bullying. Die Arbeit analysiert den Ansatz und seine Effektivität sowie seine Grenzen im schulischen Kontext. Sie soll einen Beitrag zur Praxis leisten, indem sie mögliche Bewältigungsstrategien und Bedingungen für den Einsatz des Ansatzes erörtert.
- Definition und Charakteristika von Bullying
- Der „No Blame Approach“ als Interventionsstrategie
- Chancen und Herausforderungen des „No Blame Approach“ in der Praxis
- Mögliche Bewältigungsstrategien und Bedingungen für den Einsatz des Ansatzes
- Kritische Reflexion des Ansatzes und seiner Grenzen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Mobbings ein und beleuchtet die aktuelle Relevanz des Themas. Sie verdeutlicht die Notwendigkeit von effektiven Präventions- und Interventionsstrategien. Anschließend werden die Zielsetzung und der Aufbau der Arbeit erläutert.
Kapitel 2 widmet sich dem Thema Bullying als System. Es werden die verschiedenen Definitionen von Bullying beleuchtet, insbesondere die Definition von Dan Olweus, die als einflussreichste Definition gilt. Zudem werden die unterschiedlichen Formen von Bullying, die Dynamik des Bullying-Systems und die Bedeutung von Bullying-Signalen beleuchtet.
Kapitel 3 befasst sich mit dem „No Blame Approach“. Es werden die Herkunft des Ansatzes, seine zentralen Prinzipien, die Vorgehensweise und der aktuelle Forschungsstand dargestellt. Die Diskussion der Chancen und Schwierigkeiten des Ansatzes für die Praxis soll Aufschluss über die Realisierbarkeit des Ansatzes in Schulen geben.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Bullying, Mobbing, „No Blame Approach“, Interventionsstrategie, Prävention, Schule, Praxis, Chancen, Grenzen, Bewältigungsstrategien, Bedingungen für den Einsatz.
- Quote paper
- Melina Wiese (Author), 2019, Chancen und Grenzen des "No Blame Approach" als Maßnahme gegen Bullying, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/496692