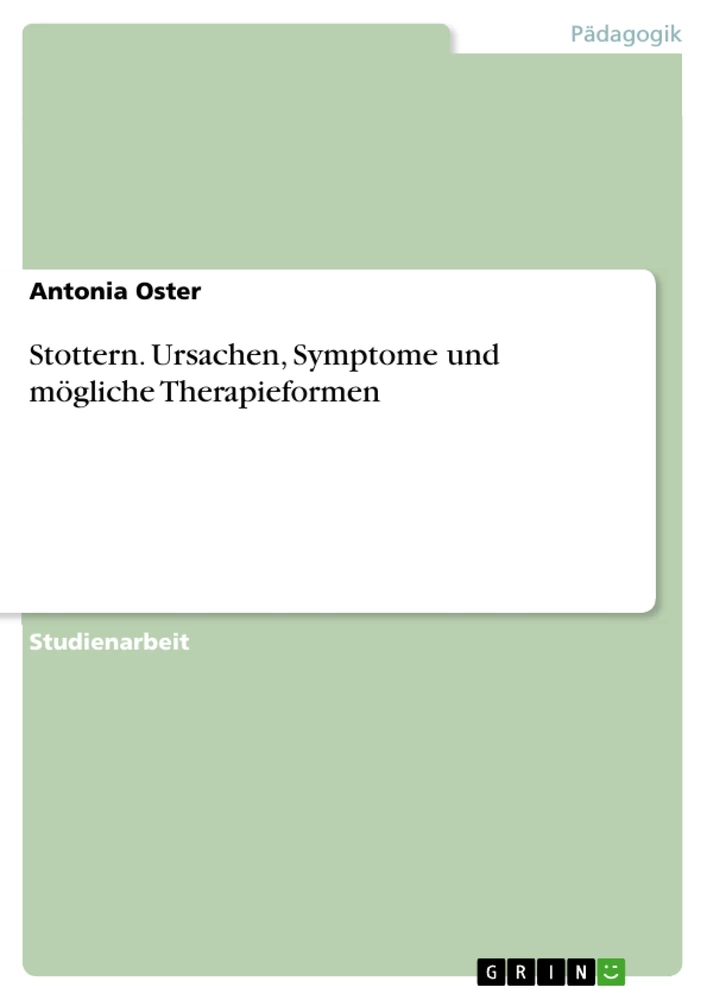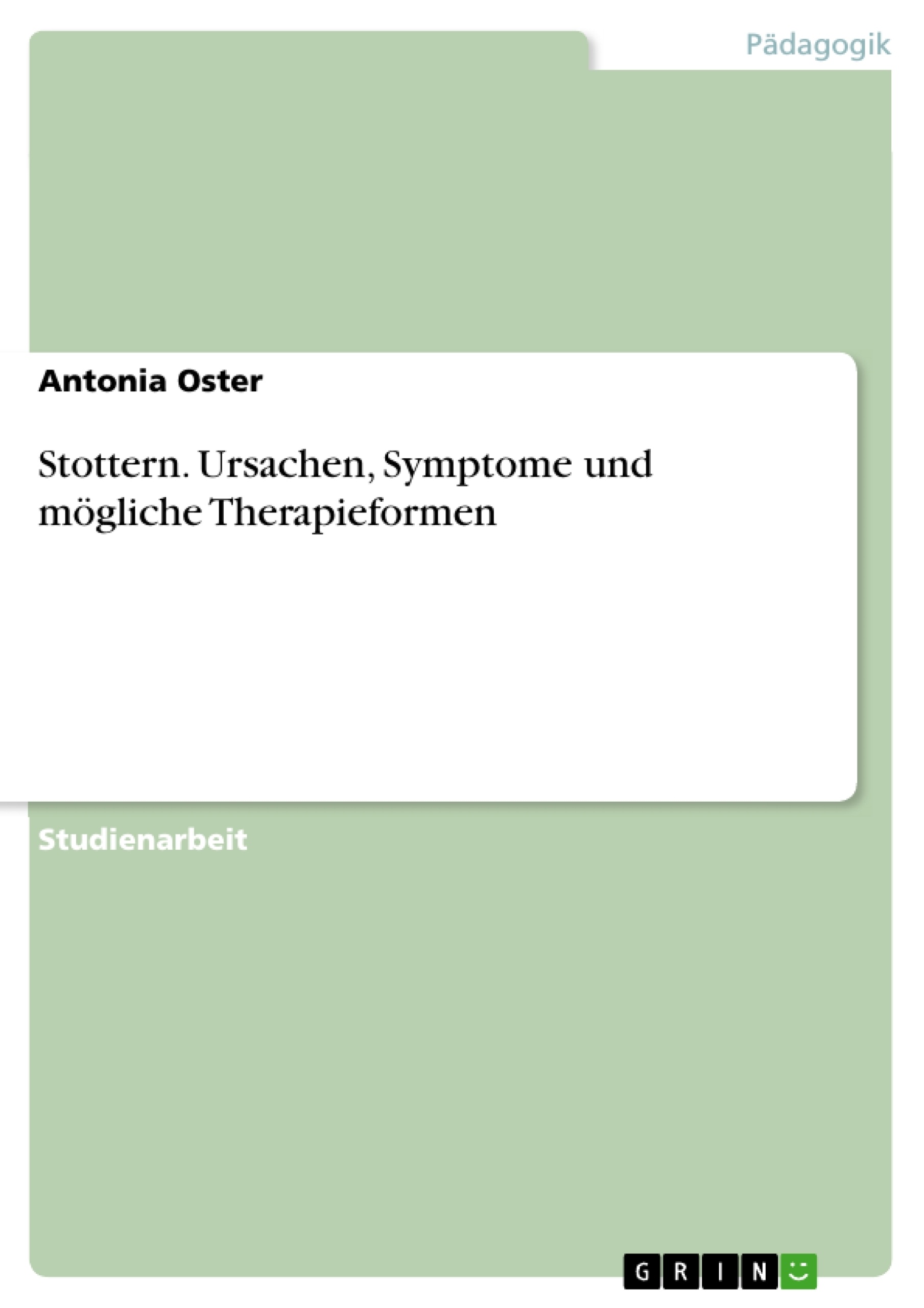Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Leitfrage: "Was ist Stottern und welche möglichen Therapieformen gibt es für Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren?". Um diese zu beantworten, wird zunächst die Redeflussstörung Stottern definiert. Im nächsten Kapitel geht es um die Ursachen des Stotterns. Hier wird in Vererbung und in psychische Ursachen unterschieden.
Das vierte Kapitel befasst sich mit den Symptomen, welche sich in Kern- und Begleitsymptome aufteilen. Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit dem Thema"Stotterndes Kind in der Kita". Hier werden verschiedene Ideen aufgezeigt, wie die Erziehenden sich Verhalten sollten, wenn sie ein stotterndes Kind in ihrer Gruppe haben. Zudem werden Anregungen geschaffen, wie man dieses Thema in der Gruppe aufgreifen kann, um dem stotternden Kind den Alltag in der Kita zu erleichtern.
Des Weiteren wird auch die Elternarbeit aufgegriffen, wo es wichtig ist, einen guten Austausch zwischen den Eltern und den Erziehenden zu schaffen. Außerdem wird hier die Notwendigkeit der elterlichen Kooperation während der Therapie des Kindes thematisiert und welche Probleme dabei entstehen könnten. Im letzten Kapitel werden verschiedene Therapieformen thematisiert: Zum einen der Fluency Shaping Ansatz und zum andern als Vergleich dazu die Stottermodifikation. Zudem wird hier der von Schneider und Sandrieser entwickelte Ansatz KIDS näher beschrieben, der ab einem Alter von zwei Jahren beginnt.
Stottern ist eine Störung der Kommunikation und des Redeflusses und tritt meistens im Alter zwischen drei und sechs Jahren das erste Mal auf. Das Elternhaus aber auch die Kindertagesstätten tragen eine große Verantwortung für die sprachliche Entwicklung des stotternden Kindes. Heutzutage gibt es auch schon für Kinder ab zwei Jahren die Möglichkeiten einer Therapie. Dementsprechend sollten sprachliche Auffälligkeiten so früh wie möglich erfasst werden, damit diese noch vor Schuleintritt behandelt werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition
- Ursachen des Stotterns
- Vererbung
- Psychische Ursachen
- Symptome
- Kernsymptome
- Begleitsymptome
- Coping Strategien
- Stotterndes Kind in der KiTa
- Verhalten der Erziehenden
- Elternarbeit
- Mögliche Therapieformen und Diagnostik
- Diagnostik
- Fluency shaping
- Stottermodifikation
- KIDS
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen des Stotterns bei Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren. Der Fokus liegt auf der Definition der Störung, der Analyse der Ursachen sowie der Vorstellung verschiedener Therapieformen. Im Besonderen werden die Auswirkungen des Stotterns auf das Kind in der Kindertagesstätte und die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erziehenden beleuchtet.
- Definition und Charakterisierung von Stottern
- Ursachenforschung: Genetische und psychologische Faktoren
- Symptome des Stotterns: Kern- und Begleitsymptome
- Das stotternde Kind in der KiTa: Interaktion mit Erziehenden und Eltern
- Mögliche Therapieformen: Fluency Shaping, Stottermodifikation, KIDS
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit führt in das Thema Stottern ein, definiert die Problemstellung und stellt die Leitfrage vor. Außerdem werden die behandelten Kapitel und deren Inhalte kurz zusammengefasst.
- Definition: Das Kapitel definiert Stottern als eine Störung der Sprechflüssigkeit, die durch unfreiwillige Blockierungen, Verlängerungen und Wiederholungen von Lauten, Silben oder Wörtern gekennzeichnet ist. Es wird auch auf die Unterscheidung zwischen Entwicklungsstottern und chronischem Stottern eingegangen.
- Ursachen des Stotterns: Dieses Kapitel beleuchtet die Ursachen von Stottern und stellt die Thesen der genetischen Veranlagung und der psychischen Faktoren dar. Die Rolle der elterlichen Reaktion auf die Sprechunflüssigkeiten wird diskutiert.
- Symptome: Hier werden die typischen Symptome des Stotterns, wie z.B. Wiederholungen, Dehnungen und Blockaden, beschrieben. Die Unterscheidung zwischen inneren und äußeren Symptomen wird erläutert.
- Stotterndes Kind in der KiTa: Das Kapitel fokussiert auf das Verhalten der Erziehenden gegenüber stotternden Kindern und die Bedeutung der Elternarbeit. Es werden verschiedene Ideen und Anregungen zur Unterstützung des stotternden Kindes im Kita-Alltag präsentiert.
- Mögliche Therapieformen und Diagnostik: Dieses Kapitel stellt verschiedene Therapieformen für Stottern vor, darunter Fluency Shaping, Stottermodifikation und der KIDS-Ansatz. Die Bedeutung der Diagnostik wird ebenfalls hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Stottern, Redeflussstörung, Sprechflüssigkeit, Entwicklungsstottern, chronisches Stottern, Vererbung, psychische Ursachen, Symptome, Kernsymptome, Begleitsymptome, Coping Strategien, Kindertagesstätte, Erzieherverhalten, Elternarbeit, Therapieformen, Fluency Shaping, Stottermodifikation, KIDS.
- Quote paper
- Antonia Oster (Author), 2019, Stottern. Ursachen, Symptome und mögliche Therapieformen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/496588