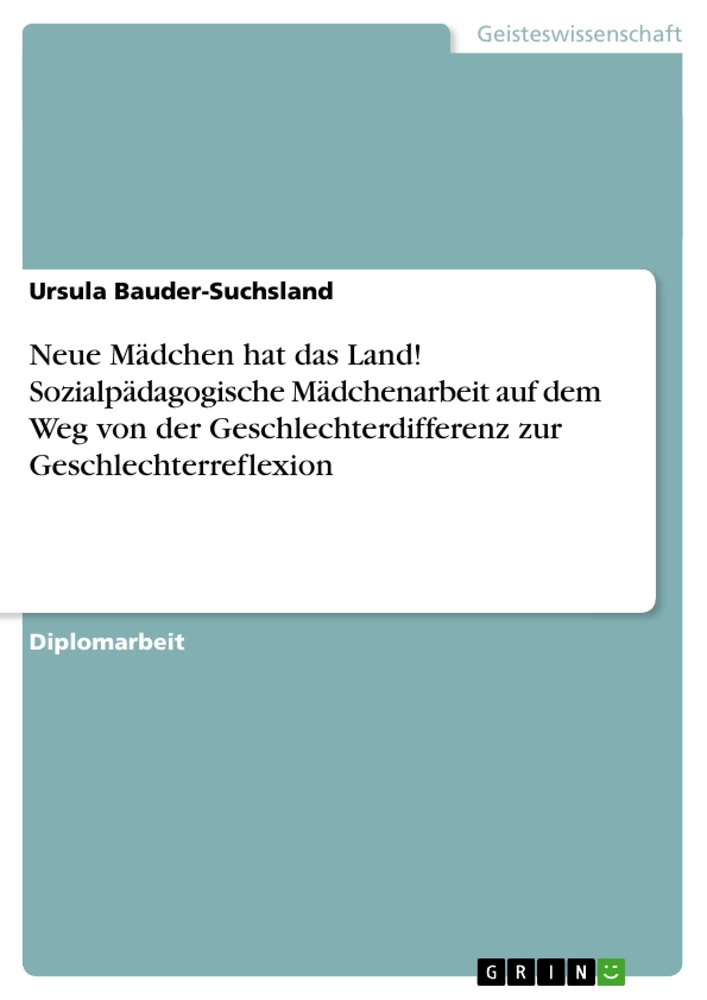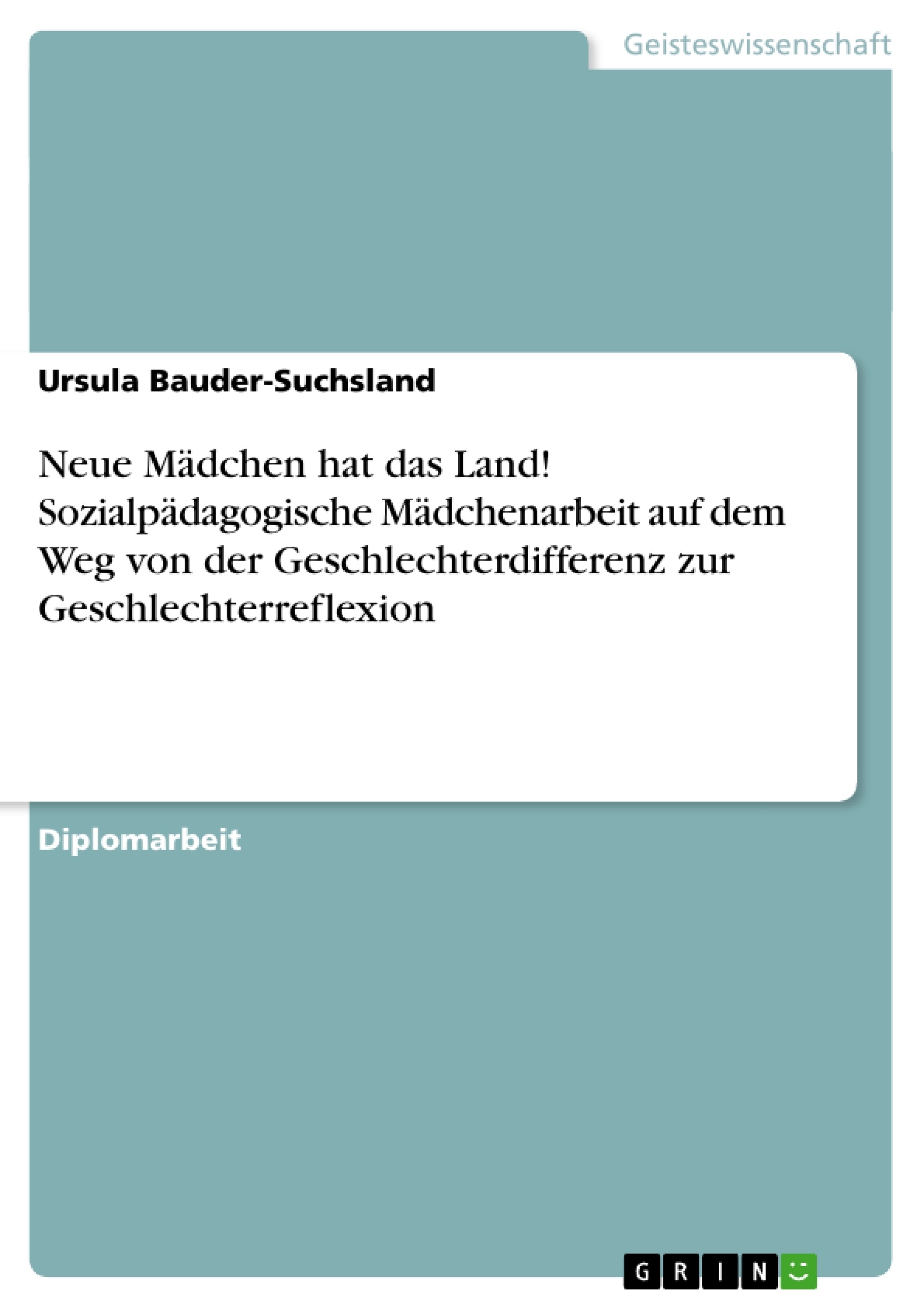"Feminismus, Quote und Frauenbeauftragte - All dies halten junge Frauen für steinzeitlich. Sie sind frei. Die Töchter der Frauenbewegung lassen sich von keinem Mann etwas vorschreiben. "Sexy" ist für eine Studentin, die ein Auslandsstipendium in der Tasche hat, kein Schimpfwort. Soweit die Eliten. Für die weibliche Unterschicht haben sich schon die Traditionsfeministinnen der 70er Jahre nie sehr interessiert; heute hat sie erst recht keine Lobby."
Diese provokante Aussage von Susanne Gaschke war der Ausgangspunkt einer Diskussion im Rahmen der ZEIT-Serie "Was haben die Frauen in Deutschland erreicht?". Die 28-jährige Schriftstellerin Jana Hensel hält in der gleichen Ausgabe der ZEIT den Erfolg der Emanzipation für ein Märchen und klagt an, dass in Zeitschriften und Büchern für Frauen ein Rollenverständnis von vorgestern propagiert würde. Gerade die mediale Festschreibung von absolut traditionellen Rollenmustern hält sie für eine wesentliche Grundlage für das breite Desinteresse von gerade jungen Frauen an feministischen Themen. Sie fordert "eine Rückgewinnung des Bewusstseins". weiblichen Die Fragen nach Unabhängigkeit und Gleichberechtigung junger Frauen müssen aus ihrer Sicht entsprechend beantwortet werden, um zu verhindern, "wie eine Mädchengeneration nach der anderen, darin ungeschult und ungeübten Verstandes, in erschreckender Zahl an den wichtigen Punkten scheitert." Die durchweg von jungen Frauen auf diesen Artikel hin verfassten Leserbriefe konnten Hensels Klage nicht nachvollziehen. So schrieb die Völkerrechtlerin und Schriftstellerin Juli Zeh unter der Überschrift "Lieber Wellness als Karriere? Dann lassen wir sie doch" in ihrer Stellungnahme: "Alle meine Freundinnen arbeiten oder nicht, haben Kinder oder nicht, einen Freund oder Ehemann oder eben nicht - und keine von ihnen fühlt sich unterdrückt, diskriminiert und von der BRIGITTE gehirngewaschen."
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Mädchenarbeit in der Tradition der Feministischen Theorien
- Kurze Entstehungsgeschichte
- Zentrale, handlungsleitende Begriffe der außerschulischen Mädchenarbeit
- Prinzipien der außerschulischen Mädchenarbeit
- Gender Mainstreaming in der Jugendarbeit
- Konstruktion und Dekonstruktion von Geschlecht
- Die soziale Konstruktion von Zweigeschlechtlichkeit
- Dekonstruktion von Geschlecht
- Die Lebenswelt der Mädchen heute
- Wissenschaftliche Ergebnisse zur Lebenssituation von Mädchen
- Schule und Bildung
- Familienorientierung
- Werteorientierung
- Politik und soziales Engagement
- Selbstzufriedenheit
- "Modernisierte Mädchenwelten"
- Weibliches Selbstvertrauen
- Weibliche Bewältigungsstrategien
- Wissenschaftliche Ergebnisse zur Lebenssituation von Mädchen
- Das Verhältnis von Theorie und Praxis
- Der geforderte Paradigmenwechsel
- Neue Mädchen - alte Konzepte?
- Kritische Betrachtung der gängigen Mädchenarbeit
- Kritische Betrachtung der dekonstruktivistischen Denkweise
- Möglichkeiten und Notwendigkeiten für eine veränderte Mädchenarbeit
- Erwartungen der Mädchen
- Erwartungen an die (Sozial) Pädagoginnen
- Der geforderte Paradigmenwechsel
- Ausblick: Mädchenarbeit ist auf dem Weg!
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit widmet sich der Analyse der sozialpädagogischen Mädchenarbeit und ihrer Weiterentwicklung im Kontext der heutigen Gesellschaft. Ziel ist es, den Weg von der traditionellen geschlechterdifferenzierten Mädchenarbeit hin zu einer geschlechterreflektierten Praxis aufzuzeigen. Dabei werden die Lebenswelten junger Mädchen, die Relevanz feministischer Theorien sowie die Herausforderungen und Möglichkeiten für eine zeitgemäße Mädchenarbeit beleuchtet.
- Die Entwicklung und die zentralen Prinzipien der außerschulischen Mädchenarbeit
- Die Lebenswelten junger Mädchen und ihre Herausforderungen in der heutigen Gesellschaft
- Die Relevanz feministischer Theorien für die Gestaltung sozialpädagogischer Mädchenarbeit
- Die Notwendigkeit und Möglichkeiten einer geschlechterreflektierten Mädchenarbeit
- Die Bedeutung von Gender Mainstreaming in der Jugendarbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung der Arbeit beleuchtet den Ausgangspunkt der Diskussion über die Relevanz von Mädchenarbeit im Kontext des Wertewandels und der modernen Lebenssituation von Mädchen. Im zweiten Kapitel werden die Wurzeln der Mädchenarbeit in der feministischen Theorie sowie die wichtigsten handlungsleitenden Begriffe und Prinzipien der außerschulischen Mädchenarbeit erläutert. Dabei wird auch die Bedeutung der Konstruktion und Dekonstruktion von Geschlecht für die pädagogische Praxis aufgezeigt.
Das dritte Kapitel beleuchtet die Lebenswelten von Mädchen in der heutigen Zeit anhand wissenschaftlicher Studien. Es werden Themen wie Schule und Bildung, Familienorientierung, Werteorientierung, Politik und soziales Engagement sowie die Selbstzufriedenheit von Mädchen betrachtet. Der Fokus liegt auf der Analyse der "modernisierten Mädchenwelten" und der Herausforderungen, denen Mädchen in ihrem Lebensalltag begegnen.
Kapitel vier untersucht das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis in der Mädchenarbeit. Es werden die Forderungen nach einem Paradigmenwechsel in der Mädchenarbeit und die Kritik an traditionellen Konzepten sowie an dekonstruktivistischen Denkweisen diskutiert. Es werden Möglichkeiten und Notwendigkeiten für eine veränderte Mädchenarbeit aufgezeigt, die den Erwartungen von Mädchen und den Anforderungen an (Sozial-)Pädagoginnen gerecht wird.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Themen wie Mädchenarbeit, Feminismus, Gender Mainstreaming, Geschlechterrollen, Lebenswelten von Mädchen, Sozialpädagogik, Jugendstudien, wissenschaftliche Ergebnisse, Praxisbezug, Paradigmenwechsel, dekonstruktivistische Denkweisen, Erwartungen von Mädchen, (Sozial-)Pädagoginnen, und aktuelle gesellschaftliche Veränderungen.
- Quote paper
- Ursula Bauder-Suchsland (Author), 2005, Neue Mädchen hat das Land! Sozialpädagogische Mädchenarbeit auf dem Weg von der Geschlechterdifferenz zur Geschlechterreflexion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49635