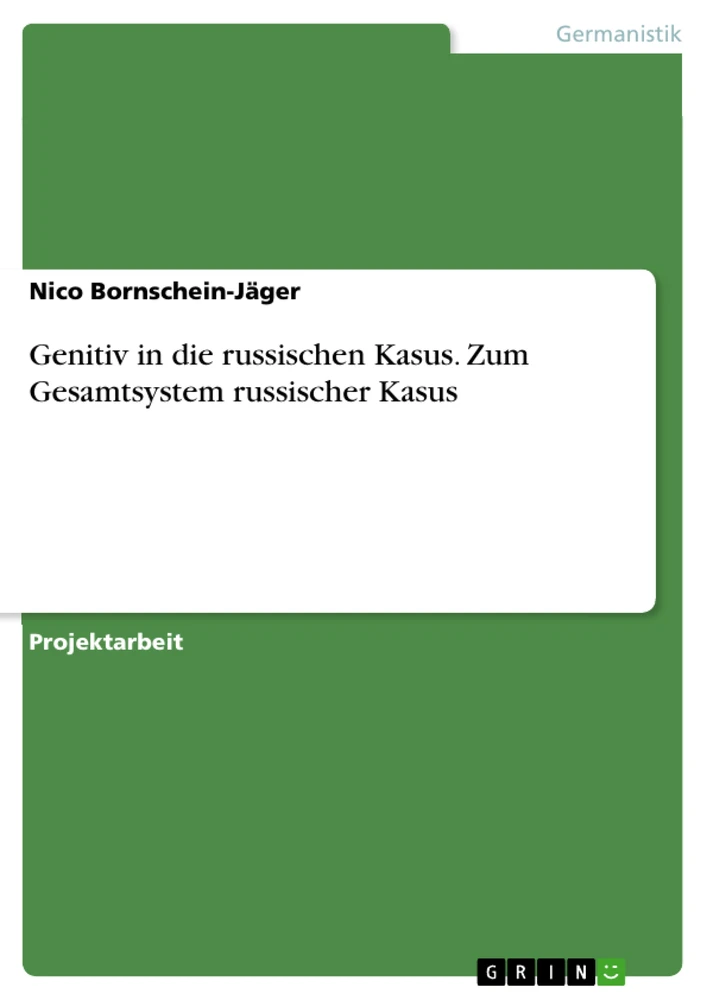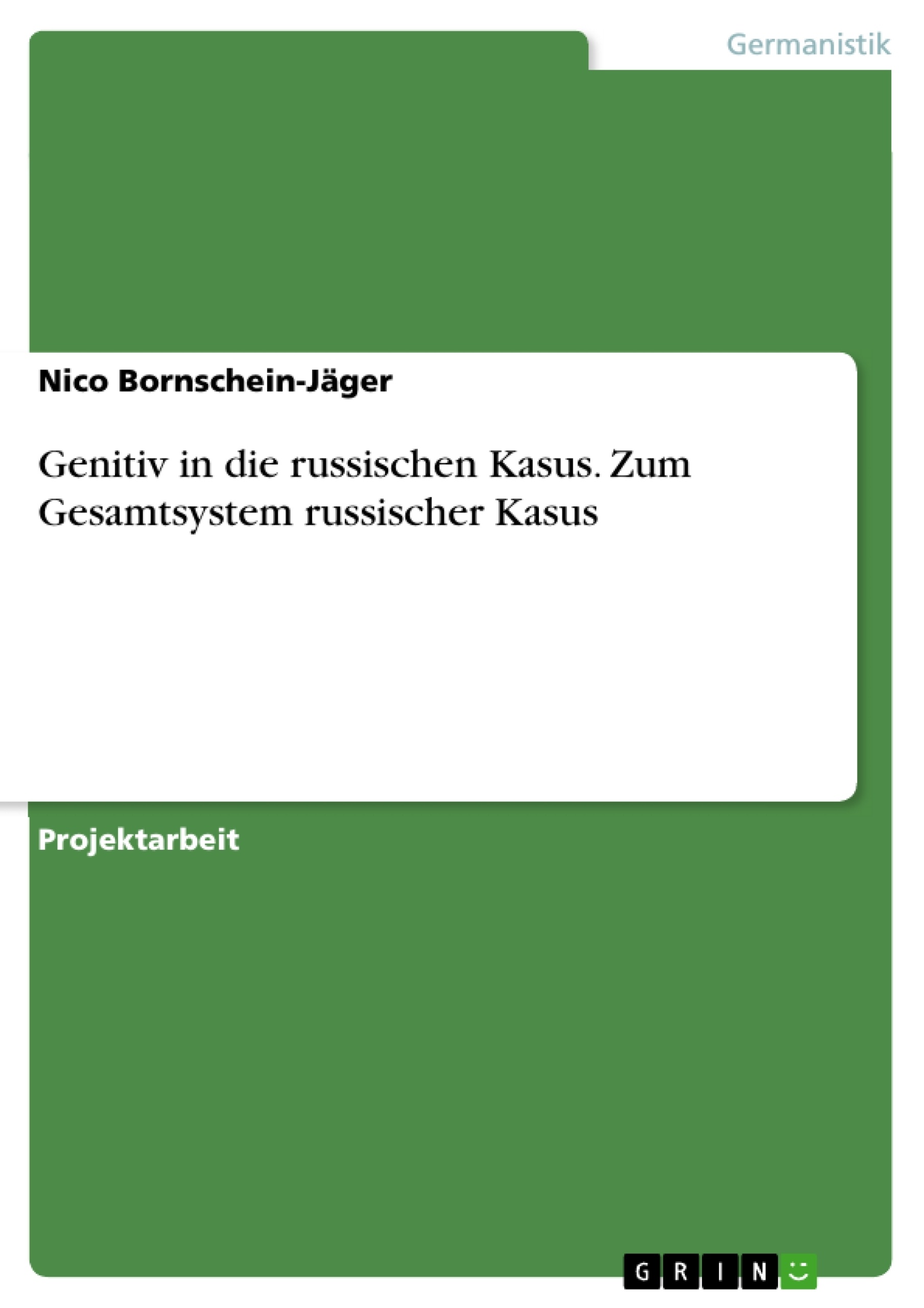Zur Klärung des Kasusbegriffs notiert noch heute das Lexikon der Sprachwissenschaft
(2008: 321f) unter weiterführender Literatur Roman Jakobson. In seinem Beitrag zur
allgemeinen Kasuslehre (1936) nimmt er sich den Gesamtbedeutungen der russischen
Kasus an, die noch heute für die Kasusforschung tragend sind. Der russischen
grammatischen Tradition folgend beginnt er mit dem Akkusativ, erläutert dann den
Nominativ, grenzt beide anschließend vom Genitiv, Instrumental, Dativ und Lokativ ab
und ordnet alle besprochenen Kasus schließlich in ein Gesamtsystem ein, anhand dessen
er abschließend die Deklination bespricht. Sie bleibt wegen der Sprachbarriere in dieser
Projektarbeit außen vor.
Jakobsons Beitrag muss mit Vorbehalt rezipiert werden: Die Verständlichkeit der
sehr vielschichtigen Ausführungen leidet an manchen Stellen, nämlich dort, wo die
Übersetzungen der russischen Beispiele zwar deren Sinn in ihrer deutschen Übertragung
behalten haben, aber der besprochene Kasus nicht mehr zu erkennen oder nicht mehr
nachzuvollziehen ist. Solche Beispiele sind mit der Hilfe von Dariya Rafiyenko
kommentiert, der ich an dieser Stelle sehr herzlich danke.
Dessen ungeachtet aber fallen immer wieder Überschneidungen mit der Pragmatik
auf, die der Kasusgrammatik näher zu sein scheint, als anzunehmen ist.
Inhaltsverzeichnis
0. Einleitung
1. Kasus im Russischen
1.1 Akkusativ
1.1.1 Stark regierter Akkusativ
1.1.2 Schwach regierter Akkusativ
1.2 Nominativ
1.2.1 Doppelter Nominativ
1.3 Genitiv
1.3.1 als partitiver Genitiv
1.3.2 negativ vertreten
1.3.3 Subjektgenitiv
1.3.4 Adverbaler Genitiv
1.3.5 Genitiv bei Adjektiven
1.3.6 Genitiv bei Fürwörtern
1.3.7 Adnominaler Genitiv
1.4 Instrumental
1.4.1 Instrumental der Bedingung
1.4.2 Instrumental der Einschränkung
1.4.3 Instrumental der Betätigung
1.5 Dativ
1.5.1 Dativ der unmittelbaren reflexiven Bestimmung
1.5.2 Dativus ethicus
1.5.3 Der präpositionslose Dativ
1.6 Lokativ
2. Das Gesamtsystem der russischen Kasus
3. Besprechung
4. Fazit und Ausblick
Literatur
0. Einleitung
Zur Klärung des Kasusbegriffs notiert noch heute das Lexikon der Sprachwissenschaft (2008: 321f) unter weiterführender Literatur Roman Jakobson. In seinem Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre (1936) nimmt er sich den Gesamtbedeutungen der russischen Kasus an, die noch heute für die Kasusforschung tragend sind. Der russischen grammatischen Tradition folgend beginnt er mit dem Akkusativ, erläutert dann den Nominativ, grenzt beide anschließend vom Genitiv, Instrumental, Dativ und Lokativ ab und ordnet alle besprochenen Kasus schließlich in ein Gesamtsystem ein, anhand dessen er abschließend die Deklination bespricht. Sie bleibt wegen der Sprachbarriere in dieser Projektarbeit außen vor.
Jakobsons Beitrag muss mit Vorbehalt rezipiert werden: Die Verständlichkeit der sehr vielschichtigen Ausführungen leidet an manchen Stellen, nämlich dort, wo die Übersetzungen der russischen Beispiele zwar deren Sinn in ihrer deutschen Übertragung behalten haben, aber der besprochene Kasus nicht mehr zu erkennen oder nicht mehr nachzuvollziehen ist. Solche Beispiele sind mit der Hilfe von Dariya Rafiyenko kommentiert, der ich an dieser Stelle sehr herzlich danke.
Dessen ungeachtet aber fallen immer wieder Überschneidungen mit der Pragmatik auf, die der Kasusgrammatik näher zu sein scheint, als anzunehmen ist.
1. Kasus im Russischen
1.1 Akkusativ
Der Akkusativ, so Jakobson, nenne den Bezugsgegenstand und besage, dass auf diesen irgendeine Handlung gerichtet sei. Die Bedeutung des Akkusativs sei so eng und unmittelbar mit der Handlung verbunden, dass er ausschließlich von einem Verb regiert werden könne. Sein selbstständiger Gebrauch lasse immer ein ausgelassenes oder hinzugedachtes Verb empfinden (I). Er kennzeichne also die Betroffenheit durch eine Handlung und sei damit ein merkmalhaltiges Glied einer Bezugskorrelation. Der Akkusativ sei ein Vollkasus, gebe als solcher den zentralen Inhalt der Aussage an und sei Träger des unbelebten Gegenstands.
(I) karetu!, den Wagen (1936: 31)
Jakobson unterscheidet zwischen stark regiertem und schwach regiertem Akkusativ (31f).
1.1.1 Stark regierter Akkusativ
Der stark regierte Akkusativ bezeichne ein inneres Objekt (II), welches als ihr Ergebnis entstehe oder ein äußeres Objekt einer Handlung (III), das einer Wirkung von außen unterworfen sei, aber auch unabhängig von ihr bestehe.
(II) pisatʼ pisʼmo, einen Brief schreiben
(III) čitatʼ knigu, ein Buch lesen (Jakobson, 1936: 31)
1.1.2 Schwach regierter Akkusativ
Der schwach regierte Akkusativ bezeichne einen Raum- oder Zeitabschnitt, der von der Handlung komplett umfasst sei (IV) oder den objektiven Inhalt der Äußerung (V) bezeichne.
(IV) žit god, ein Jahr leben
(V) stoitʼ denʼgi, Geld kosten (Jakobson, 1936: 31)
Beispiel (V) gilt heute als nicht grammatisch oder veraltet. Heute würde „Geld kosten“ mit der Genitivwendung stoitj deneg übersetzt werden.
Der Unterschied des schwach regierten Akkusativs zum stark regierten bestehe im Wesentlichen darin, dass sein Inhalt zu abstrakt gegenüber der Handlung sei, sodass er zwischen der Funktion eines Objekts und der eines Umstands der Handlung schwanke.
1.2 Nominativ
Der Nominativ sei traditionell als der Kasus charakterisiert, der das handelnde Subjekt bezeichnet. Er sei ein Vollkasus und Träger des belebten Wesens. Der Nominativ sei also der Gegenstand der Aussage ohne die Bezüge, die durch andere Kasus hineingetragen werden. Er enthalte nur die Bedeutung des Nominalstammes, des Genus und des Numerus. Seine Funktion gehe also nicht über die des Nennens hinaus: Der Nominativ sei die Sprache der Schilder und Überschriften (VI). Er sei ein merkmalloser Kasus und stehe in Korrelation zum Akkusativ, der eine Hierarchie der Bedeutungen signalisiere. Seine Verwendung, so Jakobson, der hier eine Brücke zur Pragmatik schlägt, wirke sich auf die Perspektive der Aussage aus (VII), die bei gleicher Sachlage verschiedenen Bedeutungsgehalt spiegele.
(VI) buločnaja, Bäckerei (1936: 33)
(VII) Latvija sosedit s Èstoniej, Lettland ist mit Estland benachbart.
(VII‘) Èstonia sosedit s Latviej, Estland ist mit Lettland benachbart. (34)
1.2.1 Doppelter Nominativ
Beim Sonderfall des doppelten Nominativs lege erst die reelle Bedeutung der Nomina oder die Umgebung nahe, welche die determinierende und welche die determinierte Bedeutung sei:
(VIII) Onegin – dobryj moj prijatelʼ, Onegin ist mein guter Freund.
(IX) Onegin – dobryj moj prijatelʼ, rodiljsa na bregax Nevy, Onegin, mein guter Freund, ist an der Küste der Neva geboren (Jakobson, 1936: 34).
1.3 Genitiv
Der Genitiv, so Jakobson, kündige die Grenze der Teilnahme des bezeichneten Gegenstandes am Sachverhalt an. Er bezeichne also eine Umfangskorrelation. Als sogenannter Umfangskasus könne er...
1.3.1 … als partitiver Genitiv…
… teilweise vertreten sein und damit eine zeitliche oder räumliche Trennung feststellen, wie
(X) novostej, novostej!, welche Anzahl von Neuigkeiten (39), wobei heute a novostej-to, novostej als treffendere Übersetzung gilt, oder…
1.3.2 … negativ vertreten…
… sein. Hier bleibe dann der Gegenstand außerhalb des Sachverhalts der Aussage. Unter solchen negativ vertretenen Genitiven subsumiert Jakobson den Genitiv des Randes oder der Grenze (XI), den in (XII) schwer nachzuvollziehenden Genitiv des Zieles, den Genitiv der Trennung (XIII) und den Genitiv der Negation (XIV).
(XI) Odnoj nogoj kasajasʼ pola, mit einem Fuße den Boden berührend (1936: 40)
(XII) svobod xoteli vy, Freiheiten wolltet ihr (40f)
(XIII) izbežal vernoj gibeli, entging dem sicheren Verderben
(XIV) ne poj, krasavica, pri mne ty pesen Gruzii pečalʼ noj, singe nicht, du Schöne, in meiner Gegenwart die Lieder des traurigen Georgiens (41)
Die Genitive der Negation, der Grenze und des Ziels neigen, so Jakobson, zur Verwechslung mit dem Akkusativ. Von allen Genitiven sei der partitive von diesem am meisten distinktiv (XV). Ein Zusammenfallen des Akkusativs mit dem (partitiven) Genitiv sei ein Ausnahmefall und kündige die Belebtheit des bezeichneten Gegenstands an (XVI).
(XV) vypil vina, trank etwas Wein aus
(XV‘) vypil vino [A] trank den Wein aus
(XVI) otvedal kuricy, kostete vom Huhn (1936: 43)
1.3.3 Subjektgenitiv
Als Umfangskasus könne der Genitiv auch als Subjektgenitiv auftreten. (XVII) nužno spiček, es sind Streichhölzer nötig (Jakobson, 1936: 39)
1.3.4 Adverbaler Genitiv
Neben dem Subjektgenitiv bespricht Jakobson den adverbialen Genitiv, der als partitiver Objektgenitiv eine Quantitätsänderung bezeichnen (XVIII) oder mit perfektiven Verben die absolute Grenze der Handlung kennzeichnen könne (XIX).
(XVIII) pripuskaet ognja v lampe, Er macht die Flamme in der Lampe größer.
(XIXa) el xleb, aß Brot
(XIXb) bral denʼgi, nahm Geld (1936: 40)
El xleb (vgl. poel xleba [Gen]) und bral denʼgi gelten in heutigen russischen
Grammatiken als Akkusative.
Diesem adverbialen Genitiv ordnet Jakobson noch einmal die bereits oben besprochenen Genitive des Randes oder der Grenze, des Zieles, der Trennung und der Negation unter.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist ein umfassender Sprachüberblick über die russische Kasuslehre, basierend auf den Arbeiten von Roman Jakobson. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Einleitung und detaillierte Erklärungen zu den verschiedenen Kasus im Russischen, einschließlich Akkusativ, Nominativ, Genitiv, Instrumental, Dativ und Lokativ. Es werden auch Unterteilungen innerhalb dieser Kasus besprochen, wie z.B. stark und schwach regierter Akkusativ, partitiver und negierter Genitiv usw.
Was sind die Hauptthemen, die in der Einleitung behandelt werden?
Die Einleitung erwähnt Roman Jakobsons Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre und seine Analyse der Gesamtbedeutungen der russischen Kasus. Es wird auch auf mögliche Verständnisschwierigkeiten bei der Rezeption von Jakobsons Arbeit hingewiesen, insbesondere im Zusammenhang mit Übersetzungen. Die Verbindung zur Pragmatik wird ebenfalls kurz erwähnt.
Welche Kasus werden im Detail erläutert?
Das Dokument widmet eigene Abschnitte dem Akkusativ, Nominativ, Genitiv, Instrumental und Dativ, jeweils mit Unterpunkten, die verschiedene Aspekte und Funktionen des jeweiligen Kasus beleuchten.
Was wird über den Akkusativ gesagt?
Der Akkusativ wird als der Kasus beschrieben, der den Bezugsgegenstand einer Handlung nennt. Er wird in stark regierten (inneres und äußeres Objekt) und schwach regierten (Raum-, Zeitabschnitte, objektiver Inhalt der Äußerung) Akkusativ unterteilt.
Wie wird der Nominativ charakterisiert?
Der Nominativ wird als der Kasus charakterisiert, der das handelnde Subjekt bezeichnet und Träger des belebten Wesens ist. Er wird als merkmalloser Kasus beschrieben, der die Sprache der Schilder und Überschriften ist.
Was sind die verschiedenen Arten des Genitivs, die besprochen werden?
Es werden verschiedene Arten des Genitivs besprochen, darunter der partitive Genitiv, der negativ vertretene Genitiv (Genitiv des Randes, des Zieles, der Trennung, der Negation), der Subjektgenitiv und der adverbiale Genitiv.
Was wird im Zusammenhang mit dem Instrumental und Dativ erwähnt?
Der Instrumental wird im Zusammenhang mit Bedingung, Einschränkung und Betätigung genannt. Beim Dativ werden Dativ der unmittelbaren reflexiven Bestimmung, Dativus ethicus und der präpositionslose Dativ erwähnt.
Gibt es moderne Anmerkungen zu Jakobsons Thesen?
Ja, bei einigen Beispielen wird darauf hingewiesen, dass sie heute als veraltet oder nicht mehr grammatisch korrekt gelten. Es wird erwähnt, dass bestimmte Akkusativ-Konstruktionen heute eher mit dem Genitiv übersetzt würden.
Welche Rolle spielt Roman Jakobson in der Kasuslehre, wie in diesem Dokument dargestellt?
Roman Jakobson wird als zentrale Figur der Kasuslehre dargestellt, dessen Arbeit auch heute noch relevant ist. Das Dokument fasst seine Theorien zusammen und diskutiert sie kritisch.
- Quote paper
- Nico Bornschein-Jäger (Author), 2019, Genitiv in die russischen Kasus. Zum Gesamtsystem russischer Kasus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/496050