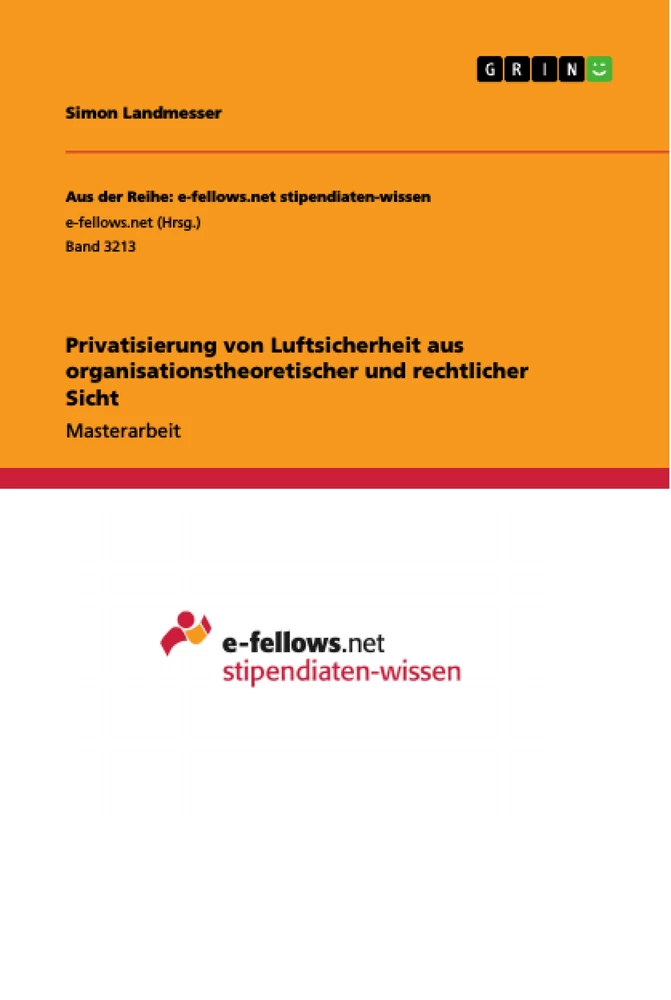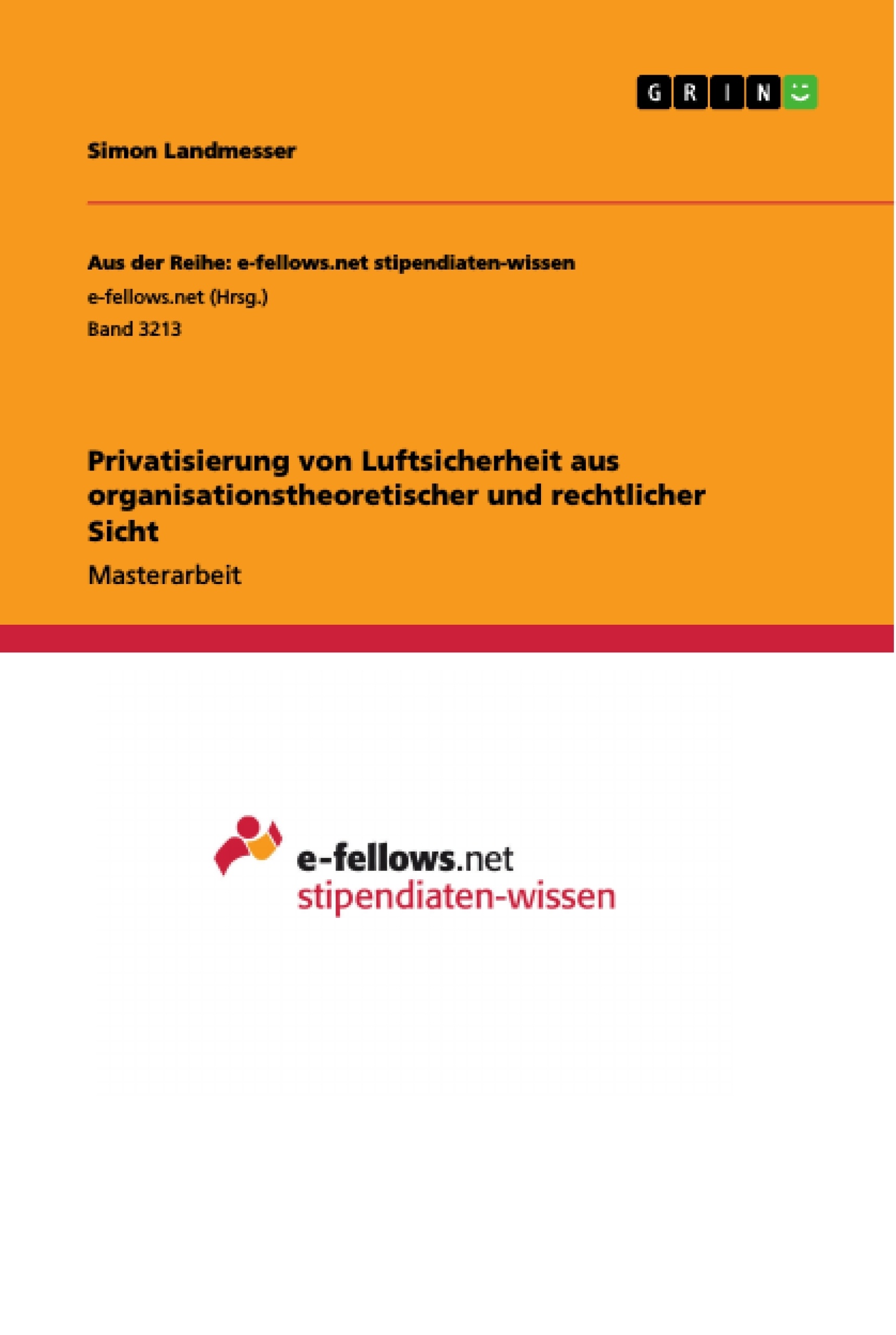Ziel dieser Arbeit ist es, folgende Forschungsfrage zu beantworten: Welche organisationstheoretischen und rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen der Privatisierung von Luftsicherheitskontrollen bestehen in Deutschland?
Die Gewährleistung der Luftsicherheit hat durch die Anschläge vom 11. September 2001 in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie durch weitere Eingriffe in den Luftverkehr in der Vergangenheit erheblich an Bedeutung gewonnen. Internationale, europäische und nationale Regelungen schreiben vor, dass sich alle Fluggäste vor Betreten des Sicherheitsbereiches eines Flughafens einer umfassenden Kontrolle unterziehen lassen müssen (vgl. VO (EG) Nr. 300/2008; §§ 2, 5 LuftSiG). Durch diese Fluggastkontrollen soll verhindert werden, dass verbotene Gegenstände in den Sicherheitsbereich eines Flughafens und in Luftfahrzeuge gebracht werden (Nr. 4.1, Anhang zu Art. 4 VO (EG) Nr. 300/2008). Für die Durchführung der Kontrollen ist in Deutschland die zuständige Luftsicherheitsbehörde verantwortlich. An den meisten Großflughäfen ist dies gem. § 4 BPolG i.V.m. § 2, 5 LuftSiG die Bundespolizei. An allen deutschen Großflughäfen werden die Fluggastkontrollen jedoch durch private Sicherheitsdienstleister durchgeführt. Diese Aufgabenübertragung erfolgt auf Grundlage von § 16a Abs. 1 Nr. 1 LuftSiG.
In der Vergangenheit geriet die Wahrnehmung dieser Aufgabe durch private Unternehmen immer wieder in Kritik. Diese Kritik betrifft einerseits die Kapazität der privaten Unternehmen und andererseits die Qualität der Kontrollen. So wurden bei vergangenen Qualitätskontrollen teils erhebliche Mängel festgestellt und gibt es immer wieder Berichte darüber, dass bei verdeckten Tests verbotene Gegenstände unerkannt durch die Kontrollen gebracht werden konnten.
Verschiedene Interessensvertreter fordern daher unterschiedlichste Lösungen, um Kapazität und Qualität der Fluggastkontrollen zu verbessern. Es gibt sowohl Forderungen nach einer Rückabwicklung der Privatisierung, als auch nach einer Verantwortungsübertragung auf die Flughafenbetreiber. Dabei besteht ein Konfliktfeld zwischen wirtschaftlich denkenden und handelnden Unternehmen einerseits und sicherheitsbedachter Luftsicherheitsbehörde andererseits.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Thematische Einführung und Problemdarstellung
- 1.2 Methodik
- 2 Begriffliche Einordnung
- 2.1 Privatisierung
- 2.1.1 Formelle Privatisierung
- 2.1.2 Funktionale Privatisierung
- 2.1.3 Materielle Privatisierung
- 2.2 Luftsicherheitsassistent - Beliehener
- 2.3 Neue Institutionenökonomik
- 2.3.1 Verfügungsrechtetheorie
- 2.3.2 Agenturtheorie
- 2.3.3 Transaktionskostentheorie
- 3 Modelle der Luftsicherheitskontrolle und organisationstheoretische Analyse
- 3.1 Aktuell: Beleihung des Sicherheitspersonals
- 3.1.1 Das Düsseldorfer Modell
- 3.1.2 Das Münchner Modell
- 3.1.3 Organisationstheoretischer Vergleich
- 3.2 Betrieb durch Flughafenbetreiber
- 3.2.1 Modellbeschreibung
- 3.2.2 Organisationstheoretische Analyse
- 3.3 Rückabwicklung der Privatisierung
- 3.3.1 Originäre Wahrnehmung durch Luftsicherheitsbehörde
- 3.3.2 Das SPD-Modell
- 3.3.3 Organisationstheoretischer Vergleich
- 3.4 Zwischenergebnis
- 4 Rechtshistorische Entwicklung der Luftsicherheitskontrollen
- 4.1 vor 2005: Luftverkehrsgesetz
- 4.2 2005 bis 2017: Luftsicherheitsgesetz „alte Fassung“
- 4.3 2017 bis heute: Luftsicherheitsgesetz „neue Fassung“
- 5 Verfassungsrechtliche Grenzen der Privatisierung
- 5.1 Gewaltmonopol des Staates
- 5.1.1 Inhalt und Reichweite des Gewaltmonopols
- 5.1.2 Privatisierungsgrenzen des Gewaltmonopols
- 5.1.3 Auswirkungen des staatlichen Gewaltmonopols auf die Privatisierung von Luftsicherheit
- 5.2 Schutzpflichten des Staates
- 5.2.1 Reichweite grundrechtlicher Schutzfunktion
- 5.2.2 Auswirkungen grundrechtlicher Schutzpflichten auf die Privatisierung von Luftsicherheit
- 5.3 Regel-Ausnahme-Verhältnis des Art. 33 Abs. 4 GG
- 5.3.1 Funktionsvorbehalt des Berufsbeamtentums
- 5.3.2 Auswirkungen des Art. 33 Abs. 4 GG auf die Privatisierung von Luftsicherheit
- 5.4 Zwischenergebnis
- 6 Organisationstheorie und Verfassungsrecht in Wechselbeziehung
- 6.1 Qualität als entscheidendes Element
- 6.2 Alternativlösung - Flughafenbetreiber als Beliehene oder Verwaltungshelfer?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Privatisierung von Luftsicherheit aus organisationstheoretischer und rechtlicher Perspektive. Ziel ist es, verschiedene Modelle der Luftsicherheitskontrolle zu analysieren und ihre Vor- und Nachteile im Hinblick auf Effizienz, Rechtmäßigkeit und Gewährleistung der Sicherheit zu bewerten.
- Organisationstheoretische Analyse verschiedener Privatisierungsmodelle
- Rechtskonformität der Privatisierung von Luftsicherheitsaufgaben
- Gewährleistung von Sicherheit und Qualität bei privater Luftsicherheitskontrolle
- Verfassungsrechtliche Grenzen der Privatisierung staatlicher Aufgaben
- Wechselwirkungen zwischen Organisationstheorie und Verfassungsrecht im Kontext der Luftsicherheit
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Privatisierung von Luftsicherheit ein und beschreibt das Problemfeld. Es skizziert die Methodik der Arbeit und die Forschungsfrage.
2 Begriffliche Einordnung: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe der Arbeit, insbesondere den Begriff der Privatisierung in seinen verschiedenen Ausprägungen (formell, funktional, materiell). Es wird der Begriff des Luftsicherheitsassistenten als Beliehener erläutert und die relevanten Theorien der Neuen Institutionenökonomik (Verfügungsrechtetheorie, Agenturtheorie, Transaktionskostentheorie) vorgestellt, die als analytisches Gerüst für die Untersuchung der verschiedenen Modelle dienen.
3 Modelle der Luftsicherheitskontrolle und organisationstheoretische Analyse: Hier werden verschiedene Modelle der Luftsicherheitskontrolle vorgestellt und organisationstheoretisch analysiert. Es werden das aktuelle Modell der Beleihung des Sicherheitspersonals (mit den Beispielen Düsseldorf und München), das Modell des Betriebs durch Flughafenbetreiber und ein Modell der Rückabwicklung der Privatisierung untersucht. Die Analyse umfasst einen Vergleich der Modelle hinsichtlich ihrer Effizienz und potenziellen Risiken.
4 Rechtshistorische Entwicklung der Luftsicherheitskontrollen: Dieses Kapitel beleuchtet die rechtliche Entwicklung der Luftsicherheitskontrollen von vor 2005 (Luftverkehrsgesetz) über die Zeit von 2005 bis 2017 (Luftsicherheitsgesetz „alte Fassung“) bis zum aktuellen Luftsicherheitsgesetz (2017 bis heute). Der Fokus liegt auf der Veränderung der rechtlichen Rahmenbedingungen für die Privatisierung der Luftsicherheit.
5 Verfassungsrechtliche Grenzen der Privatisierung: Dieses Kapitel befasst sich mit den verfassungsrechtlichen Aspekten der Privatisierung von Luftsicherheitsaufgaben. Es analysiert das staatliche Gewaltmonopol und die daraus resultierenden Grenzen der Privatisierung sowie die Schutzpflichten des Staates und den Funktionsvorbehalt des Berufsbeamtentums im Kontext der Luftsicherheit. Es wird untersucht, inwieweit die Privatisierung mit den Grundrechten vereinbar ist.
6 Organisationstheorie und Verfassungsrecht in Wechselbeziehung: Dieses Kapitel verbindet die organisationstheoretischen und verfassungsrechtlichen Aspekte der Arbeit. Es wird die Bedeutung von Qualität in der Luftsicherheit betont und eine mögliche Alternativlösung – die Einbindung von Flughafenbetreibern als Beliehene oder Verwaltungshelfer – diskutiert. Die Kapitel analysiert die Interdependenzen und Spannungsfelder zwischen den beiden Betrachtungsebenen.
Schlüsselwörter
Privatisierung, Luftsicherheit, Organisationstheorie, Neue Institutionenökonomik, Verfassungsrecht, Gewaltmonopol, Schutzpflichten des Staates, Berufsbeamtentum, Luftsicherheitsgesetz, Effizienz, Sicherheit, Qualität.
FAQ: Masterarbeit zur Privatisierung der Luftsicherheit
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Privatisierung der Luftsicherheit aus organisationstheoretischer und rechtlicher Perspektive. Sie analysiert verschiedene Modelle der Luftsicherheitskontrolle und bewertet deren Vor- und Nachteile hinsichtlich Effizienz, Rechtmäßigkeit und Sicherheitsgewährleistung.
Welche Modelle der Luftsicherheitskontrolle werden untersucht?
Die Arbeit analysiert das aktuelle Modell der Beleihung des Sicherheitspersonals (mit den Beispielen Düsseldorf und München), das Modell des Betriebs durch Flughafenbetreiber und ein Modell der Rückabwicklung der Privatisierung. Jedes Modell wird organisationstheoretisch untersucht und verglichen.
Welche organisationstheoretischen Ansätze werden verwendet?
Die Analyse stützt sich auf die Neue Institutionenökonomik, insbesondere die Verfügungsrechtetheorie, die Agenturtheorie und die Transaktionskostentheorie. Diese Theorien dienen als analytisches Gerüst zur Untersuchung der verschiedenen Privatisierungsmodelle.
Welche verfassungsrechtlichen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht das staatliche Gewaltmonopol und die daraus resultierenden Grenzen der Privatisierung. Sie analysiert die Schutzpflichten des Staates und den Funktionsvorbehalt des Berufsbeamtentums (Art. 33 Abs. 4 GG) im Kontext der Luftsicherheit und deren Vereinbarkeit mit der Privatisierung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Begriffliche Einordnung, Modelle der Luftsicherheitskontrolle und organisationstheoretische Analyse, Rechtshistorische Entwicklung der Luftsicherheitskontrollen, Verfassungsrechtliche Grenzen der Privatisierung und Organisationstheorie und Verfassungsrecht in Wechselbeziehung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Thematik.
Welche Rechtsquellen werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf das Luftverkehrsgesetz (vor 2005), das Luftsicherheitsgesetz „alte Fassung“ (2005-2017) und das Luftsicherheitsgesetz „neue Fassung“ (2017 bis heute). Sie analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Privatisierung der Luftsicherheit im Laufe der Zeit.
Was sind die zentralen Forschungsfragen?
Die Arbeit zielt darauf ab, die verschiedenen Modelle der Luftsicherheitskontrolle hinsichtlich Effizienz, Rechtmäßigkeit und Sicherheitsgewährleistung zu bewerten und die verfassungsrechtlichen Grenzen der Privatisierung staatlicher Aufgaben im Bereich der Luftsicherheit zu untersuchen. Sie analysiert auch die Wechselwirkungen zwischen Organisationstheorie und Verfassungsrecht in diesem Kontext.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Privatisierung, Luftsicherheit, Organisationstheorie, Neue Institutionenökonomik, Verfassungsrecht, Gewaltmonopol, Schutzpflichten des Staates, Berufsbeamtentum, Luftsicherheitsgesetz, Effizienz, Sicherheit, Qualität.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit kommt zu Schlussfolgerungen über die Vor- und Nachteile verschiedener Privatisierungsmodelle und deren Vereinbarkeit mit dem Verfassungsrecht. Sie diskutiert mögliche Alternativen und betont die Bedeutung von Qualität und Sicherheit in der Luftsicherheitskontrolle.
- Quote paper
- Simon Landmesser (Author), 2019, Privatisierung von Luftsicherheit aus organisationstheoretischer und rechtlicher Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/495794