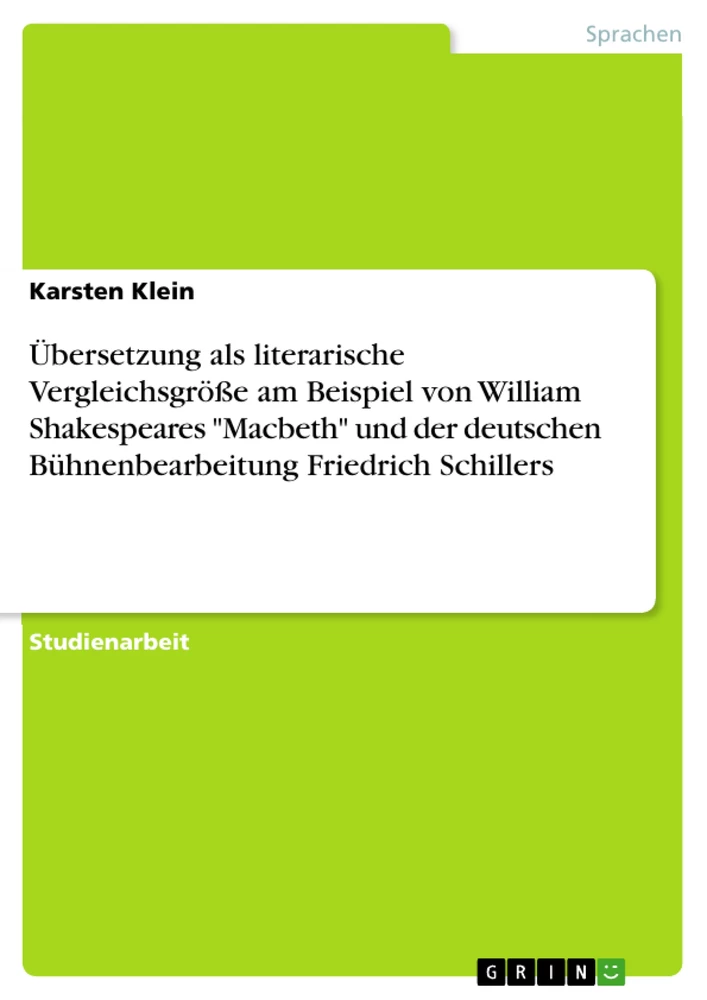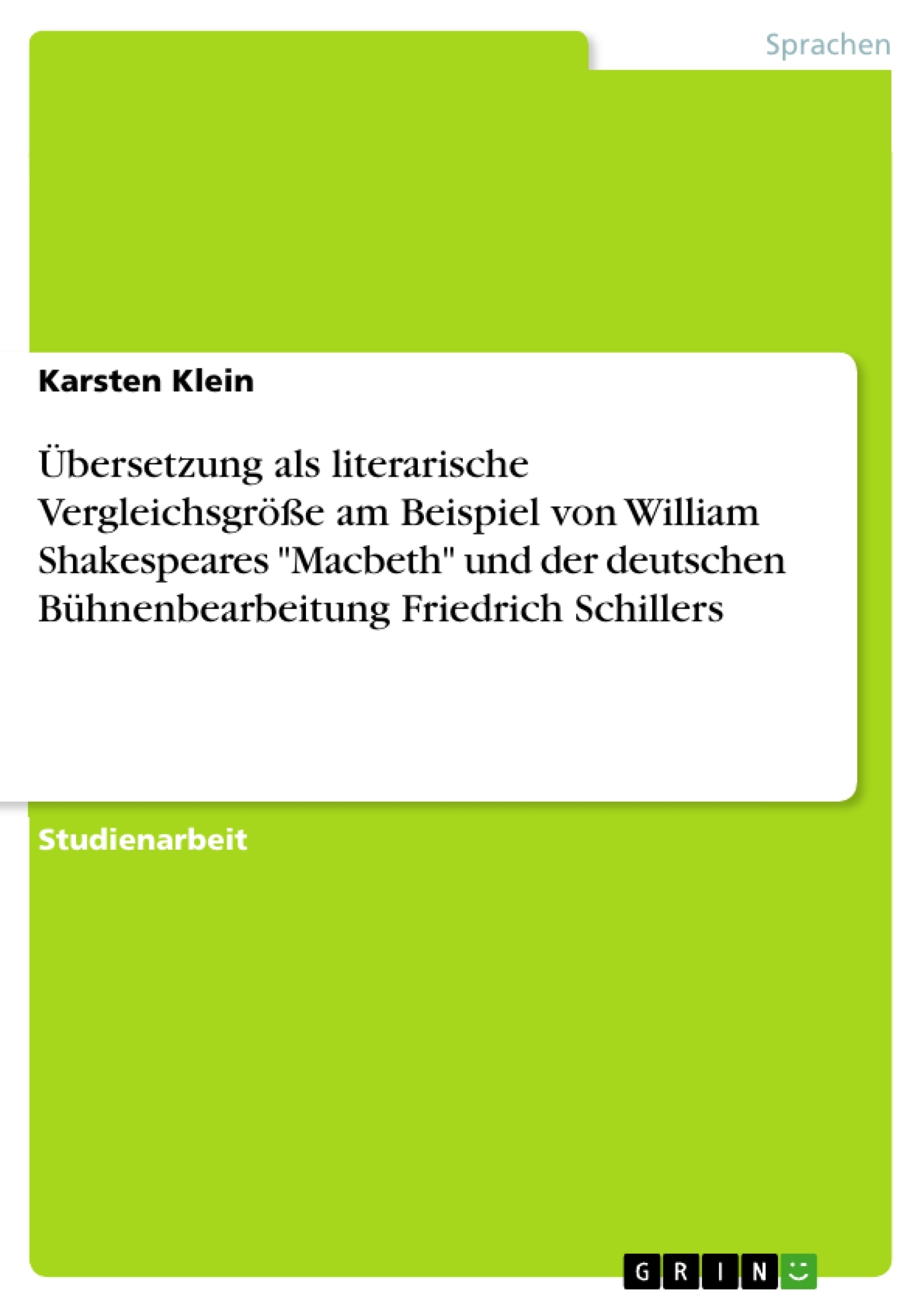Der Übersetzung von literarischen Werken ist seit jeher eine große Signifikanz einzuräumen, da sich an diesem Punkt die Disziplinen Sprach- und Translationswissenschaft sowie die Literaturwissenschaft treffen und ergänzen. Da man immer schon versuchte literarische Werke in andere Sprachen zu übersetzen, um sie so Menschen anderer Länder zugänglich zu machen, ist mit diesem Unterfangen eine große Historie verbunden. Oftmals sind mit dem Übertragen eines Werkes in eine andere Sprache große Probleme verbunden, da es unter Umständen zu inhaltlichen Verlusten oder sogar zu Veränderungen kommen kann, die entweder von der Art der Funktion der Übersetzung, aber auch von der Zielsprache des Vorhabens abhängen können. In dieser Arbeit soll die Übersetzung als literarische Vergleichsgröße am Beispiel von William Shakespeares Macbeth und der deutschen Bühnenbearbeitung Friedrich Schillers analysiert werden, um so am konkreten Beispiel zu zeigen, wie Sprach- Translations- und Literaturwissenschaft in Dialog treten um aufkommende Fragen zu lösen.
Als erstes wird die Frage nach dem kulturellen Hintergrund von Macbeth gestellt. Warum suchte sich Schiller ein englisches Stück aus? Und im Anschluss: Warum genau Macbeth? Diese Fragen werden im anschließenden Kapitel, welches sich den formalen und inhaltlichen Änderungen des Stückes in der Version Schillers widmet, wieder aufgegriffen. Der erste Teil des Kapitels beschäftigt sich mit den auffälligsten dramaturgischen Eingriffen Schillers und deren Bedeutung für die Leseart des Stückes. Vor diesem Hintergrund wirft sich auch eine neue Frage auf, die auch sogleich beantwortet wird: ist der Terminus „Übersetzung“ in diesem Kontext überhaupt korrekt? Das nächste Unterkapitel befasst sich mit dem Motiv des Bösen, welches bei Shakespeare eine ausgeprägte Rolle spielt und der Schuld sowie deren Verteilung innerhalb der Tragödie. Den Abschluss dieses Kapitels bilden die Hexen. Das nächste Kapitel umfasst eine Analyse der textlichen Übereinstimmungen anhand der zwei bekanntesten Monologe aus Macbeth “If it were done when `tis done…” und „Is this a dagger which i see before me“, die in beiden Versionen einander gegenübergestellt werden. Es ist in Bezug auf diese Arbeit interessant zu untersuchen, wo und insbesondere wie, Shakespeare kreativ geworden ist und wie Schiller diese Stellen in seiner Version wiedergibt. Den Abschluss der Arbeit bildet ein Fazit, welches die gewonnenen Ergebnisse zusammenfasst.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Macbeth
- 3. Formale und inhaltliche Änderungen
- 3.1 Ortswechsel und der Pförtner
- 3.2 Das Motiv des Bösen und die Schuld
- 3.3 Die Hexen
- 4. Textlicher Vergleich
- 4.1 If it were done when 'tis done...
- 4.2 Is it a dagger which i see before me
- 4.3 Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- 5. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Übersetzung von William Shakespeares Macbeth durch Friedrich Schiller, um den Dialog zwischen Sprach-, Translations- und Literaturwissenschaft aufzuzeigen. Die Arbeit untersucht die kulturellen Hintergründe von Schillers Wahl, die formalen und inhaltlichen Änderungen in seiner Adaption, und vergleicht Schlüsselstellen beider Versionen. Der Fokus liegt auf der Frage, wie Übersetzung literarische Werke verändert und welche Herausforderungen sich dabei stellen.
- Kulturelle Hintergründe der Übersetzung von Macbeth
- Formale und inhaltliche Veränderungen in Schillers Adaption
- Vergleich der textlichen Übereinstimmungen in ausgewählten Monologen
- Die Rolle des Bösen und der Schuld in beiden Versionen
- Der Einfluss der historischen und kulturellen Unterschiede auf die Übersetzung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die Bedeutung der Übersetzung literarischer Werke als Schnittstelle zwischen Sprach-, Translations- und Literaturwissenschaft. Sie hebt die Herausforderungen hervor, die mit inhaltlichen Verlusten oder Veränderungen bei der Übersetzung verbunden sind und kündigt die Analyse von Shakespeares Macbeth und Schillers Adaption als Fallbeispiel an. Die Arbeit untersucht die kulturellen Hintergründe von Schillers Wahl und stellt die Frage nach der Korrektheit des Begriffs "Übersetzung" in diesem Kontext.
2. Macbeth: Dieses Kapitel beleuchtet die Gründe für Schillers Wahl von Macbeth als Vorlage. Es beschreibt Macbeth als Tragödie aus dem Jahr 1606, die den Aufstieg und Fall des schottischen Königs behandelt, und hebt die Verbindung von historischen Fakten, Aberglaube und Fiktion hervor. Der Fokus liegt auf Shakespeares gezielter Umverteilung der Schuld, die aus dem historischen Königsmord eine tragische Geschichte mit vielschichtigen anthropologischen Fragen macht. Das Kapitel hebt auch die Einzigartigkeit von Macbeth hervor, insbesondere seine kurze Länge und den frühen Höhepunkt der Handlung. Die Auseinandersetzung mit dem Bösen als „in der Natur waltendes Prinzip“ und die damit verbundenen Fragen nach individueller Schuld und menschlicher Freiheit werden als Schlüsselfaktoren für Schillers Interesse hervorgehoben.
3. Formale und inhaltliche Änderungen: Dieses Kapitel analysiert die dramaturgischen Eingriffe Schillers und deren Bedeutung für die Interpretation des Stückes. Es untersucht den Ortswechsel, die Rolle des Pförtners, das Motiv des Bösen und der Schuld, und die Bedeutung der Hexen in beiden Versionen. Die Analyse beleuchtet historische Unterschiede zwischen den beiden Versionen, die 200 Jahre auseinander liegen, und dokumentiert die Veränderungen, die Schiller vorgenommen hat. Die Bedeutung der Hexen sowohl auf inhaltlicher als auch auf gesellschaftlich-kultureller Ebene wird ausführlich betrachtet.
4. Textlicher Vergleich: Dieses Kapitel vergleicht die beiden bekanntesten Monologe aus Macbeth ("If it were done when 'tis done..." und "Is this a dagger which i see before me") in Shakespeares Original und Schillers Übersetzung. Es analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Sprache, dem Stil und der Wirkung der Monologe, um die kreativen Entscheidungen Shakespeares und Schillers aufzuzeigen. Die Wahl der Monologe wird begründet durch deren große literarische Bedeutung und ihre Fähigkeit, die inneren Gefühlswelten der Figuren zu enthüllen.
Schlüsselwörter
Macbeth, Shakespeare, Schiller, Übersetzung, Literaturvergleich, Dramaturgie, Bühnenbearbeitung, Motiv des Bösen, Schuld, Hexen, Monolog, kulturelle Unterschiede, historischer Kontext, anthropologische Fragen.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Macbeth-Übersetzungen von Shakespeare und Schiller
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit analysiert die Übersetzung von William Shakespeares Macbeth durch Friedrich Schiller. Sie untersucht die kulturellen Hintergründe von Schillers Adaption, die vorgenommenen formalen und inhaltlichen Änderungen und vergleicht Schlüsselstellen beider Versionen. Der Fokus liegt auf der Wirkung von Übersetzungsprozessen auf literarische Werke und den damit verbundenen Herausforderungen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: die kulturellen Hintergründe der Übersetzung, formale und inhaltliche Veränderungen in Schillers Adaption, ein Vergleich textlicher Übereinstimmungen in ausgewählten Monologen, die Rolle des Bösen und der Schuld in beiden Versionen sowie der Einfluss historischer und kultureller Unterschiede auf die Übersetzung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel über Shakespeare's Macbeth, ein Kapitel über die formalen und inhaltlichen Änderungen in Schillers Version, ein Kapitel zum textlichen Vergleich ausgewählter Monologe und eine Schlussbetrachtung.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung betont die Bedeutung der Übersetzung literarischer Werke als Schnittstelle zwischen Sprach-, Translations- und Literaturwissenschaft. Sie hebt die Herausforderungen hervor, die mit inhaltlichen Verlusten oder Veränderungen bei der Übersetzung verbunden sind und kündigt die Analyse von Shakespeares Macbeth und Schillers Adaption als Fallbeispiel an. Es wird die Frage nach der Korrektheit des Begriffs "Übersetzung" in diesem Kontext gestellt.
Was wird im Kapitel über Shakespeare's Macbeth behandelt?
Dieses Kapitel beleuchtet die Gründe für Schillers Wahl von Macbeth als Vorlage. Es beschreibt Macbeth als Tragödie und hebt die Verbindung von historischen Fakten, Aberglaube und Fiktion hervor. Es wird Shakespeares gezielte Umverteilung der Schuld und die Auseinandersetzung mit dem Bösen als „in der Natur waltendes Prinzip“ und die damit verbundenen Fragen nach individueller Schuld und menschlicher Freiheit behandelt.
Was wird im Kapitel über formale und inhaltliche Änderungen behandelt?
Dieses Kapitel analysiert die dramaturgischen Eingriffe Schillers und deren Bedeutung für die Interpretation des Stücks. Es untersucht den Ortswechsel, die Rolle des Pförtners, das Motiv des Bösen und der Schuld, und die Bedeutung der Hexen in beiden Versionen. Die Analyse beleuchtet historische Unterschiede und dokumentiert die Veränderungen, die Schiller vorgenommen hat.
Was wird im Kapitel zum textlichen Vergleich behandelt?
Dieses Kapitel vergleicht die Monologe "If it were done when 'tis done..." und "Is this a dagger which i see before me" in Shakespeares Original und Schillers Übersetzung. Es analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Sprache, Stil und Wirkung, um die kreativen Entscheidungen Shakespeares und Schillers aufzuzeigen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Macbeth, Shakespeare, Schiller, Übersetzung, Literaturvergleich, Dramaturgie, Bühnenbearbeitung, Motiv des Bösen, Schuld, Hexen, Monolog, kulturelle Unterschiede, historischer Kontext, anthropologische Fragen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Wissenschaftler und Studierende der Sprach-, Translations- und Literaturwissenschaft, die sich für die Übersetzungsprozesse und die Adaption literarischer Werke interessieren.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage ist, wie Übersetzung literarische Werke verändert und welche Herausforderungen sich dabei stellen, insbesondere am Beispiel von Shakespeares Macbeth und Schillers Adaption.
- Quote paper
- Karsten Klein (Author), 2018, Übersetzung als literarische Vergleichsgröße am Beispiel von William Shakespeares "Macbeth" und der deutschen Bühnenbearbeitung Friedrich Schillers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/495454