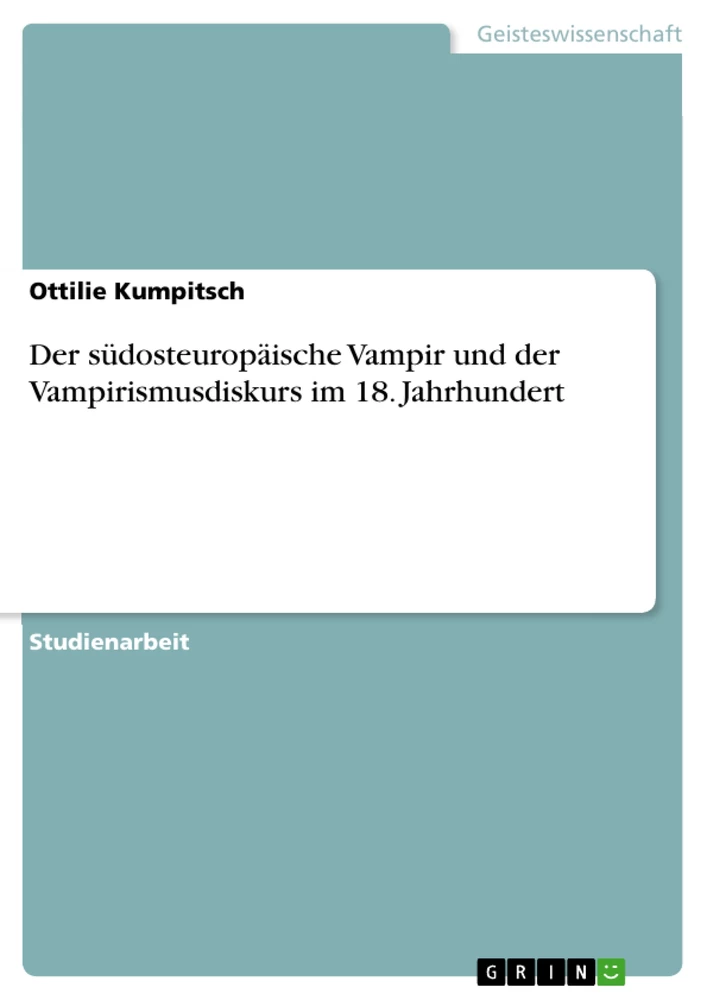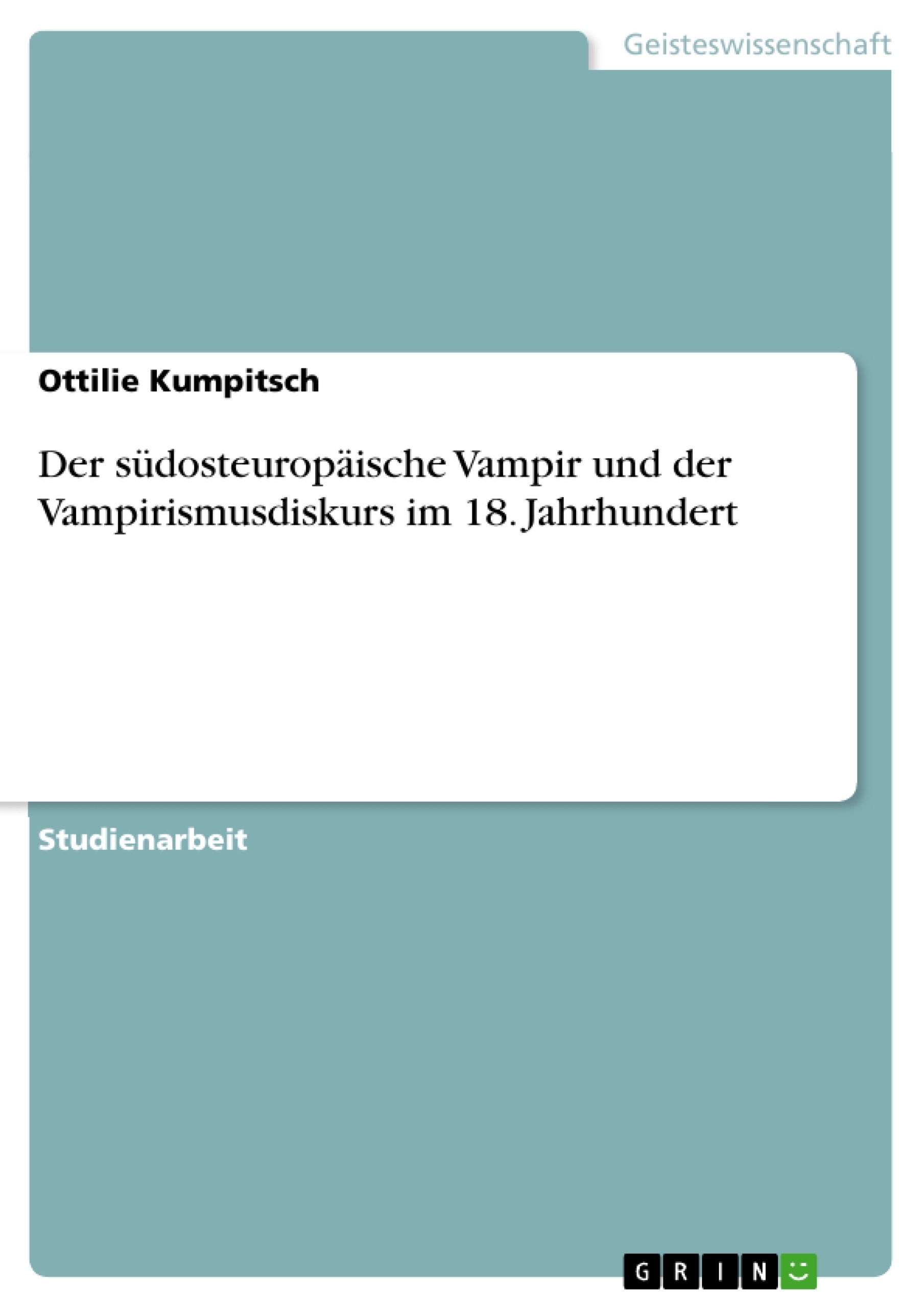Heute hat der Tod keine Bedeutung mehr für die Lebenden, er wird in unserer Kultur verdrängt und man kommt kaum mehr mit ihm bzw. Toten in Berührung. Der Tod wird nicht als Kehrseite der Medaille Leben gesehen, sondern nur mehr als Ende der menschlichen Körperfunktionen betrachtet, denn mit dem Tod scheint alles aus zu sein.
In einer Zeit, da diese Sichtweise so noch nicht der Fall war, wo man auch von Seiten der Wissenschaften noch nicht viel Ahnung von den Abläufen des Lebens, des Sterbens und des Verwesens hatte, tauchte immer wieder das Phänomen von (schädigenden) Wiederkehrern auf. Was natürlich in der Aufklärung, wo alles sich auf die Vernunft hin ausrichtete, die Religion zurückgedrängt wurde und man sich verstärkt den Naturwissenschaften zuwandte, also ab dem 18. Jahrhundert, zu regen Diskussionen führte.
In den Überlappungszonen der europäischen Vielvölkerreiche traten im 18. Jahrhundert massiv in den neueroberten Gebieten der Habsburgermonarchie Vorfälle mit „Vampiren“ auf, die zu einer ganz Europa erfassenden Vampirismusdebatte führten. Als Grund für das Auftreten der „Vampire“ wird z. B. die geänderten Bestattungsformen - weg von der Feuerbestattung hin zur Beerdigung in einem Grab - als Grund angeführt, da man sich nun nicht mehr sicher sein konnte, dass ein Toter auch wirklich tot war. Aber auch die Rückständigkeit und der Aberglaube der Menschen in den südosteuropäischen Ländern bzw. der orthodoxe Glaube diente als Erklärungsmuster. Durchaus kann es aber auch gewesen sein, dass ältere mythische Vorstellungen hierbei eine Rolle gespielt haben und diese durch eine epidemische Krankheit, die in den entlegenen Dörfern Südosteuropas aufgetreten ist, wieder ans Tageslicht gefunden haben.
In der Arbeit soll kurz die Situation der Habsburgermonarchie in Verbindung mit dem osmanischen Reich Anfang des 18. Jahrhunderts dargelegt werden. Danach wird ein kleiner Einblick in die Etymologie des Vampirbegriffes gegeben. Nach der Darstellung der wichtigsten Vampirismusvorfälle werden die militärischen Berichte und die daraus folgenden Diskurse aufgezeigt, deren fast jähes Ende (zumindest für das Habsburgerreich) mit der Gesetzgebung Maria Theresias zu sehen ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist ein Vampir?
- Österreich-Ungarn vs. Osmanisches Reich am Anfang des 18. Jahrhunderts
- Der Vampir in den militärischen Dokumenten der Habsburger
- Vorfälle in Kisolova (1725)
- Vorgeschichte
- Bericht von Frombald
- Vorfälle in Medvegya (1731/1732)
- Vorgeschichte und Bericht von Glaser
- Bericht von Johann Flückinger
- Vorfälle in Kisolova (1725)
- Aufgeklärte Vampirismusdebatte
- Gutachten der kgl. Preußischen Societät der Wissenschaften (1732)
- Vampirtraktate
- Michael Ranft (1734)
- Dissertation von Augustin Calmet (1745)
- Benedikt XIV. (1749/1752)
- Das Abklingen der Vampirismusdebatte
- Vorfall in Kapnick (1753)
- Vorgeschichte
- Bericht von Georg Tallar (1756, 1784)
- Vorfall in Hermersdorf bei Benisch (1754)
- Vorgeschichte
- Bericht von Gerard van Swieten (1755)
- Maria Theresia (1755)
- Vorfall in Kapnick (1753)
- Resumee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den südosteuropäischen Vampir und den Diskurs über den Vampirismus im 18. Jahrhundert, insbesondere im Kontext der Habsburgermonarchie. Die Arbeit beleuchtet den Zusammenhang zwischen der Verbreitung des Vampirmythos, der militärischen und politischen Situation im Südosten Europas, sowie der wissenschaftlichen und religiösen Debatte über das Phänomen des Vampirismus.
- Die Bedeutung des Vampirmythos im 18. Jahrhundert
- Die Rolle der Habsburgermonarchie in der Vampirismusdebatte
- Die Verbindung zwischen dem Vampirmythos und der politischen und militärischen Situation in Südosteuropa
- Die wissenschaftliche und religiöse Auseinandersetzung mit dem Vampirismus
- Das Abklingen der Vampirismusdebatte im 18. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema des Vampirismus und seine Relevanz im 18. Jahrhundert ein. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven auf den Tod in verschiedenen Epochen und die Rolle des Vampirmythos im Kontext der Aufklärung.
- Das Kapitel „Was ist ein Vampir?“ beschäftigt sich mit der Etymologie des Wortes „Vampir“ und gibt einen Überblick über die unterschiedlichen Definitionen des Vampirs in der Literatur.
- Das Kapitel „Österreich-Ungarn vs. Osmanisches Reich am Anfang des 18. Jahrhunderts“ beschreibt die politische und militärische Situation in Südosteuropa im 18. Jahrhundert und die Rolle der Habsburgermonarchie in dieser Region.
- Das Kapitel „Der Vampir in den militärischen Dokumenten der Habsburger“ analysiert die militärischen Berichte über Vampirvorfälle in der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert, insbesondere die Fälle in Kisolova (1725) und Medvegya (1731/1732).
- Das Kapitel „Aufgeklärte Vampirismusdebatte“ stellt die wissenschaftliche und religiöse Auseinandersetzung mit dem Vampirismus im 18. Jahrhundert dar, einschließlich der Gutachten der kgl. Preußischen Societät der Wissenschaften (1732) und der Werke von Michael Ranft (1734) und Augustin Calmet (1745).
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem südosteuropäischen Vampir, dem Vampirismusdiskurs, der Habsburgermonarchie, der Aufklärung, den militärischen Dokumenten, der wissenschaftlichen Debatte, der religiösen Diskussion, dem Aberglauben, dem Mythos, der Geschichte, der Kultur, der Etymologie, der Literatur und dem 18. Jahrhundert.
- Quote paper
- Mag. theol., MA Ottilie Kumpitsch (Author), 2018, Der südosteuropäische Vampir und der Vampirismusdiskurs im 18. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/495190