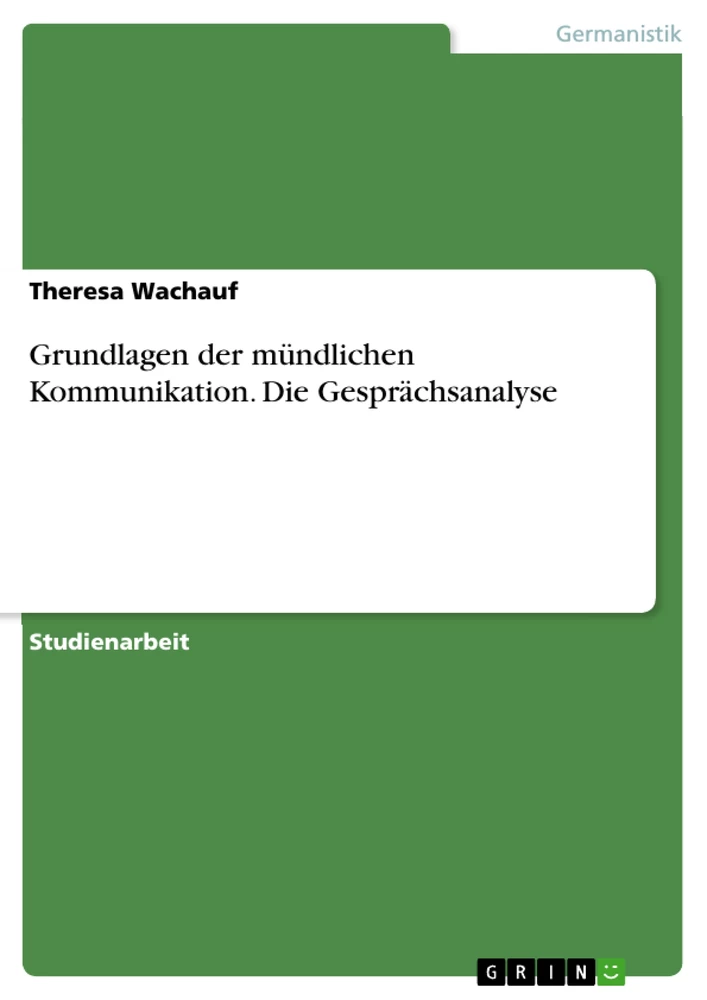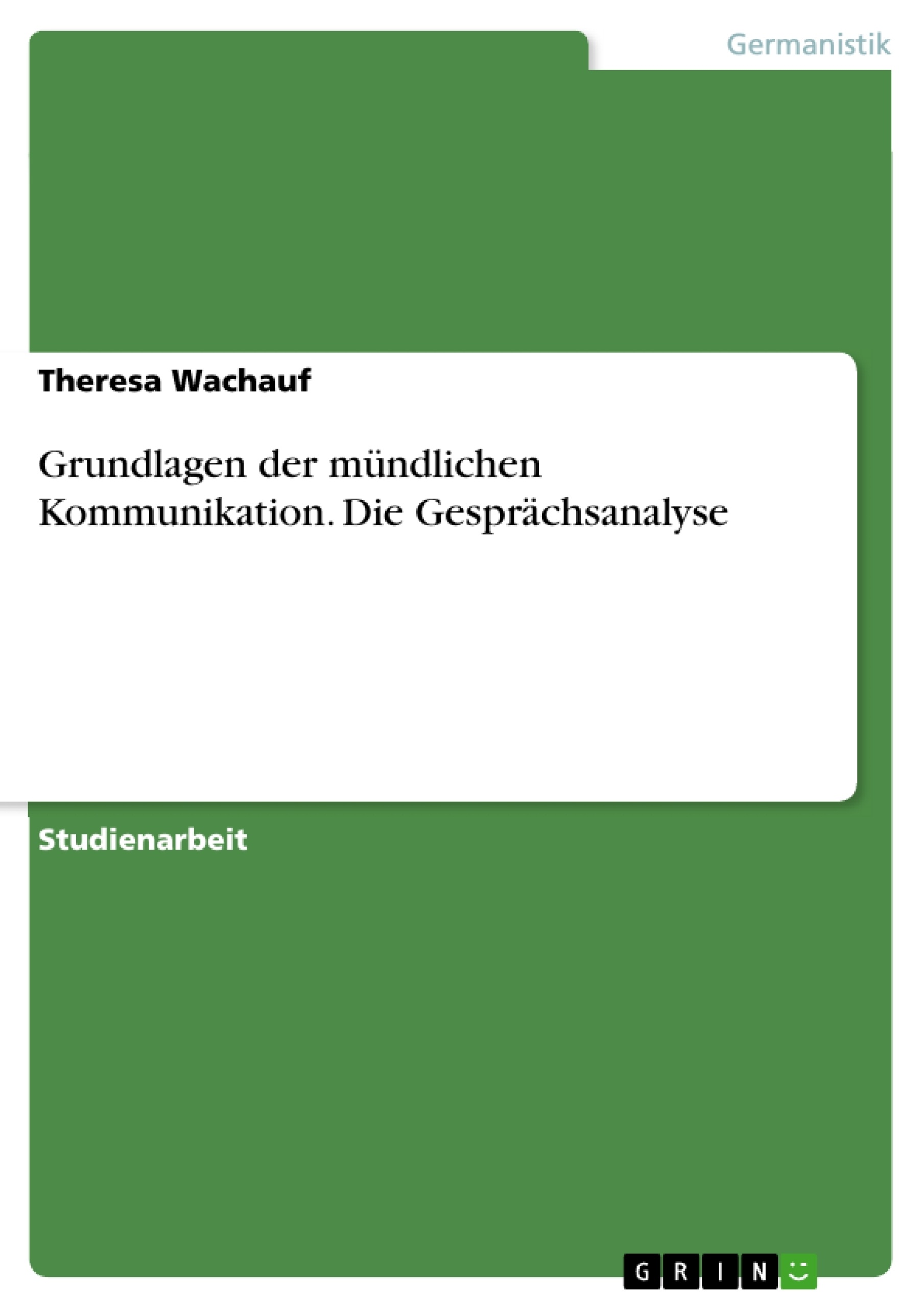Einleitung
„Die Wurzeln der linguistischen Gesprächsanalyse sind in der (amerikanischen) Ethnomethodologie zu suchen, d.h. in der Beschäftigung mit Ordnungen und Strukturen, die dem Handeln und den Interaktionen der Menschen in verschiedenen Kulturen und Ethnien zugrunde liegen.“ (Linke/Nussbaumer/Portmann 1994, S.258).
Über Gesprächsanalyse lässt sich im Allgemeinen sagen, dass ihr Gegenstandsbe-reich fast ausschließlich die ‚gesprochene Sprache’ ist. Die Analyse beschäftigt sich in erster Linie mit den verschiedenen sprachlichen Verhaltensweisen der Gesprächspartner. Allerdings legt die Forschung nicht nur Wert auf die Sprache, sondern auch auf körperliche Gestikulation und Mimik. Um diese Verhaltensweisen gut analysieren zu können werden in der Forschung gerne Ton- und Videoaufzeichnungen, genauer gesagt Transkripte von Gesprächen verwendet.
Einige Bereiche der Gesprächsanalyse sind unter anderem der Zusammenhang zwischen Rede und Gegenrede, die Rollenverteilung während eines Sprechaktes, die Sprecherwechsel, der Anfang und das Ende eines Gesprächs und die Themenwahl.
Weiterhin beschäftigt sich die Forschung mit der „Aufdeckung unbewusster Regeln und Automatismen“ (Linke/Nussbaumer/Portmann 1994, S.259).
In meiner Arbeit beschäftigen mich unter anderem Fragen wie:
Wie kommt man in einem Gespräch zu Wort?
Wie erfolgt der Sprecherwechsel?
Woran merkt man, wenn ein Gesprächsbeitrag zu Ende ist?
Wie ist die Rollenverteilung?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Forschungsgegenstand, Gespräch
- 3. Die „Teile“ des Gesprächs
- 3.1 Die Anfangsphase des Gesprächs
- 3.2 Die Gesprächsmitte (Hauptteil)
- 3.3 Die Beendigungsphase
- 4. Kategorien der Gesprächsanalyse
- 4.1 Mikrostruktur
- 4.2 Makrostruktur
- 4.2.1 Die Anfangsphase des Gesprächs
- 4.2.2 Die Gesprächsmitte (Hauptteil)
- 4.2.3 Die Beendigungsphase
- 5. Beteiligungsrollen
- 6. Analysekategorien
- 6.1 Sprecherwechsel
- 6.2 Formen des Sprecherwechsels
- 6.3 Sprecher
- 6.4 Hörer
- 6.5 Organisationspannen und Reparaturmechanismen
- 6.6 Funktion der Partikel
- 6.7 Funktion nonverbalen Verhaltens
- 7. Methodologischer Exkurs
- 7.1 Transkription
- 8. Zum Verhalten benachbarter Gesprächsbeiträge
- 8.1 Initiierung vs. Respondierung
- 8.2 Paarigkeit von Gesprächsbeiträgen
- 8.3 Responsivität und Nicht-Responsivität
- 8.4 Textuelle Verknüpfung von Gesprächsbeiträgen
- 9. Die Rollen der Gesprächspartner
- 9.1 Institutionelle bzw. organisatorische Rollen
- 9.2 Akzidentelle funktionale Rollen
- 9.3 Feste soziale Rollen
- 10. Wichtige Gesprächsregeln
- 11. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Gesprächsanalyse, einem Teilgebiet der Linguistik. Ziel ist es, die verschiedenen Aspekte der mündlichen Kommunikation zu beleuchten und ein Verständnis für die Struktur und Organisation von Gesprächen zu entwickeln. Dabei werden sowohl sprachliche als auch nonverbale Elemente berücksichtigt.
- Struktur und Organisation von Gesprächen
- Rollenverteilung der Gesprächspartner
- Sprecherwechsel und -verhalten
- Funktion von nonverbalen Elementen
- Analysemethoden und -kategorien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Gesprächsanalyse ein und beschreibt ihren Ursprung in der Ethnomethodologie. Sie betont die Bedeutung der gesprochenen Sprache als Forschungsgegenstand und die Berücksichtigung nonverbaler Kommunikationselemente. Die Arbeit stellt zentrale Forschungsfragen bezüglich Sprecherwechsel, Gesprächsbeiträge und Rollenverteilung.
2. Forschungsgegenstand, Gespräch: Dieses Kapitel definiert das Gespräch als grundlegende Form des Sprachgebrauchs und differenziert zwischen mündlicher und schriftlicher Kommunikation. Es betont die Bedeutung des Kontextes und des Verhältnisses der Gesprächspartner. Zwei zentrale Perspektiven der Gesprächsanalyse werden vorgestellt: die thematisch-inhaltliche und die organisationsorientierte Perspektive.
3. Die „Teile“ des Gesprächs: Dieses Kapitel gliedert die Makrostruktur von Gesprächen in drei Phasen: die Anfangsphase (mit nonverbalen und verbalen Elementen), die Gesprächsmitte (mit Fokus auf Themenwahl und -verlauf) und die Beendigungsphase. Es werden praktische Beispiele und Faustregeln zur Dauer der einzelnen Phasen gegeben.
4. Kategorien der Gesprächsanalyse: Hier werden Kategorien zur Analyse von Gesprächen eingeführt, unterteilt in Mikrostruktur und Makrostruktur. Die Makrostruktur wird nochmals in die drei Phasen (Anfang, Mitte, Ende) unterteilt, was eine detaillierte Analyse ermöglicht.
5. Beteiligungsrollen: Das Kapitel beleuchtet die verschiedenen Rollen, die Gesprächspartner einnehmen können. Es ist zu vermuten, dass hier verschiedene Arten von Rollen (institutionell, funktional, sozial) unterschieden und analysiert werden.
6. Analysekategorien: Dieses Kapitel beschreibt detaillierte Analysekategorien wie Sprecherwechsel, Formen des Sprecherwechsels, die Rollen von Sprecher und Hörer, sowie Organisationspannen und deren Reparaturmechanismen. Die Funktionen von Partikeln und nonverbalem Verhalten werden ebenfalls behandelt.
7. Methodologischer Exkurs: Der methodologische Exkurs fokussiert sich auf die Transkription von Gesprächen als wichtige Methode der Datengewinnung und -aufbereitung für die Gesprächsanalyse.
8. Zum Verhalten benachbarter Gesprächsbeiträge: Dieses Kapitel analysiert das Zusammenspiel benachbarter Gesprächsbeiträge. Es untersucht Konzepte wie Initiierung und Respondierung, Paarigkeit von Beiträgen, Responsivität und Nicht-Responsivität, sowie die textuelle Verknüpfung von Beiträgen.
9. Die Rollen der Gesprächspartner: Dieses Kapitel vertieft die Betrachtung der Rollen der Gesprächspartner, indem es institutionelle, akzidentelle funktionale und feste soziale Rollen unterscheidet und analysiert.
10. Wichtige Gesprächsregeln: Hier werden die grundlegenden Regeln erläutert, die den Ablauf und die Struktur von Gesprächen bestimmen.
Schlüsselwörter
Gesprächsanalyse, mündliche Kommunikation, Sprecherwechsel, Gesprächsstruktur, Rollenverteilung, nonverbale Kommunikation, Mikrostruktur, Makrostruktur, Analysekategorien, Transkription.
Häufig gestellte Fragen zur Gesprächsanalyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit der Gesprächsanalyse, einem Teilgebiet der Linguistik. Sie untersucht die Struktur und Organisation von Gesprächen, wobei sowohl sprachliche als auch nonverbale Elemente berücksichtigt werden. Die Arbeit analysiert Sprecherwechsel, die Rollenverteilung der Gesprächspartner und die verschiedenen Phasen eines Gesprächs (Anfang, Mitte, Ende).
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet folgende Themenschwerpunkte: Struktur und Organisation von Gesprächen, Rollenverteilung der Gesprächspartner, Sprecherwechsel und -verhalten, Funktion nonverbaler Elemente und verschiedene Analysemethoden und -kategorien. Insbesondere werden Mikro- und Makrostrukturen von Gesprächen detailliert untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in elf Kapitel gegliedert. Sie beginnt mit einer Einleitung und einer Definition des Forschungsgegenstandes „Gespräch“. Es folgen Kapitel zur Struktur von Gesprächen (Anfangs-, Mittel- und Endphase), zu Kategorien der Gesprächsanalyse (Mikro- und Makrostruktur), zu Beteiligungsrollen der Gesprächspartner und zu detaillierten Analysekategorien (Sprecherwechsel, nonverbale Kommunikation etc.). Ein methodologischer Exkurs widmet sich der Transkription. Die Arbeit schließt mit einem Fazit.
Welche Phasen eines Gesprächs werden unterschieden?
Die Arbeit gliedert die Makrostruktur von Gesprächen in drei Phasen: die Anfangsphase, die Gesprächsmitte (Hauptteil) und die Beendigungsphase. Jede Phase wird hinsichtlich ihrer verbalen und nonverbalen Elemente und ihrer Dauer betrachtet.
Welche Kategorien der Gesprächsanalyse werden verwendet?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Mikro- und Makrostruktur der Gesprächsanalyse. Die Makrostruktur wird weiter in die drei Phasen (Anfang, Mitte, Ende) unterteilt. Zu den detaillierten Analysekategorien gehören Sprecherwechsel, Formen des Sprecherwechsels, die Rollen von Sprecher und Hörer, Organisationspannen und deren Reparaturmechanismen, die Funktion von Partikeln und nonverbalem Verhalten.
Welche Rollen von Gesprächspartnern werden betrachtet?
Die Arbeit unterscheidet zwischen institutionellen, akzidentellen funktionalen und festen sozialen Rollen der Gesprächspartner. Diese verschiedenen Rollen werden analysiert und ihre Auswirkungen auf den Gesprächsverlauf untersucht.
Welche methodischen Aspekte werden behandelt?
Ein methodologischer Exkurs befasst sich mit der Transkription von Gesprächen als wesentliche Methode der Datengewinnung und -aufbereitung für die Gesprächsanalyse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gesprächsanalyse, mündliche Kommunikation, Sprecherwechsel, Gesprächsstruktur, Rollenverteilung, nonverbale Kommunikation, Mikrostruktur, Makrostruktur, Analysekategorien und Transkription.
Wie wird der Sprecherwechsel analysiert?
Die Analyse des Sprecherwechsels umfasst verschiedene Aspekte: Formen des Sprecherwechsels, die Rollen von Sprecher und Hörer, sowie Organisationspannen und deren Reparaturmechanismen. Es wird untersucht, wie Sprecherwechsel den Gesprächsverlauf beeinflussen und wie Störungen im Sprecherwechsel behoben werden.
Welche Bedeutung hat die nonverbale Kommunikation in dieser Arbeit?
Nonverbale Kommunikationselemente spielen eine wichtige Rolle in der Analyse. Sie werden in allen Phasen des Gesprächs (Anfang, Mitte, Ende) berücksichtigt und ihre Funktion im Gesamtkontext des Gesprächs untersucht.
- Quote paper
- Theresa Wachauf (Author), 2003, Grundlagen der mündlichen Kommunikation. Die Gesprächsanalyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49513