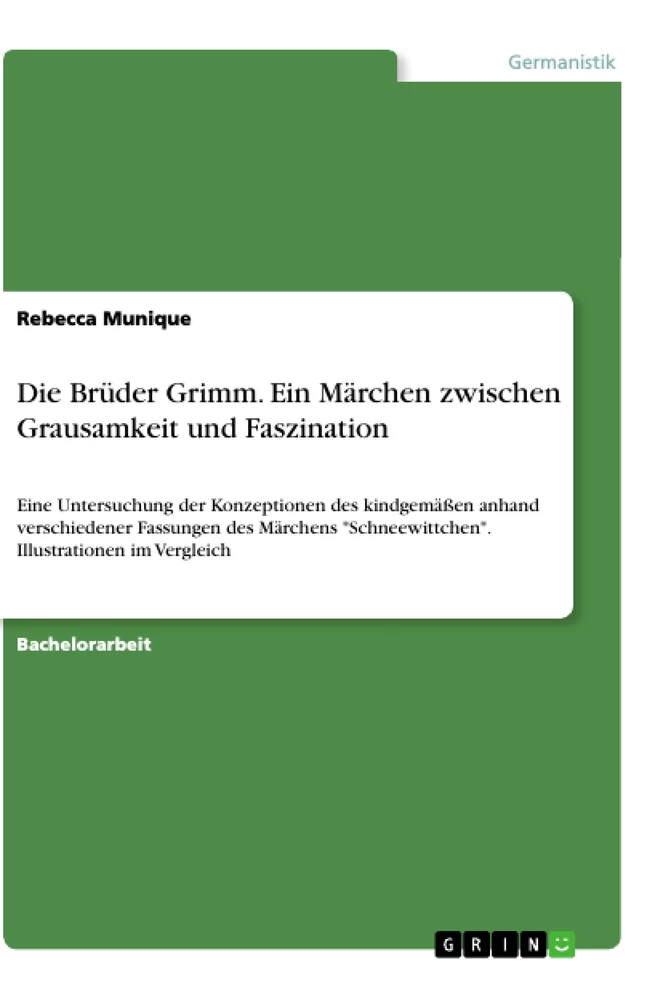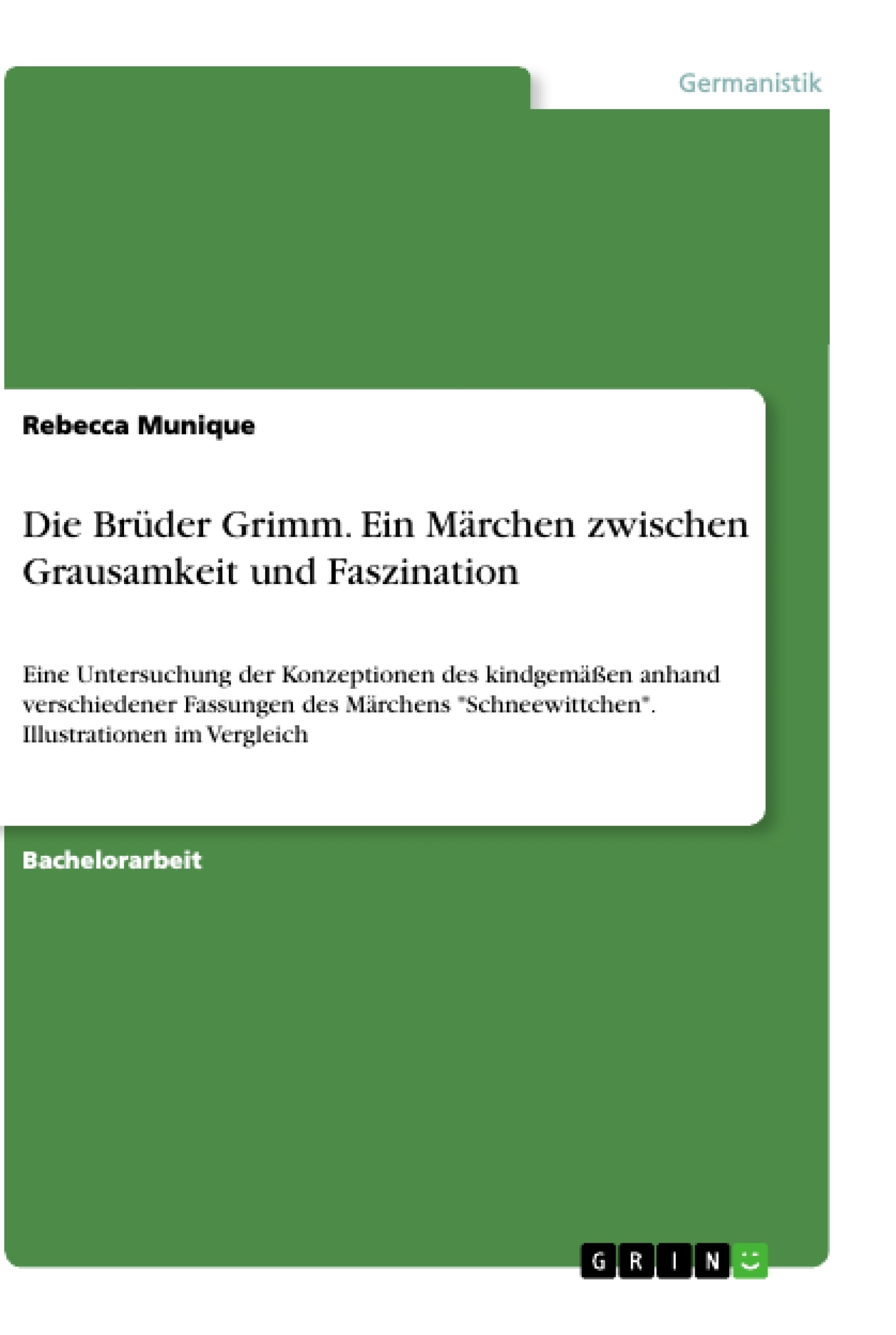Der zweihundertste Geburtstag der Brüder Grimm, 1985 und 1986, schlägt nicht nur in Deutschland hohe Wellen. Auch jetzt noch, einige Jahre später reißen die Diskussionen nicht ab. Märchen – ja oder nein? Das Positive und das Negative stehen sich unversöhnlich gegenüber. So raten Wissenschaftlicher dringend zur Lektüre von Märchen. Es wird davor gewarnt, Kinder Märchen zu enthalten, da sie wesentlich zur Erziehung beitragen würden. Jene Erzählungen gäben Kindern Hilfe, Anregung, Trost und Mut in einer Art und Weise, die auch von jungen Lesern verstanden werden könne. Das Märchen repräsentiert das was es soll. Die kindgerechte Sprache, die Weisheit, der Humor, der Sieg des Guten über das Böse und vor allem die Anregung der Phantasie bilden einen fundamentalen Baustein der kindlichen Erziehung. Des Weiteren stärke das Schicksal der Hauptfigur das Lebensbild des Kindes.
Anfangs noch ein Jüngling, der Dümmste, ein Knecht oder eine Magd in hoffnungsloser Lage, gelangt er oder sie dann dank magischer Helfer zu Glück und Reichtum. Märchen sind modern. Sie transportieren Gut und Böse, Liebe und Hass, Weisheit ebenso wie Grausamkeit. Märchen sprechen in einer bildhaften Sprache und malen gleichsam die Worte für sich. Dinge werden mit symbolreichen und aussagekräftigen Bildern, welche die rationale Sprache mit ihrer Suche nach eindeutigen Begriffen zum Verbleiben brächte, analogisch zum lebendigen Ausdruck gebracht. Bilder schaffen vorstellbare Anschaulichkeit.
Märchenillustrationen werden immer mehr oder weniger gegenständlich gehalten. Die Einheit, die aus Bild und Text entsteht, prägt sich in die Gedächtnisse der Leser ein und trägt deutlich dazu bei, den Inhalt des Geschriebenen zu verinnerlichen. Wilhelm Grimm schrieb 1816, an ein kleines Mädchen einen Brief in Form einer poetischen Erzählung mit Bildern von Maurice Sendak. In diesem Brief beschreibt er zuerst, wie sich an verschiedenen Orten weggeworfene Blumen im Wasser schwimmend zusammenzutun, um am Ende gemeinsam unterzugehen, oder auch, wie sich zwei fremde Vögel treffen und viel zu erzählen haben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Märchen
- 2.1 Das Märchen
- 2.1.1 Die Geschichte des Märchens und die Entstehung der Subgattungen
- 2.1.2 Märchen, Fantastik, Fantasie und das Besondere am Märchen
- 2.1.3 Grausamkeiten im Märchen?
- 2.2 Vom Volks zum Kindermärchen
- 2.2.1 Die Brüder Grimm und ihre Epoche
- 2.2.2 Die Entwicklung der Kinder- und Hausmärchen
- 2.2.3 Die Motive und Wesenszüge der Grimm'schen Kindermärchen
- 2.3 Märchenforschung
- 2.3.1 Volkskundliche Märchenforschung
- 2.3.2 Literaturwissenschaftliche Märchenforschung
- 2.3.2.1 Strukturalistische Märchenforschung Valdimir Propps
- 2.3.2.2 Anthropologische Märchenforschung Max Lüthi
- 3. Ein Einblick in die Welt des Walt Disney
- 3.1 Die Entstehung eines gewaltigen Unternehmens
- 3.2 Der erste klassische Märchenfilm: Snow White and the Seven Dwarfs
- 4. Ein strukturalistischer Vergleich zweier Fassungen des Märchens „Schneewittchen“
- 4.1 Interpretation und Analyse von Schneewittchen
- 4.1.1 Analyse der einzelnen Fassungen hinsichtlich des Inhalts und der einzelnen Charaktere
- 4.1.2 Interpretation des Märchens hinsichtlich der Stilmerkmale nach Lüthi
- 4.2 Die Konzeptionen des Kindgemäßen
- 5. Illustrationen
- 5.1 Die Kinder- und Hausmärchen und ihre Bilder
- 5.2 Der Stellenwert der Illustration im Verhältnis zum Texten
- 5.2.1 Entwicklung der Märchenillustration bei den Grimms
- 5.2.2 Das kindgemäße Bild
- 5.2.3 Bildnerische Positionen zum Märchen
- 5.3 Das Wechselspiel von Bild und Text im illustrierten Märchenbuch „Schneewittchen“
- 5.3.1 Betrachtung der Illustrationen in „Schneewittchen“
- 5.3.2 Wandel des Märchenbildes: Grimm – Walt Disney
- 5.3.3 Kritische Blicke auf die Märchenillustrationen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzeption des Kindgemäßen im Märchen „Schneewittchen“, indem sie die Versionen der Brüder Grimm und Walt Disney vergleicht. Die Zielsetzung ist es, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Fassungen hinsichtlich Inhalt, Charaktere und Illustrationen zu analysieren und deren Auswirkungen auf die Rezeption, insbesondere im Hinblick auf die Frage der Eignung für Kinder, zu beleuchten.
- Entwicklung des Märchens vom Volksmärchen zum Kindermärchen
- Vergleichende Analyse der Grimm'schen und Disney'schen Version von „Schneewittchen“
- Die Rolle von Grausamkeit und Faszination im Märchen
- Der Einfluss von Illustrationen auf die Interpretation des Märchens
- Die Frage nach der kindgemäßen Gestaltung von Märchen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Märchenrezeption und -diskussion ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Konzeption des Kindgemäßen im Märchen „Schneewittchen“ vor. Sie beleuchtet die anhaltende Relevanz von Märchen und deren pädagogischen Potenzial, verweist gleichzeitig aber auf die kontroversen Debatten um die Eignung bestimmter Märcheninhalte für Kinder. Der Fokus liegt auf dem Vergleich der Grimm'schen und Disney'schen Versionen des Märchens, um die jeweiligen Konzeptionen des Kindgemäßen zu analysieren.
2. Das Märchen: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Definition des Märchens, beleuchtet seine Geschichte und die Entstehung verschiedener Subgattungen. Es untersucht die spezifischen Merkmale von Märchen, inklusive der Frage nach der Darstellung von Grausamkeit. Die Entwicklung vom Volksmärchen zum Kindermärchen wird detailliert dargestellt, wobei die Rolle der Brüder Grimm und ihre Epoche im Fokus stehen. Schließlich wird ein Überblick über die verschiedenen Ansätze der Märchenforschung, insbesondere die volkskundliche und literaturwissenschaftliche Perspektive (inkl. Propp und Lüthi), gegeben.
3. Ein Einblick in die Welt des Walt Disney: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Walt Disney Unternehmens und die Bedeutung des ersten klassischen Märchenfilms „Snow White and the Seven Dwarfs“. Es wird die Adaption des Grimm'schen Märchens durch Disney untersucht und die Unterschiede zu der Originalfassung herausgestellt. Der Fokus liegt auf den Veränderungen, die Disney an der Geschichte vorgenommen hat und wie diese die Darstellung von Grausamkeit und Faszination beeinflussen.
4. Ein strukturalistischer Vergleich zweier Fassungen des Märchens „Schneewittchen“: Dieses Kapitel präsentiert eine detaillierte Interpretation und Analyse der Grimm'schen und Disney'schen Version von „Schneewittchen“. Es werden sowohl die Inhalte und Charaktere als auch die stilistischen Merkmale nach Lüthi untersucht, um die jeweiligen Konzeptionen des Kindgemäßen zu beleuchten. Der Vergleich ermöglicht es, die Unterschiede in der Darstellung von Gewalt, Magie und Moral herauszuarbeiten und zu diskutieren, wie diese die jeweilige Zielgruppe beeinflussen.
5. Illustrationen: Dieses Kapitel untersucht den Stellenwert der Illustrationen in Märchenbüchern, insbesondere im Kontext von „Schneewittchen“. Es beleuchtet die Entwicklung der Märchenillustration bei den Grimms und die Frage nach dem „kindgemäßen Bild“. Der Vergleich der Illustrationsstile zwischen Grimm und Disney wird durchgeführt und kritisch diskutiert, mit dem Ziel, die jeweiligen ästhetischen und pädagogischen Implikationen herauszuarbeiten.
Schlüsselwörter
Märchen, Brüder Grimm, Schneewittchen, Walt Disney, Kindermärchen, Volksmärchen, Märchenforschung, Kindgemäßheit, Grausamkeit, Faszination, Illustrationen, Strukturalismus, Anthropologie, Max Lüthi, Vladimir Propp.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Konzeption des Kindgemäßen im Märchen "Schneewittchen"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Konzeption des Kindgemäßen im Märchen "Schneewittchen", indem sie die Versionen der Brüder Grimm und Walt Disney vergleicht. Der Fokus liegt auf den Unterschieden und Gemeinsamkeiten beider Fassungen hinsichtlich Inhalt, Charaktere und Illustrationen und deren Auswirkungen auf die Rezeption, insbesondere für Kinder.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einleitung, 2. Das Märchen (inkl. Märchenforschung), 3. Ein Einblick in die Welt des Walt Disney, 4. Ein strukturalistischer Vergleich zweier Fassungen des Märchens „Schneewittchen“, und 5. Illustrationen. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte des Themas, von der Definition des Märchens bis hin zur Analyse von Illustrationen.
Wie wird das Märchen "Schneewittchen" analysiert?
Die Analyse von "Schneewittchen" erfolgt vergleichend, indem die Versionen der Brüder Grimm und Walt Disney gegenübergestellt werden. Es werden inhaltliche, charakterliche und stilistische Unterschiede untersucht, unter Einbezug der strukturalistischen Märchenforschung (Propp) und der anthropologischen Märchenforschung (Lüthi). Besonderes Augenmerk liegt auf der Darstellung von Grausamkeit und Faszination und deren Auswirkungen auf die Rezeption bei Kindern.
Welche Rolle spielen die Illustrationen in der Analyse?
Die Illustrationen spielen eine wichtige Rolle, da sie die Interpretation des Märchens beeinflussen. Die Arbeit untersucht die Entwicklung der Märchenillustration bei den Grimms und Disney, den Stellenwert des Bildes im Verhältnis zum Text, und die Frage nach dem "kindgemäßen Bild". Ein Vergleich der Illustrationsstile beider Versionen soll deren ästhetische und pädagogische Implikationen aufzeigen.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Zentrale Forschungsfragen sind: Wie entwickelt sich das Märchen vom Volksmärchen zum Kindermärchen? Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten bestehen zwischen der Grimm’schen und der Disney’schen Version von "Schneewittchen"? Welche Rolle spielen Grausamkeit und Faszination im Märchen? Wie beeinflussen Illustrationen die Interpretation des Märchens? Wie wird "Kindgemäßheit" in beiden Versionen konzipiert?
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine vergleichende Analyse der beiden "Schneewittchen"-Versionen. Theoretische Grundlagen werden aus der strukturalistischen und anthropologischen Märchenforschung (Propp und Lüthi) herangezogen. Die Analyse der Illustrationen berücksichtigt ästhetische und pädagogische Aspekte.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind: Märchen, Brüder Grimm, Schneewittchen, Walt Disney, Kindermärchen, Volksmärchen, Märchenforschung, Kindgemäßheit, Grausamkeit, Faszination, Illustrationen, Strukturalismus, Anthropologie, Max Lüthi, Vladimir Propp.
- Quote paper
- Rebecca Munique (Author), 2017, Die Brüder Grimm. Ein Märchen zwischen Grausamkeit und Faszination, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/494787