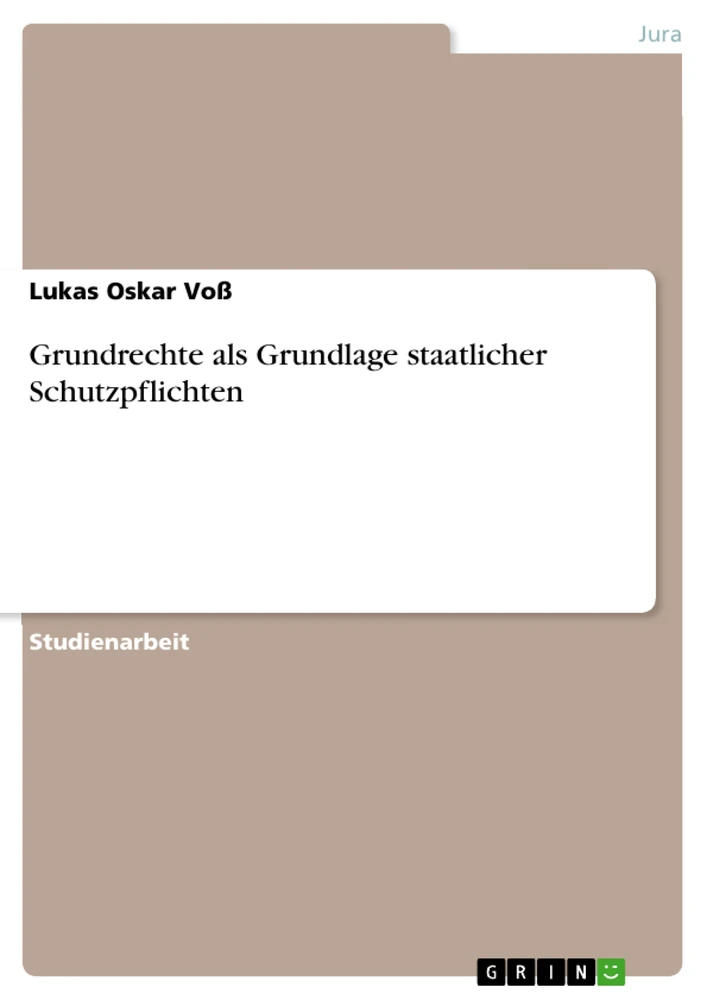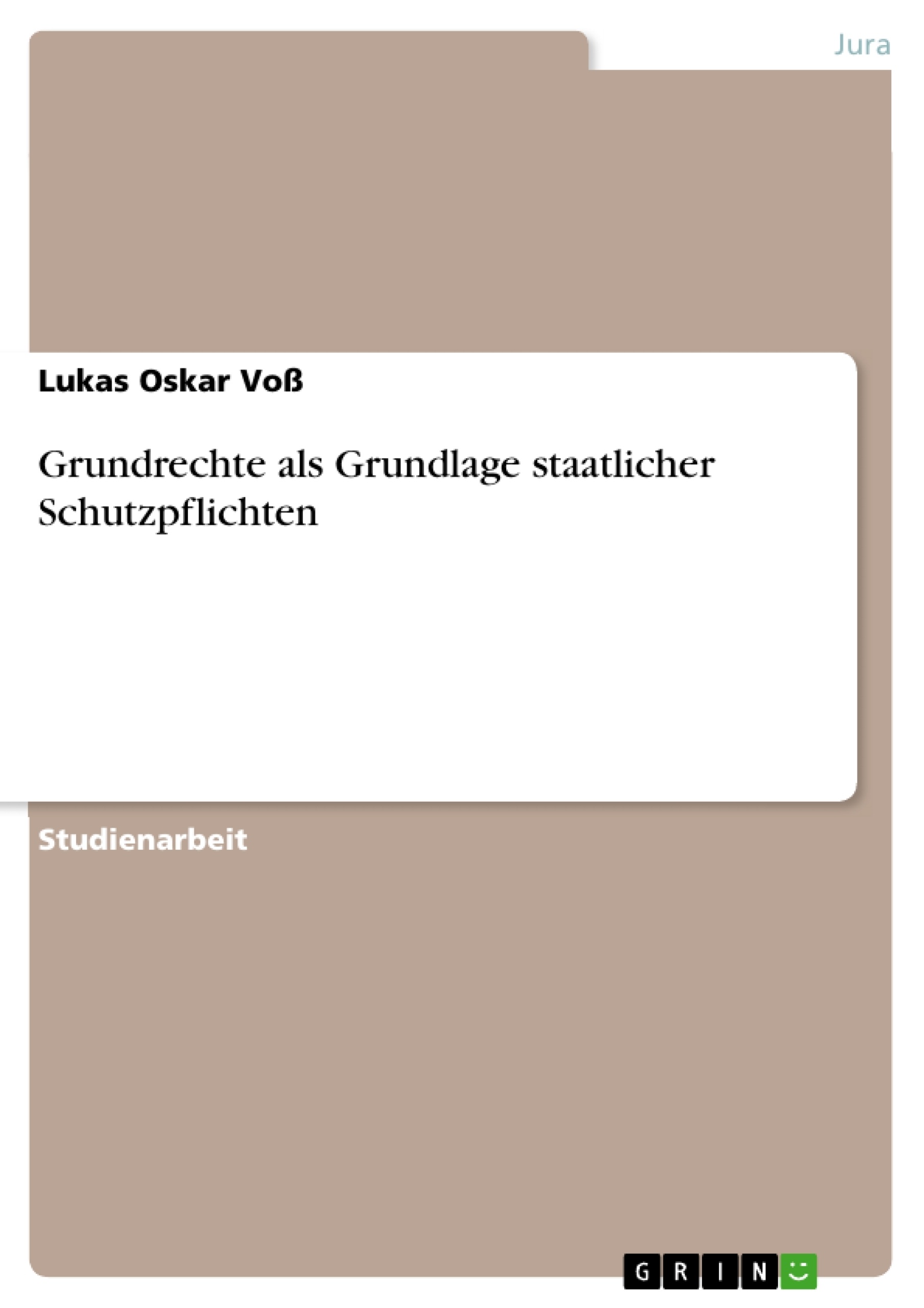Die Sicherung der Grundbedingungen menschlicher Existenz und Freiheit ist für den Einzelnen wie für das Gemeinwesen eine Frage von grundlegender Bedeutung. Gefahren drohen nicht nur von Seiten des Staates und der Gesellschaft, sondern von nahezu jedem beliebigen Mitmenschen. Die Sorge um die Bändigung staatlicher Macht und des Missbrauchs von Macht hat seit John Locke einen vorrangigen Platz in der staatsphilosophischen und verfassungsrechtlichen Diskussion eingenommen. Die Geschichte der Grundrechte ist auch eine Geschichte der Bändigung staatlicher Macht.
Durch die Grundrechte des Grundgesetzes hat die Bedrohung der Freiheit vor staatlicher Macht ihren Schrecken für die Bürger weitgehend verloren. Jedoch bietet der moderne Industriestaat mit seinen zahlreichen widerstreitenden Partikularinteressen viele Beispiele dafür, wie die grundrechtlich geschützten Freiheiten und Güter gefährdet werden können. Durch den wissenschaftlich-technologischen Fortschritt sind diese Möglichkeiten der Gefährdung vielfältiger und subtiler, weitreichender und einschneidender geworden. Abtreibung, Atomkraft, Terrorismus und Umweltzerstörung sind nur einige wenige Themen der Schlagzeilen, die einen oberflächlichen Eindruck der zugrunde liegenden Problematik vermitteln.
Diese Arbeit versucht der Frage nachzugehen, welche Funktion in dieser Gemengelage die eigentlich auf Abwehr staatlicher Übergriffe ausgerichteten Grundrechte einnehmen und welche Aufgaben dabei den Staat treffen.
Inhaltsverzeichnis
- A. Die Einordnung der Schutzpflichtenlehre in die Systematik der Grundrechtsfunktionen
- I. Grundrechte als Abwehrrechte
- II. Grundrechte als Leistungs-, Teilhabe- und Mitwirkungsrechte
- III. Schutzfunktion der Grundrechte
- IV. Ausdrückliche grundrechtliche Pflichten zum Rechtsgüterschutz
- B. Die Schutzpflichten in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts
- I. Entwicklung der Schutzpflichtenlehre
- 1. Ansätze bis zum ersten Abtreibungsurteil
- 2. Erstes Abtreibungsurteil
- 3. Fortführung der Schutzpflichtenjudikatur
- II. Dogmatische Begründung der Schutzpflichten
- III. Kontrollumfang
- IV. Kritik an der Rechtsprechung des BVerfG
- 1. Einwände gegen die dogmatische Herleitung
- 2. Einwände gegen das Untermaßverbot
- C. Die Schutzpflichten im rechtswissenschaftlichen Schrifttum
- I. Herleitung aus dem Staatszweck
- II. Herleitung aus den Grundrechten
- 1. Schutzpflichten als Unterfall der abwehrrechtlichen Funktion
- 2. Herleitung aus der Menschenwürde, Art. 1 Abs. 1 S. 2 GG
- 3. Grundrechtsschranken und Sozialstaatsprinzip
- 4. Doppelfunktion des grundrechtlichen Freiheitsbegriffs
- III. Fazit zur dogmatischen Herleitung der Schutzpflichten
- D. Die Adressaten und die Bindungswirkung grundrechtlicher Schutzpflichten
- I. Legislative
- 1. Repressive Elemente
- 2. Präventive Elemente
- II. Exekutive
- III. Judikative
- E. Das Verhältnis grundrechtlicher Schutzpflichten und grundrechtlicher Drittwirkung
- I. Entwicklung zur mittelbaren Drittwirkung
- II. Schutzpflichten und mittelbare Drittwirkung
- F. Die gerichtliche Geltendmachung grundrechtlicher Schutzpflichten
- I. Schutzpflichten als subjektive Rechte
- II. Verfassungsprozessuale Besonderheiten
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht die grundrechtlichen Schutzpflichten des Staates. Ziel ist es, die Einordnung der Schutzpflichtenlehre in die Systematik der Grundrechtsfunktionen zu beleuchten, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu analysieren und die verschiedenen rechtswissenschaftlichen Ansätze zu vergleichen. Die Arbeit befasst sich auch mit den Adressaten und der Bindungswirkung dieser Pflichten sowie deren Verhältnis zur Drittwirkung von Grundrechten.
- Einordnung der Schutzpflichtenlehre in die Grundrechtsfunktionen
- Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu Schutzpflichten
- Rechtswissenschaftliche Herleitung und Begründung von Schutzpflichten
- Adressaten und Bindungswirkung grundrechtlicher Schutzpflichten
- Verhältnis von Schutzpflichten und Drittwirkung
Zusammenfassung der Kapitel
A. Die Einordnung der Schutzpflichtenlehre in die Systematik der Grundrechtsfunktionen: Dieses Kapitel untersucht die Position der Schutzpflichtenlehre innerhalb der verschiedenen Funktionen von Grundrechten. Es differenziert zwischen Abwehrrechten, Leistungsrechten und der Schutzfunktion, um die spezifische Rolle von staatlichen Schutzpflichten zu definieren und deren Einordnung in das bestehende System der Grundrechte zu klären. Die Analyse beinhaltet eine umfassende Diskussion über die verschiedenen Arten von Grundrechten und wie staatliche Schutzpflichten aus diesen abgeleitet werden können.
B. Die Schutzpflichten in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung und die dogmatische Begründung der Schutzpflichtenlehre in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG). Es verfolgt die Entwicklung von frühen Ansätzen bis hin zum ersten Abtreibungsurteil und dessen Auswirkungen auf die spätere Judikatur. Die Kapitel beleuchten den Kontrollumfang des BVerfG und diskutiert kritische Einwände gegen dessen dogmatische Herleitung und das Untermaßverbot. Die historische Entwicklung der Rechtsprechung und die damit verbundenen Debatten werden ausführlich behandelt.
C. Die Schutzpflichten im rechtswissenschaftlichen Schrifttum: In diesem Kapitel werden die verschiedenen rechtswissenschaftlichen Ansätze zur Herleitung von staatlichen Schutzpflichten aus dem Staatszweck und den Grundrechten beleuchtet. Es analysiert verschiedene Interpretationen, darunter die Ableitung aus der abwehrrechtlichen Funktion der Grundrechte, aus der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 S. 2 GG), sowie aus dem Zusammenspiel von Grundrechtsschranken und Sozialstaatsprinzip. Die verschiedenen theoretischen Perspektiven und deren Argumente werden detailliert dargestellt und kritisch bewertet.
D. Die Adressaten und die Bindungswirkung grundrechtlicher Schutzpflichten: Dieses Kapitel befasst sich mit den staatlichen Organen, die von grundrechtlichen Schutzpflichten betroffen sind (Legislative, Exekutive und Judikative). Es untersucht die spezifischen Pflichten jedes Organs und analysiert die Art und Weise, wie diese Pflichten auf die verschiedenen Ebenen der Staatsgewalt wirken. Die jeweilige Verantwortung und die rechtlichen Konsequenzen aus Pflichtverletzungen werden präzise erläutert.
E. Das Verhältnis grundrechtlicher Schutzpflichten und grundrechtlicher Drittwirkung: Dieses Kapitel untersucht die komplexe Beziehung zwischen staatlichen Schutzpflichten und der mittelbaren Drittwirkung von Grundrechten. Es beleuchtet die historische Entwicklung der mittelbaren Drittwirkung und analysiert, wie Schutzpflichten diese Drittwirkung beeinflussen. Der Fokus liegt auf dem Zusammenspiel beider Konzepte und deren praktischer Relevanz für den Grundrechtsschutz.
F. Die gerichtliche Geltendmachung grundrechtlicher Schutzpflichten: Der letzte analysierte Abschnitt beschreibt die Möglichkeiten, grundrechtliche Schutzpflichten gerichtlich geltend zu machen. Es werden Schutzpflichten als subjektive Rechte diskutiert und verfassungsprozessuale Besonderheiten bei der Durchsetzung dieser Rechte erläutert. Die Kapitel betrachtet die rechtlichen Wege, um staatliches Handeln im Falle von Schutzpflichtverletzungen zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.
Schlüsselwörter
Grundrechte, Schutzpflichten, Bundesverfassungsgericht, Rechtsprechung, Drittwirkung, Staatszweck, Menschenwürde, Grundrechtsfunktionen, Legislative, Exekutive, Judikative, Rechtswissenschaft, Dogmatik, Abwehrrechte, Leistungsrechte.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Grundrechtliche Schutzpflichten des Staates
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Studienarbeit analysiert die grundrechtlichen Schutzpflichten des Staates. Sie beleuchtet die Einordnung der Schutzpflichtenlehre in die Systematik der Grundrechtsfunktionen, untersucht die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG), vergleicht rechtswissenschaftliche Ansätze und behandelt Adressaten, Bindungswirkung und das Verhältnis zu Drittwirkungen von Grundrechten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Kapitel A ordnet die Schutzpflichtenlehre in die Systematik der Grundrechtsfunktionen ein. Kapitel B analysiert die Rechtsprechung des BVerfG zur Entwicklung und dogmatischen Begründung der Schutzpflichtenlehre. Kapitel C untersucht verschiedene rechtswissenschaftliche Herleitungen von Schutzpflichten. Kapitel D behandelt die Adressaten und die Bindungswirkung der Schutzpflichten. Kapitel E befasst sich mit dem Verhältnis von Schutzpflichten und Drittwirkung von Grundrechten. Kapitel F beschreibt die gerichtliche Geltendmachung grundrechtlicher Schutzpflichten.
Welche Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wird untersucht?
Die Arbeit analysiert die Entwicklung der Schutzpflichtenlehre in der Rechtsprechung des BVerfG, beginnend mit frühen Ansätzen bis hin zum ersten Abtreibungsurteil und dessen Auswirkungen auf die spätere Judikatur. Der Kontrollumfang des BVerfG und kritische Einwände gegen dessen dogmatische Herleitung und das Untermaßverbot werden diskutiert.
Welche rechtswissenschaftlichen Ansätze werden verglichen?
Die Arbeit beleuchtet verschiedene rechtswissenschaftliche Ansätze zur Herleitung von staatlichen Schutzpflichten. Dies umfasst die Herleitung aus dem Staatszweck und den Grundrechten, einschließlich der Ableitung aus der abwehrrechtlichen Funktion der Grundrechte, der Menschenwürde (Art. 1 Abs. 1 S. 2 GG), dem Zusammenspiel von Grundrechtsschranken und Sozialstaatsprinzip sowie der Doppelfunktion des grundrechtlichen Freiheitsbegriffs.
Wer sind die Adressaten grundrechtlicher Schutzpflichten?
Die Arbeit untersucht die staatlichen Organe, die von grundrechtlichen Schutzpflichten betroffen sind: Legislative, Exekutive und Judikative. Sie analysiert die spezifischen Pflichten jedes Organs und deren Wirkung auf die verschiedenen Ebenen der Staatsgewalt.
Welches Verhältnis besteht zwischen Schutzpflichten und Drittwirkung?
Die Arbeit analysiert das komplexe Verhältnis zwischen staatlichen Schutzpflichten und der mittelbaren Drittwirkung von Grundrechten. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der mittelbaren Drittwirkung und wie Schutzpflichten diese beeinflussen.
Wie können grundrechtliche Schutzpflichten gerichtlich geltend gemacht werden?
Der letzte Abschnitt der Arbeit beschreibt die Möglichkeiten, grundrechtliche Schutzpflichten gerichtlich geltend zu machen. Es werden Schutzpflichten als subjektive Rechte diskutiert und verfassungsprozessuale Besonderheiten bei deren Durchsetzung erläutert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Grundrechte, Schutzpflichten, Bundesverfassungsgericht, Rechtsprechung, Drittwirkung, Staatszweck, Menschenwürde, Grundrechtsfunktionen, Legislative, Exekutive, Judikative, Rechtswissenschaft, Dogmatik, Abwehrrechte, Leistungsrechte.
- Quote paper
- Lukas Oskar Voß (Author), 2018, Grundrechte als Grundlage staatlicher Schutzpflichten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/494513