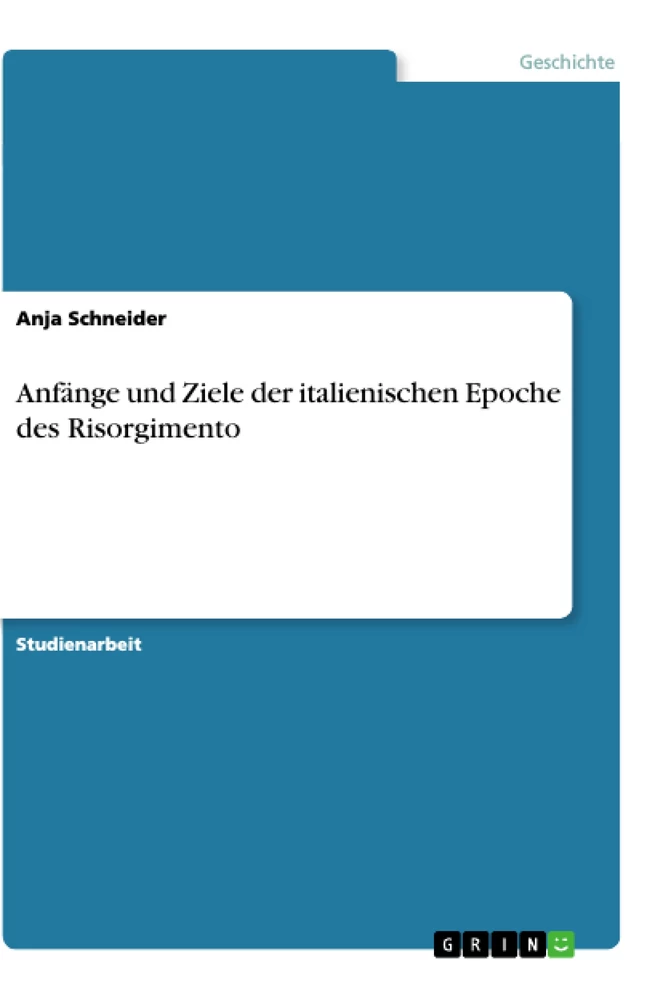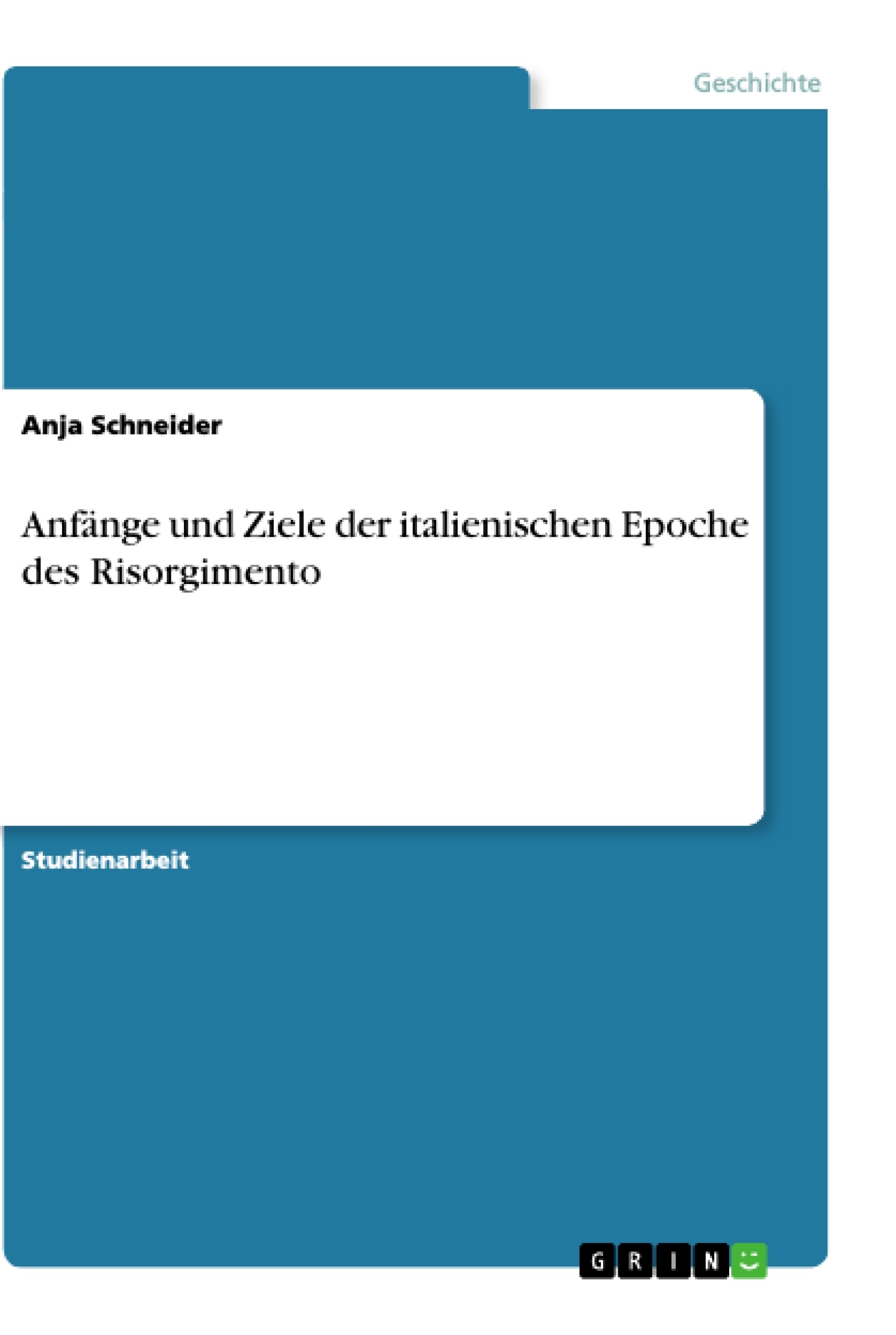In dieser Arbeit werden die Anfänge und Ziele der Epoche des Risorgimento in Italien in Augenschein genommen. Hierfür konzentriert sich der Autor auf die Reformen des 18. Jahrhunderts, dem Wiener Kongress, Italiens Restauration und dem "neoguelfischen" Moment. Ebenso werden einige wichtige Persönlichkeiten, wie Carlo Emanuele III, Filippo Buonarroti und Napoleon Bonaparte beschrieben, die für die Geschichte Italiens prägend waren.
Das italienische Risorgimento gilt in der italienischen Geschichte als eine Epoche, welche von 1815 bis 1870 stattfand. Einige Historiker jedoch datieren den Beginn des Risorgimentos bereits mit der Französischen Revolution 1789 und das Ende erst nach dem Ersten Weltkrieg 1919.
Inhaltsverzeichnis
- Der Begriff „Risorgimento“
- Italien im europäischen Kontext
- Die Reformen des 18. Jahrhunderts
- Carlo Emanuele III. (1730 - 1773)
- Die Jakobiner
- Filippo Buonarroti...
- Napoleon Bonaparte
- Der Wiener Kongress...
- Italiens Restauration
- Aufschwung...
- Das „neoguelfische“ Moment
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem italienischen Risorgimento, einer bedeutenden Epoche in der italienischen Geschichte, die sich mit der Wiedergeburt und Vereinigung Italiens auseinandersetzt. Die Arbeit analysiert die Ursachen und den Verlauf der italienischen Einigung sowie die zentralen Akteure und Ideen, die diese historische Entwicklung prägten.
- Der Begriff „Risorgimento“ und seine Bedeutung im Kontext der italienischen Geschichte
- Die Rolle der europäischen Großmächte, insbesondere Frankreich, Österreich und Großbritannien, im Prozess der italienischen Einigung
- Die Reformen des 18. Jahrhunderts und deren Einfluss auf die politische und soziale Entwicklung Italiens
- Die Bedeutung des „aufgeklärten Absolutismus“ für das Entstehen einer neuen politischen und bürgerlichen Schicht in Italien
- Die Rolle des Risorgimentos im Kontext der europäischen Geschichte und die Relevanz seiner Ideen für die moderne Welt.
Zusammenfassung der Kapitel
Der Begriff „Risorgimento“
Das Kapitel definiert den Begriff „Risorgimento“ und beleuchtet seine Bedeutung im Kontext der italienischen Geschichte. Es werden die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Dauer dieser Epoche beleuchtet, die zwischen 1815 und 1870 sowie zwischen der Französischen Revolution und dem Ersten Weltkrieg angesiedelt werden. Der Mythos des Risorgimentos wird als Wiederauferstehung Italiens nach einer Phase des Niedergangs interpretiert. Die Arbeit beleuchtet die wirtschaftliche und politische Schwäche der italienischen Stadtstaaten im 15. und 18. Jahrhundert und die Rolle Österreichs und der Bourbonen in der Unterdrückung Italiens. Es wird erläutert, wie sich die Geschichte des Risorgimentos an die Vergangenheit Italiens anlehnt, wobei zunächst das Mittelalter mit den Kommunen und dem Papsttum als einigende Macht im Vordergrund steht. Die Bedeutung der antiken römischen Republik als Symbol für Einheit und Größe wird im Laufe des 19. Jahrhunderts immer wichtiger. Der Text verweist auf das Gedicht „Fratelli d’Italia“ von Goffredo Mameli, das die italienische Nationalhymne bildet, und ruft die Italiener zu einem würdigen Leben ihrer römischen Vergangenheit auf. Der Bezug auf die Erneuerungen der italienischen Staaten ab der Mitte des 18. Jahrhunderts wird als grundlegend für das Verständnis des Risorgimentos hervorgehoben.
Italien im europäischen Kontext
Dieses Kapitel beleuchtet die Einbettung des Risorgimentos in die europäischen Geschichte. Der Text stellt die Bedeutung der europäischen Großmächte, insbesondere Österreich und Frankreich, als zentrale Kräfte der europäischen Politik heraus. Österreich wird als Feindbild des italienischen Volkes dargestellt, verantwortlich für die Zerrissenheit Italiens. Der Einfluss der Französischen Revolution und die von Napoleon Bonaparte verbreiteten Ideen der Menschen- und Bürgerrechte werden als wichtige Impulse für die italienische Nationalbewegung beschrieben. Trotz des Einflusses der französischen Revolution wird die Abhängigkeit von Frankreich abgelehnt. Der Text verweist auf Alessandro Manzoni, der die Selbstbefreiung Italiens von der Fremdherrschaft forderte. Der Einfluss Großbritanniens als Macht, die am Gleichgewicht der Mächte in Europa interessiert war, wird untersucht. Die britische Regierung unterstützte in den 1850er Jahren die Pläne von Camillo Cavour zur Gründung eines italienischen Nationalstaates, da sie die weitere Expansion des Risorgimentos nicht verhindern konnte, aber gleichzeitig seine Eigendynamik kontrollieren wollte.
Die Reformen des 18. Jahrhunderts
Dieses Kapitel befasst sich mit den Reformen des 18. Jahrhunderts, die als entscheidende Voraussetzung für das Risorgimento betrachtet werden. Der Text beleuchtet die politischen und sozialen Veränderungen in den italienischen Staaten und die Folgen des Spanischen Erbfolgekriegs. Durch den Frieden von Utrecht und Raststatt erhielt Österreich das Königreich Neapel und Sardinien. Im Österreichischen Erbfolgekrieg wurde Neapel wieder an die Bourbonen abgetreten, die auch das Herzogtum Parma regierten. Genua musste Korsika an Frankreich abtreten. Das Papsttum musste sich den Großmächten beugen. Die Herrschaft des Hauses Savoyen unter Carlo Emanuele III. in Piemont und die Ausweitung des Machtgebiets bis zum Fluss Tessin werden beschrieben. Das Königreich Piemont wurde als einer der am besten organisierten Staaten Italiens dargestellt. Die Regierung seines Sohnes Vittorio Amadeo III. war von Militarismus und Autoritarismus geprägt. Der Text beschreibt den Machtwechsel der Medici in der Toskana und in Parma durch „ausländische“ Herrscher und dessen positive Auswirkungen auf das Land. Die lange Friedenszeit ermöglichte die Weiterentwicklung des „aufgeklärten Absolutismus“. Die Arbeit erklärt das Konzept des „aufgeklärten Despotismus“, der zum Wohl der Untertanen regieren sollte, und dessen Funktion zur Stärkung des königlichen Absolutismus. Die Fürsten brauchten zur Durchsetzung ihrer Macht Bündnispartner, die sie im Bürgertum fanden, wo die Ideen der Aufklärung besonders verbreitet waren. Die umfangreichsten Reformen fanden in den Staaten Italiens statt, wo die Aufklärung stark verbreitet war. Der Text erwähnt die Jansenisten, die auf die Unterstützung aufgeklärter Fürsten für Kirchenreformpläne hofften. Pietro Leopoldo von Habsburg-Lothringen, Großherzog von Toskana, wird als ein Beispiel für einen aufgeklärten Herrscher genannt, der durch seine Reformpolitik die Toskana zu einem Musterstaat machte. Ähnliche Reformversuche gab es in der Lombardei und im Königreich Neapel, wo Wirtschaftsleute wie Ferdinando Celestino Galiani und Antonie Genovesi die Verbreitung der Aufklärung im Süden förderten. Das Reformprogramm von König Carlo III. wurde vom Minister Bernardo Tanucci umgesetzt. Der „aufgeklärte Absolutismus“ wird als wichtiger Faktor für das Risorgimento betrachtet. Er machte das Gewaltmonopol der Fürsten sichtbar und ermöglichte den wirtschaftlichen Aufstieg der italienischen Staaten, der wiederum zur Entstehung einer neuen politischen Oberschicht führte. Die bürgerliche Schicht spielte eine entscheidende Rolle im Risorgimento.
Schlüsselwörter
Risorgimento, Italien, europäische Geschichte, Französische Revolution, Österreich, Bourbonen, Italienische Stadtstaaten, „aufgeklärter Absolutismus“, Reformen, Bürgertum, Jansenismus, Pietro Leopoldo, Carlo Emanuele III., Vittorio Amadeo III., Ferdinando Celestino Galiani, Antonie Genovesi, Bernardo Tanucci, Camillo Cavour, Nationalbewegung.
- Quote paper
- Anja Schneider (Author), 2019, Anfänge und Ziele der italienischen Epoche des Risorgimento, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/494356