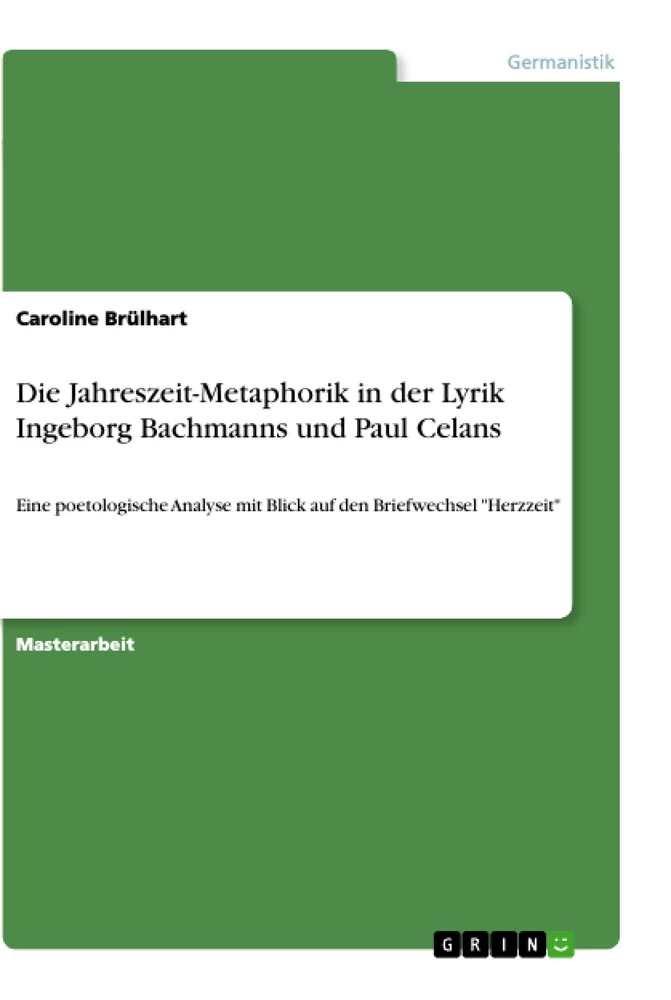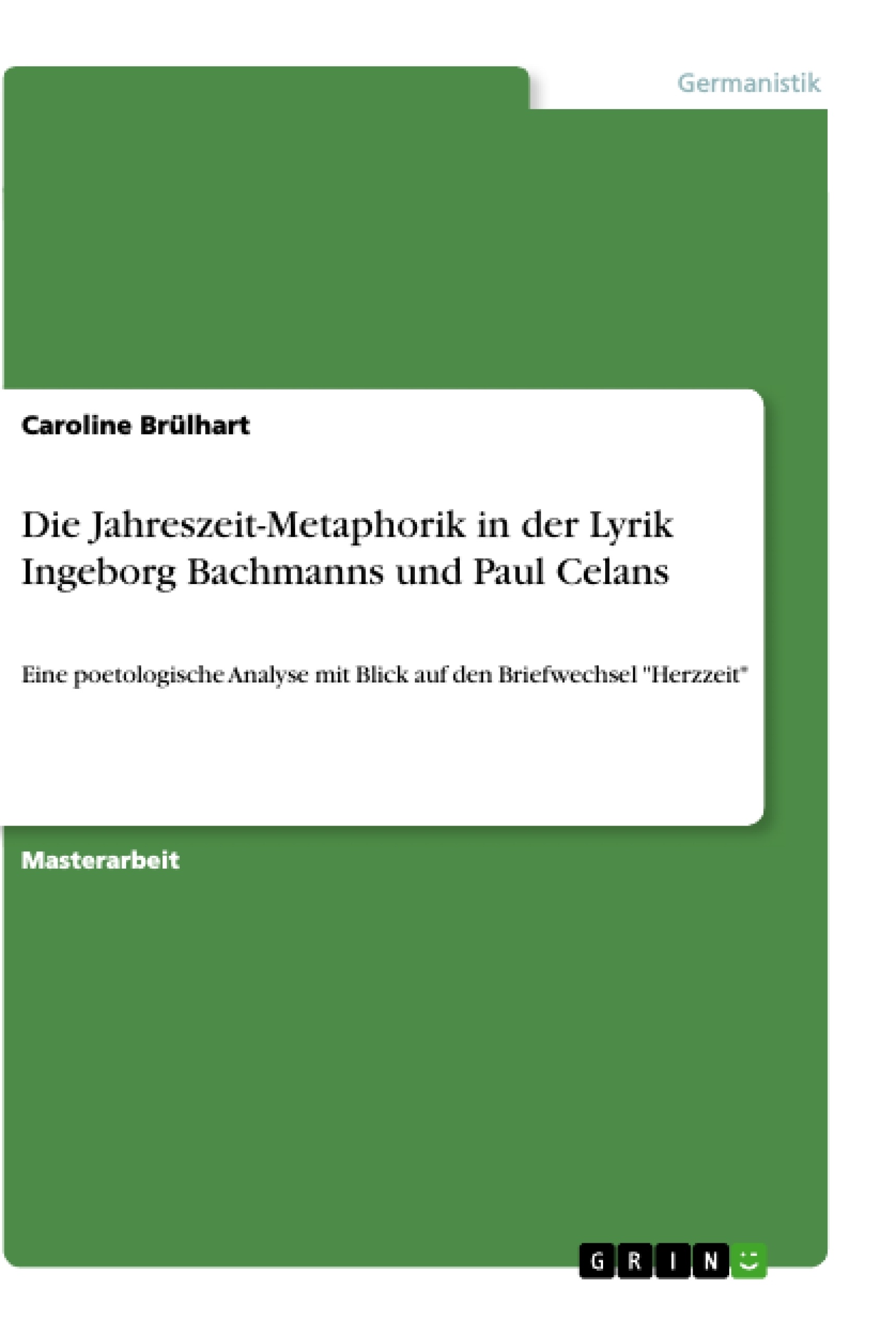Die Hauptfragen, die sich durch die ganze Arbeit ziehen werden, lauten folgendermaßen: Welche Rolle spielt die Jahreszeit-Metaphorik bei der Suche nach einer angemessenen Sprache in der Lyrik Bachmanns nach dem Holocaust? Welche Parallelen oder Gegensätzlichkeiten lassen sich im Vergleich zu Celans Gedichten herauslesen und welche Bedeutung spielt ihre Dichter- beziehungsweise Liebesbeziehung dabei?
Diese Fragen sollen im Verlaufe der Arbeit, in der alle vier Jahreszeiten in einem separaten Kapitel unterkommen, eingehend analysiert und immer mit Blick auf das Celansche Werk untersucht werden, das dem Briefwechsel zufolge einen immensen Eindruck auf Bachmann gemacht hat. Spätestens nach der von der Germanistikforschung langersehnten Veröffentlichung des Briefwechsels zwischen den beiden Lyrikern im Jahr 2008 weiß man, welch intensive Verbindung sie sowohl in Bezug auf die literarische Tätigkeit als auch privat zueinander hatten. Zentrales Ziel dieser Arbeit wird es also sein, die geistige Verwandtschaft der beiden Autoren anhand ausgewählter Gedichte, in denen die Jahreszeiten, aber auch der Wechsel von Finsternis und Licht thematisiert werden, noch verstärkt hervorzuheben und zu prüfen, inwiefern sie sich in ihrem dichterischen Schaffen beeinflusst haben könnten. Der Briefwechsel wird dabei zur Analyse herangezogen, da er einen Schlüssel zur Poetik beider Autoren liefert und als Quelle für wichtiges, biographisches Wissen dient.
Der Briefwechsel ermöglicht es, die These aufzustellen, Celan habe der sechs Jahre jüngeren Studentin sein poetisches Programm der Holocaust-Erinnerung und der Trauerarbeit vorgegeben und seine Gedichte seien bedeutende Prätexte und Inspirationsquellen für Bachmann gewesen. Sowohl die Briefe als auch die gegenseitig gewidmeten Gedichte und Gedichtzyklen liefern wichtige Belege dafür und werden daher im ersten Kapitel eingehend analysiert. Im weiteren Verlauf der Arbeit soll die ältere Forschungsliteratur vor 2008 betrachtet werden, um sie mit den neuen Erkenntnissen, die der Briefwechsel liefert, zu ergänzen oder gegebenenfalls zu revidieren. Die einzelnen Kapitel werden dabei unter Beachtung der Jahreszeiten in vier Teile gegliedert. Abschließend folgt eine Zusammenfassung, welche die daraus resultierenden Ergebnisse noch einmal aufgreift und deutlich macht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Herzzeit: Der Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan
- Der Herbst: Bäume und Blätter
- Die Ambivalenz des Blattes
- Schreibblockade vs. Unendlichkeit der Möglichkeiten
- Zeichen der Vergänglichkeit und der Erneuerung
- Auf den Spuren von Saussure
- Das Problem der Darstellung von Wirklichkeit
- Die Veränderung des Sprachgebrauchs
- Die Ambivalenz des Blattes
- Der Winter: Eis, Schnee und Kälte
- Das Schweigen bei Bachmann
- Das Schweigen bei Celan
- Der Frühling: Das Eis schmilzt
- Wasser als veränderter Aggregatzustand
- Wasser als bewegliches Element
- Der Sommer: Sonne, Meer und Blume
- Der Sommer als utopistische Hoffnung bei Bachmann
- Grenzüberschreitung: Der Aufbruch oder die Flucht in den Süden
- Celans Wiedergutmachung
- Das Dilemma in Celans Dichtung – „Der Stein“ und „die Blume“
- Der Einbruch in die Idylle oder das Scheitern der Hoffnung
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Jahreszeit-Metaphorik in der Lyrik von Ingeborg Bachmann und Paul Celan, insbesondere im Kontext ihres Briefwechsels „Herzzeit“. Die Arbeit analysiert die poetologische Bedeutung der Jahreszeiten in der lyrischen Sprache und beleuchtet deren Beziehung zur Kriegs- und Holocaustthematik.
- Die Rolle der Jahreszeit-Metaphorik in der Suche nach einer angemessenen Sprache nach dem Holocaust
- Parallelen und Gegensätzlichkeiten in der Verwendung der Jahreszeit-Metaphorik bei Bachmann und Celan
- Der Einfluss der Beziehung zwischen Bachmann und Celan auf ihre poetologische Konzeption
- Die Ambivalenz der Sprache und ihre Beziehung zu den Jahreszeiten
- Die Verbindung von Naturbildern mit den inneren Vorgängen der Dichter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel, die sich jeweils einer Jahreszeit widmen. Die Kapitel untersuchen die Verwendung von jahreszeitlichen Motiven in den Gedichten von Bachmann und Celan, analysieren deren poetologische Funktion und stellen sie in den Kontext der Sprachproblematik nach dem Holocaust.
- Der Herbst: Bäume und Blätter: Dieses Kapitel analysiert die Ambivalenz des Herbstblattes als Symbol für Schreibblockade und zugleich für die Unendlichkeit der Möglichkeiten. Es beleuchtet die Verwendung des Herbstmotivs in der Lyrik Bachmanns und Celan, um die Vergänglichkeit und Erneuerung der Sprache darzustellen.
- Der Winter: Eis, Schnee und Kälte: Dieses Kapitel konzentriert sich auf das Motiv des Schweigens bei Bachmann und Celan, das als Reaktion auf die Schrecken des Krieges und des Holocaust interpretiert wird.
- Der Frühling: Das Eis schmilzt: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung des Wassers als Symbol für Veränderung und Bewegung in der Lyrik Bachmanns und Celan. Es beleuchtet den Zusammenhang von Wasser und dem Prozess der Erneuerung nach der Zerstörung.
- Der Sommer: Sonne, Meer und Blume: Dieses Kapitel untersucht das Sommermotiv als Symbol für utopistische Hoffnung und Grenzüberschreitung bei Bachmann und Celan. Es analysiert den Sommer als Sehnsuchtsort und die Dialektik von Hoffnung und Scheitern.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Jahreszeit-Metaphorik, die Sprachproblematik nach dem Holocaust, die poetologische Konzeption von Ingeborg Bachmann und Paul Celan, den Briefwechsel "Herzzeit" und die Analyse von Lyrik im Kontext von Krieg und Gewalt.
- Citar trabajo
- Caroline Brülhart (Autor), 2013, Die Jahreszeit-Metaphorik in der Lyrik Ingeborg Bachmanns und Paul Celans, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/494093