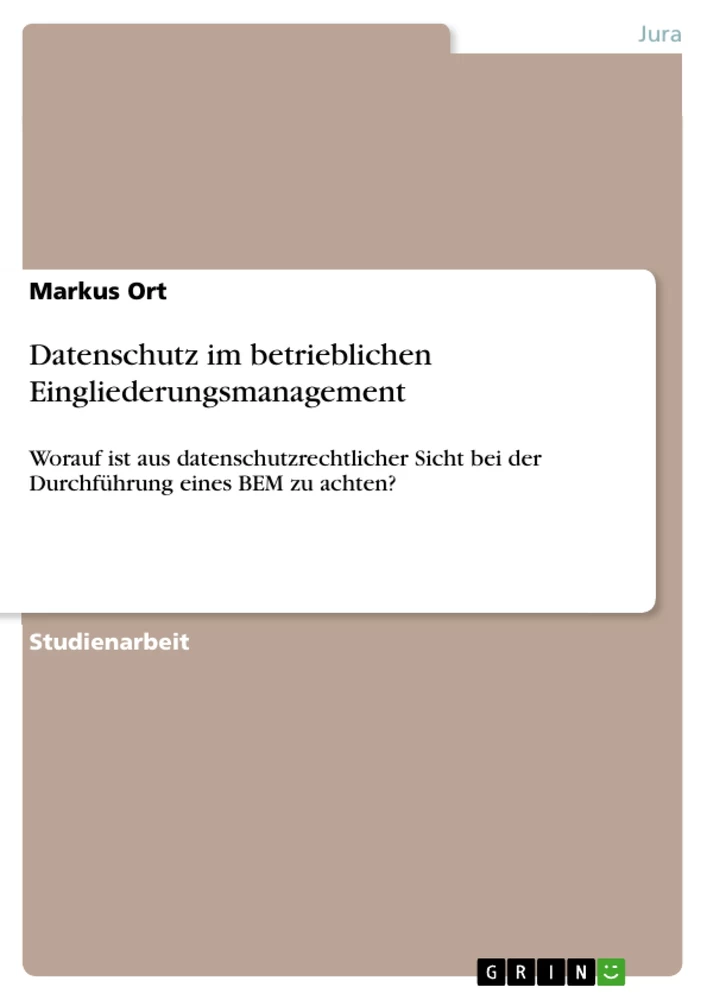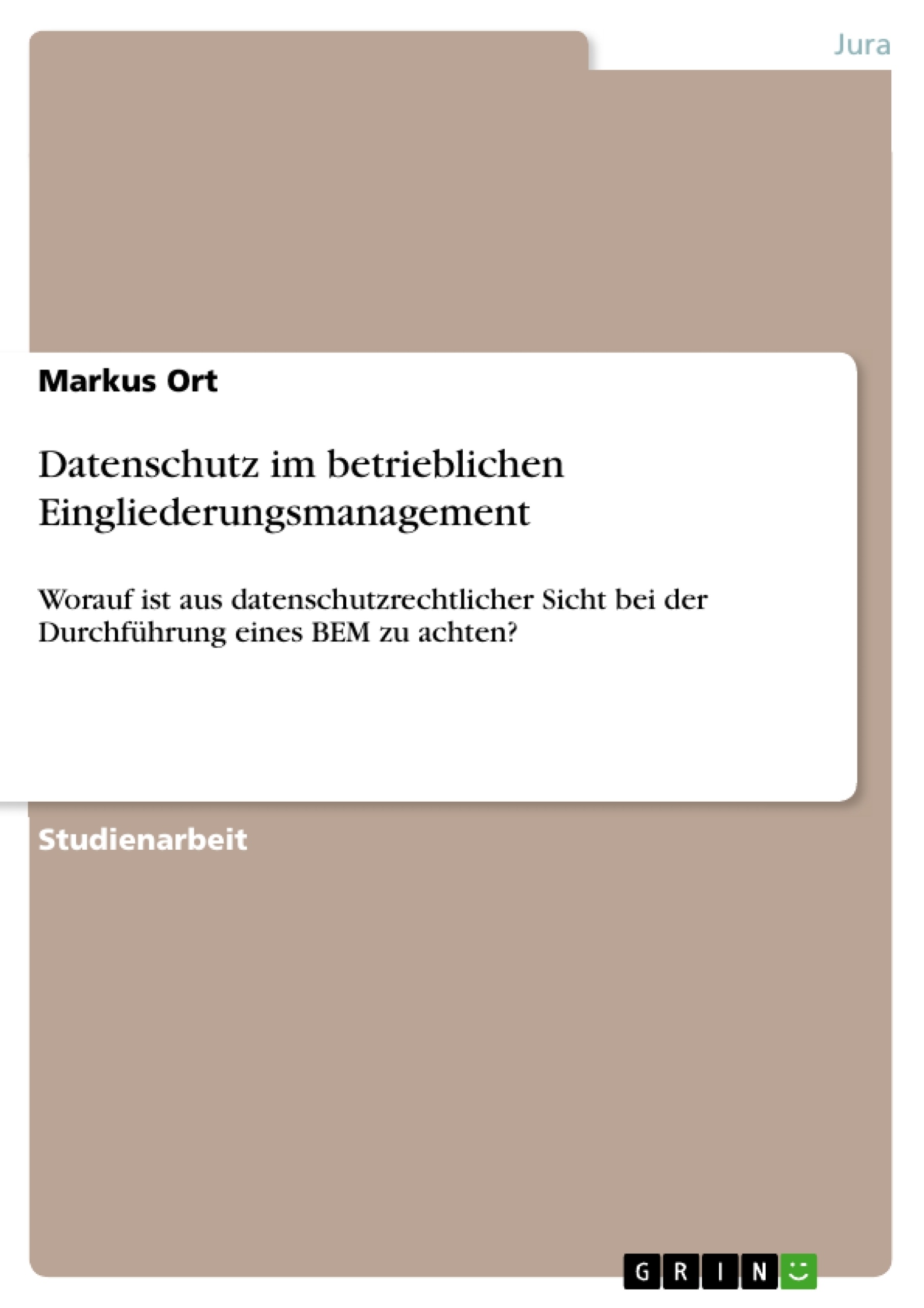Ziel dieser Arbeit ist es, aufzuzeigen, welche datenschutzrechtlichen Aspekte bei der Durchführung eines BEM-Verfahrens zu beachten sind.
Das betriebliche Eingliederungsmanagement gibt es schon seit 2004. Es ist dabei sehr sensibel für den Beschäftigten, da es nicht erfolgreich ohne dessen personenbezogene Daten durchgeführt werden kann. Daher stellt sich die Frage, inwieweit diese Daten für die Beschäftigen, welche an einem Verfahren des betrieblichen Eingliederungsmanagements teilnehmen, grundsätzlich geschützt sind.
Diese Frage ist vor allem deswegen aktuell, weil sich durch die Novellierung des Datenschutzrechts im Zuge des Erlasses der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung für viele eine große Unsicherheit bezüglich der Verarbeitung von Daten natürlicher Personen gestellt hat.
Hierfür wird die nachfolgende Arbeit sich zunächst in Kapitel 2 mit der Definition der wichtigsten Begrifflichkeiten beschäftigen. Anschließend wird sie sich in Kapitel 3 damit beschäftigen, welche Datenschutzgrundrechte (Recht auf informationelle Selbstbestimmung) für die Beschäftigten gelten. Weiter wird in Kapitel 4 aufgezeigt, welche Legitimierungsgründe für die Verarbeitung personenbezogener Daten grundsätzlich herangezogen werden könnten. Es wird ferner in Kapitel 5 erläutert, welche von diesen Gründen für eine Rechtfertigung der Datenverarbeitung im Rahmen des BEM in Betracht kommen. Abschließend wird in Kapitel 6 anhand der einzelnen Verfahrensschritte des BEM aufgezeigt, was aus datenschutzrechtlicher Sicht jeweils bei der Durchführung dieser Schritte zu beachten ist. Zum Schluss wird Kapitel 7 noch ein kurzes Fazit ziehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffsbestimmungen
- 2.1 BEM
- 2.2 Daten
- 2.3 Verarbeitung von Daten
- 3 Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung/Datenschutzgrundrecht
- 3.1 Art. 7 und 8 GrCH
- 3.2 Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG
- 3.3 Art. 8 Abs. 1 EMRK
- 4 Ermächtigungsgrundlage für die Verarbeitung von Daten
- 4.1 Art. 6 DS-GVO
- 4.2 § 26 BDSG
- 5 Für das BEM relevante Rechtfertigungsgründe nach § 26 BDSG
- 5.1 Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses
- 5.2 Durchführung eines begründeten Beschäftigungsverhältnisses
- 5.3 Beendigung eines begründeten Beschäftigungsverhältnisses
- 5.4 Wahrnehmung von Rechten/Pflichten der betrieblichen Interessenvertretung gegenüber Betroffenen
- 5.5 Einwilligung
- 5.6 Besonderheiten im Arbeitsverhältnis
- 6 Umgang mit den Daten in den einzelnen Schritten des BEM
- 6.1 Schritt 1: Feststellung der Fehlzeiten
- 6.2 Schritt 2: Erstkontaktaufnahme zum Betroffenen
- 6.3 Schritt 3: Führung eines Erstgesprächs
- 6.4 Schritt 4: Besprechung der Situation
- 6.5 Schritt 5: Vereinbarung und Umsetzung der Maßnahmen
- 6.6 Schritt 6: Erfolgskontrolle
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist die Darstellung datenschutzrechtlicher Aspekte im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM). Die Arbeit untersucht, welche datenschutzrechtlichen Vorschriften bei der Durchführung eines BEM zu beachten sind und welche Rechtfertigungsgründe für die Verarbeitung personenbezogener Daten in diesem Kontext in Betracht kommen.
- Datenschutzrechtliche Bestimmungen im BEM
- Relevante Rechtsgrundlagen (DS-GVO, BDSG)
- Rechtfertigung der Datenverarbeitung im BEM
- Praktische Anwendung des Datenschutzes in den einzelnen Schritten des BEM
- Auswirkungen der Datenschutzgrundverordnung auf das BEM
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Datenschutzes im betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) ein und hebt die Bedeutung des Themas angesichts der Novellierung des Datenschutzrechts durch die DSGVO hervor. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und benennt die zentralen Fragestellungen, die im weiteren Verlauf beantwortet werden sollen. Die Einleitung verdeutlicht die Notwendigkeit einer detaillierten Betrachtung der datenschutzrechtlichen Aspekte im BEM, um sowohl die Rechte der betroffenen Mitarbeiter als auch die rechtlichen Vorgaben des Arbeitgebers zu wahren.
2 Begriffsbestimmungen: Dieses Kapitel klärt die zentralen Begriffe, die im Kontext des BEM und des Datenschutzes relevant sind. Es definiert präzise den Begriff des BEM selbst, beschreibt die Art der im BEM verarbeiteten Daten und erläutert den Begriff der Datenverarbeitung im datenschutzrechtlichen Sinne. Diese präzisen Definitionen legen die Grundlage für das Verständnis der späteren Kapitel und gewährleisten eine eindeutige und fachlich korrekte Argumentation.
3 Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung/Datenschutzgrundrecht: Dieses Kapitel analysiert die einschlägigen Grundrechte, die den Schutz der im BEM verarbeiteten Daten gewährleisten. Es beleuchtet Artikel 7 und 8 des Grundgesetzes (GG), Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 GG sowie Artikel 8 Absatz 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Die Kapitel erläutert, wie diese Grundrechte die Verarbeitung personenbezogener Daten im BEM beeinflussen und welche Anforderungen an den Datenschutz sich daraus ergeben.
4 Ermächtigungsgrundlage für die Verarbeitung von Daten: Dieses Kapitel befasst sich mit den Rechtsgrundlagen, die die Verarbeitung personenbezogener Daten im BEM ermöglichen. Es untersucht Artikel 6 der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und § 26 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Die Analyse zeigt auf, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um eine rechtmäßige Datenverarbeitung zu gewährleisten und welche konkreten Anforderungen sich daraus für den Arbeitgeber ergeben.
5 Für das BEM relevante Rechtfertigungsgründe nach § 26 BDSG: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die spezifischen Rechtfertigungsgründe nach § 26 BDSG, die im Kontext des BEM relevant sind. Es analysiert die verschiedenen Szenarien, in denen die Verarbeitung personenbezogener Daten gerechtfertigt sein kann, z.B. bei der Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses. Die Kapitel veranschaulicht die verschiedenen Möglichkeiten der Rechtfertigung der Datenverarbeitung und stellt die jeweiligen Anforderungen dar.
6 Umgang mit den Daten in den einzelnen Schritten des BEM: Dieses Kapitel beschreibt den Umgang mit Daten in den einzelnen Schritten des BEM-Prozesses, beginnend mit der Feststellung von Fehlzeiten bis hin zur Erfolgskontrolle. Jeder Schritt wird unter dem Aspekt des Datenschutzes betrachtet und es werden konkrete Handlungsempfehlungen gegeben, um eine rechtskonforme Datenverarbeitung zu gewährleisten. Die Kapitel betont die Notwendigkeit einer sorgfältigen Dokumentation und der Einhaltung aller datenschutzrechtlichen Vorschriften in jeder Phase des BEM.
Schlüsselwörter
Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM), Datenschutz, Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), informationelle Selbstbestimmung, personenbezogene Daten, Rechtfertigung der Datenverarbeitung, Arbeitnehmerrechte.
Datenschutz im Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM): Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit befasst sich umfassend mit den datenschutzrechtlichen Aspekten des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM). Sie untersucht die relevanten Rechtsgrundlagen, Rechtfertigungsgründe für die Datenverarbeitung und die praktische Anwendung des Datenschutzes in den einzelnen Schritten des BEM-Prozesses.
Welche Rechtsgrundlagen sind im BEM relevant?
Die Arbeit analysiert die wichtigsten Rechtsgrundlagen, darunter die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), sowie relevante Artikel des Grundgesetzes (GG) und der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), die den Schutz der informationellen Selbstbestimmung gewährleisten.
Welche Daten werden im BEM verarbeitet und wie werden sie definiert?
Die Arbeit definiert präzise die im BEM verarbeiteten Daten und erläutert den Begriff der Datenverarbeitung im datenschutzrechtlichen Sinne. Dies umfasst beispielsweise Daten zu Fehlzeiten, Gesprächen und vereinbarten Maßnahmen im Rahmen des BEM.
Welche Rechtfertigungsgründe gibt es für die Datenverarbeitung im BEM?
Die Arbeit untersucht die Rechtfertigungsgründe nach § 26 BDSG für die Verarbeitung personenbezogener Daten im BEM. Hierzu gehören Entscheidungen über die Begründung, Durchführung und Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses, die Wahrnehmung von Rechten/Pflichten der betrieblichen Interessenvertretung und die Einwilligung des Betroffenen.
Wie sieht der Umgang mit Daten in den einzelnen Schritten des BEM aus?
Die Arbeit beschreibt Schritt für Schritt den Umgang mit Daten im BEM-Prozess, von der Feststellung von Fehlzeiten über das Erstgespräch bis zur Erfolgskontrolle. Für jeden Schritt werden konkrete Handlungsempfehlungen unter Berücksichtigung des Datenschutzes gegeben.
Welche Grundrechte sind beim BEM zu beachten?
Die Arbeit analysiert die relevanten Grundrechte, insbesondere das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG, Art. 7 und 8 GG, Art. 8 EMRK), und deren Auswirkungen auf die Datenverarbeitung im BEM.
Wie wirkt sich die DSGVO auf das BEM aus?
Die Arbeit beleuchtet die Auswirkungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) auf das BEM und zeigt auf, welche Anpassungen im Umgang mit personenbezogenen Daten notwendig sind, um die Vorgaben der DSGVO zu erfüllen.
Welche Schlüsselwörter sind für das Verständnis des Themas wichtig?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM), Datenschutz, Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), informationelle Selbstbestimmung, personenbezogene Daten, Rechtfertigung der Datenverarbeitung, Arbeitnehmerrechte.
- Arbeit zitieren
- Markus Ort (Autor:in), 2019, Datenschutz im betrieblichen Eingliederungsmanagement, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/494072