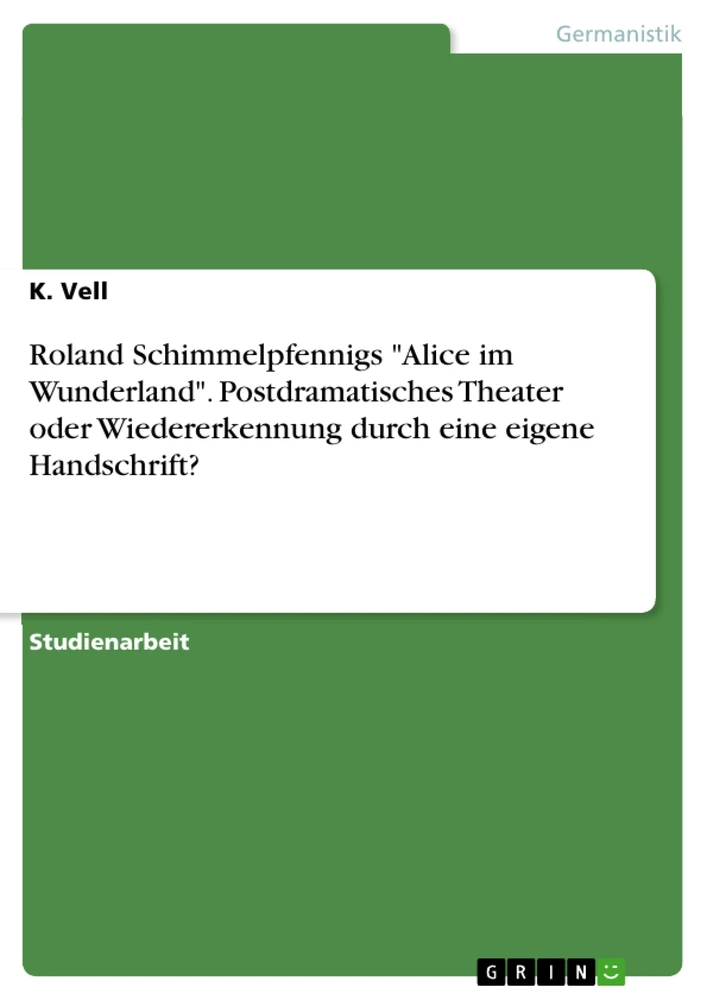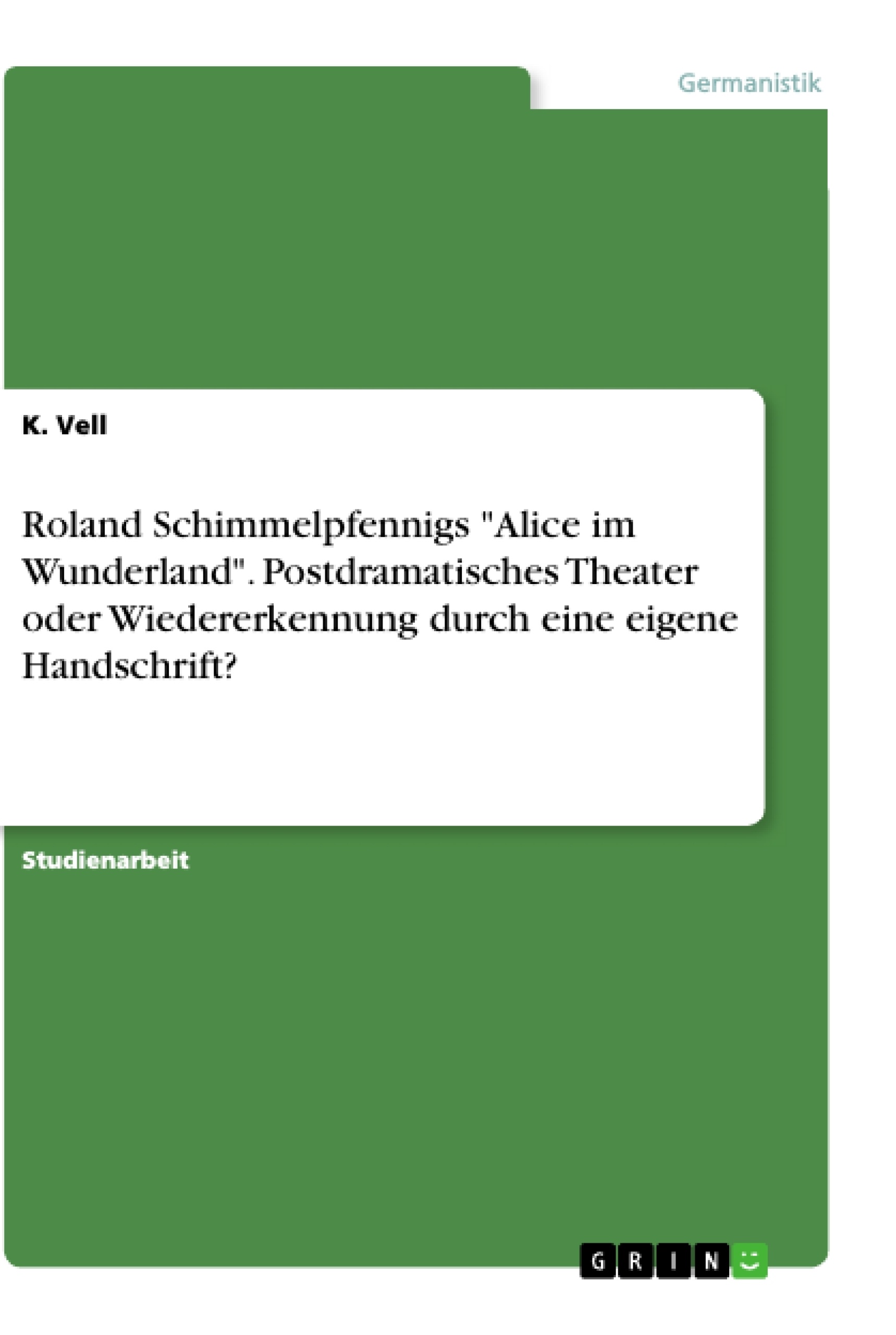Diese Arbeit befasst sich mit einer Textanalyse von Roland Schimmelpfennigs Werk "Alice im Wunderland".
In der vorliegenden Arbeit werden dabei zunächst postdramatische Kennzeichen zusammengetragen, um anschließend Schimmelpfennigs "Alice im Wunderland" auf die Verwendung solcher Elementen zu untersuchen. In Erweiterung dieser Fragestellung sollen allgemeine und wiederkehrende Charakteristika von Schimmelpfennigs Theatertexten erarbeitet werden, um Alice im Wunderland auch im Kontext seines Œuvres zu betrachten. Der Text bietet die besondere Chance, Merkmale und Prinzipien von Schimmelpfennig zu identifizieren, da Abänderungen der Vorlage direkt nachvollziehbar und auf ihre Intention und Wirkung hin untersuchbar sind.
Der Gegenwartsdramatiker Roland Schimmelpfennig wird von Tom Mustroph als "der Vielseitige" charakterisiert. Vielseitig, da neben atmosphärischen auch wie selbstverständlich magische Elemente auftauchen. Zudem handle es sich bei seinen Theatertexten nach Christine Laudahn nicht mehr um klassische Dramen. Darin liegen auch die Herausforderung für Literaturwissenschaftler: Roland Schimmelpfennigs Theatertexte lassen sich aufgrund ihrer Vielseitigkeit und ihrer individuellen Textgestaltung nur schwer mit den "normierten Dramenbegriffen". Aufgrund des ihm zugeschrieben Erfolges vom strebt die Forschung einerseits nach der Einordnung seiner Texte in die historische Dramenentwicklung und andererseits wird sein Œuvre auf individuelle Merkmale hin untersucht, um ihn im gegenwärtigen Diskurs verorten zu können.
Im Fokus steht insbesondere die Debatte, ob sich Schimmelpfennigs Werke als dramatisch oder als postdramatisch charakterisieren lassen. Da er überwiegend selbstständig Theaterstücke entwirft, ist es besonders auffällig, wenn ein Roman als direkte Vorlage dient: 2003 uraufgeführt, präsentierte Schimmelpfennig ein Stück, das gekennzeichnet durch den Titel, seine textliche Vorlage im gleichnamigen und weltbekannten Roman Alice im Wunderland (1865) von Lewis Carroll, alias Charles Dogson, fand.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Überblick: Postdramatik und Roland Schimmelpfennigs Theatertexte
- 2.1. Merkmale des postdramatischen Theaters
- 2.2. Wiederkehrende Elemente in Roland Schimmelpfennigs Theatertexten
- 3. Textanalyse von Roland Schimmelpfennigs „Alice im Wunderland“
- 3.1. Im Kontext von postdramatischen Merkmalen
- 3.2. Im Kontext seines dramatischen Œuvres
- 4. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Roland Schimmelpfennigs Theaterstück „Alice im Wunderland“ im Kontext der Postdramatik. Ziel ist es, die postdramatischen Elemente im Stück zu identifizieren und zu analysieren und diese mit wiederkehrenden Merkmalen in Schimmelpfennigs Gesamtwerk zu vergleichen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Einordnung des Stücks innerhalb der Dramenlandschaft und im Œuvre des Autors zu beleuchten.
- Postdramatische Merkmale in „Alice im Wunderland“
- Wiederkehrende Elemente in Schimmelpfennigs Theatertexten
- Vergleich von „Alice im Wunderland“ mit anderen Stücken Schimmelpfennigs
- Analyse der Adaption von Lewis Carrolls Roman
- Schimmelpfennigs dramaturgische Verfahren
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und präsentiert die Forschungsfrage: die Einordnung von Schimmelpfennigs „Alice im Wunderland“ im Kontext der Postdramatik und seines Gesamtwerks. Sie verweist auf bestehende Forschungsdiskurse zur Einordnung Schimmelpfennigs im Bereich des Gegenwartsdramas und hebt die Besonderheit der Adaption eines bekannten Romans hervor. Der Vergleich der Adaption mit dem Original wird als Methode zur Identifizierung von Schimmelpfennigs dramaturgischen Prinzipien vorgestellt.
2. Überblick: Postdramatik und Roland Schimmelpfennigs Theatertexte: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die Merkmale des postdramatischen Theaters nach Hans-Thies Lehmann und präsentiert wiederkehrende Elemente in Schimmelpfennigs Theatertexten. Es dient als Grundlage für die anschließende Analyse von „Alice im Wunderland“. Die Charakteristika des postdramatischen Theaters, wie die Abkehr von linearer Handlung, die Thematisierung von Zuständen und die Verwendung von assoziativen Montagen, werden detailliert erläutert. Gleichzeitig werden typische Elemente von Schimmelpfennigs Stücken zusammengestellt, um einen Vergleichsrahmen zu schaffen.
3. Textanalyse von Roland Schimmelpfennigs „Alice im Wunderland“: Dieses Kapitel analysiert Schimmelpfennigs „Alice im Wunderland“ im Hinblick auf die im vorherigen Kapitel dargestellten Merkmale der Postdramatik und im Kontext seines Gesamtwerks. Es untersucht, wie Schimmelpfennig die Vorlage adaptiert und welche spezifischen dramaturgischen Strategien er einsetzt. Die Analyse wird sich mit der Struktur, den Figuren, der Sprache und den thematischen Schwerpunkten des Stücks auseinandersetzen, um Schimmelpfennigs individuellen Stil und seine Auseinandersetzung mit postdramatischen Konzepten zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Postdramatik, Roland Schimmelpfennig, Alice im Wunderland, Theatertextanalyse, Dramenadaption, Gegenwartsdrama, Dramaturgie, Lewis Carroll, postdramatische Merkmale, wiederkehrende Elemente, Œuvreanalyse.
Häufig gestellte Fragen zu Roland Schimmelpfennigs "Alice im Wunderland" - Eine postdramatische Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Roland Schimmelpfennigs Theaterstück "Alice im Wunderland" im Kontext der Postdramatik. Sie untersucht die postdramatischen Elemente im Stück und vergleicht sie mit wiederkehrenden Merkmalen in Schimmelpfennigs Gesamtwerk. Ein Schwerpunkt liegt auf der Einordnung des Stücks innerhalb der Dramenlandschaft und im Œuvre des Autors sowie auf der Adaption von Lewis Carrolls Roman.
Welche Ziele werden verfolgt?
Das Hauptziel ist die Identifizierung und Analyse der postdramatischen Elemente in Schimmelpfennigs "Alice im Wunderland". Die Arbeit zielt darauf ab, die spezifischen dramaturgischen Strategien Schimmelpfennigs zu beleuchten und diese mit seinen anderen Werken zu vergleichen. Die Adaption von Lewis Carrolls Roman wird ebenfalls kritisch untersucht.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt postdramatische Merkmale in "Alice im Wunderland", wiederkehrende Elemente in Schimmelpfennigs Theatertexten, einen Vergleich von "Alice im Wunderland" mit anderen Stücken Schimmelpfennigs, die Analyse der Adaption von Lewis Carrolls Roman und Schimmelpfennigs dramaturgische Verfahren.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Überblick über Postdramatik und Schimmelpfennigs Theater, eine Textanalyse von "Alice im Wunderland" und eine Schlussbetrachtung. Die Einleitung formuliert die Forschungsfrage. Der Überblick definiert postdramatische Merkmale und stellt wiederkehrende Elemente in Schimmelpfennigs Werken vor. Die Textanalyse untersucht Struktur, Figuren, Sprache und Themen des Stücks im Lichte der Postdramatik und des Gesamtwerks. Die Schlussbetrachtung fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine Textanalyse von Schimmelpfennigs "Alice im Wunderland", die sich auf die im vorherigen Kapitel dargestellten Merkmale der Postdramatik und den Kontext seines Gesamtwerks bezieht. Ein Vergleich der Adaption mit Lewis Carrolls Original dient der Identifizierung von Schimmelpfennigs dramaturgischen Prinzipien.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Postdramatik, Roland Schimmelpfennig, Alice im Wunderland, Theatertextanalyse, Dramenadaption, Gegenwartsdrama, Dramaturgie, Lewis Carroll, postdramatische Merkmale, wiederkehrende Elemente und Œuvreanalyse.
Wie wird die Adaption von Lewis Carrolls Roman behandelt?
Die Arbeit analysiert, wie Schimmelpfennig Lewis Carrolls Roman adaptiert hat und welche spezifischen dramaturgischen Strategien er dabei einsetzt. Der Vergleich mit dem Originaltext hilft, Schimmelpfennigs individuelle Herangehensweise und seine Auseinandersetzung mit postdramatischen Konzepten zu verstehen.
- Quote paper
- K. Vell (Author), 2018, Roland Schimmelpfennigs "Alice im Wunderland". Postdramatisches Theater oder Wiedererkennung durch eine eigene Handschrift?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/493907