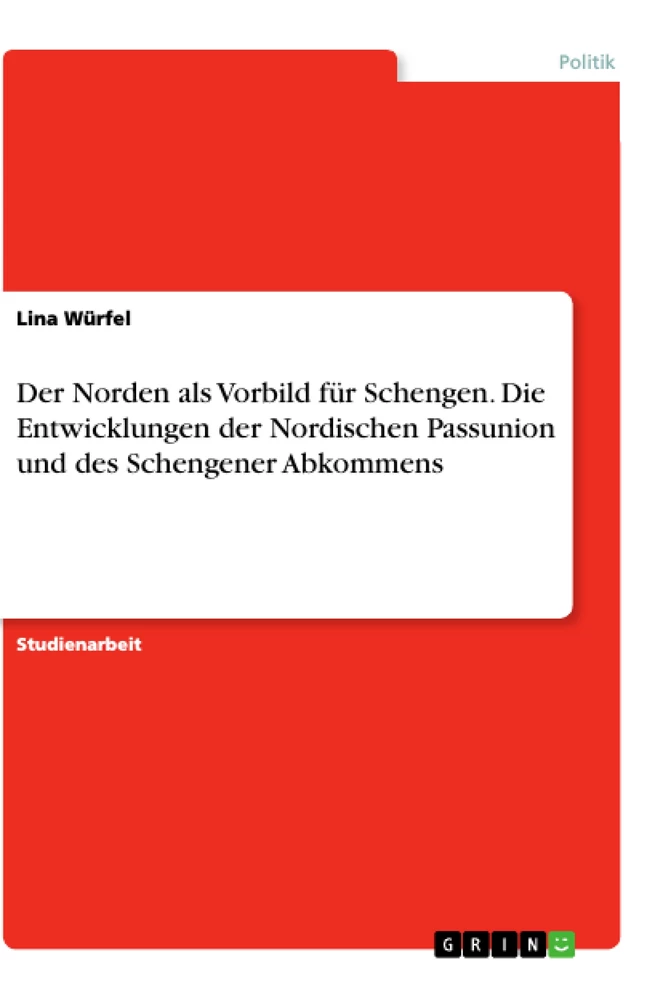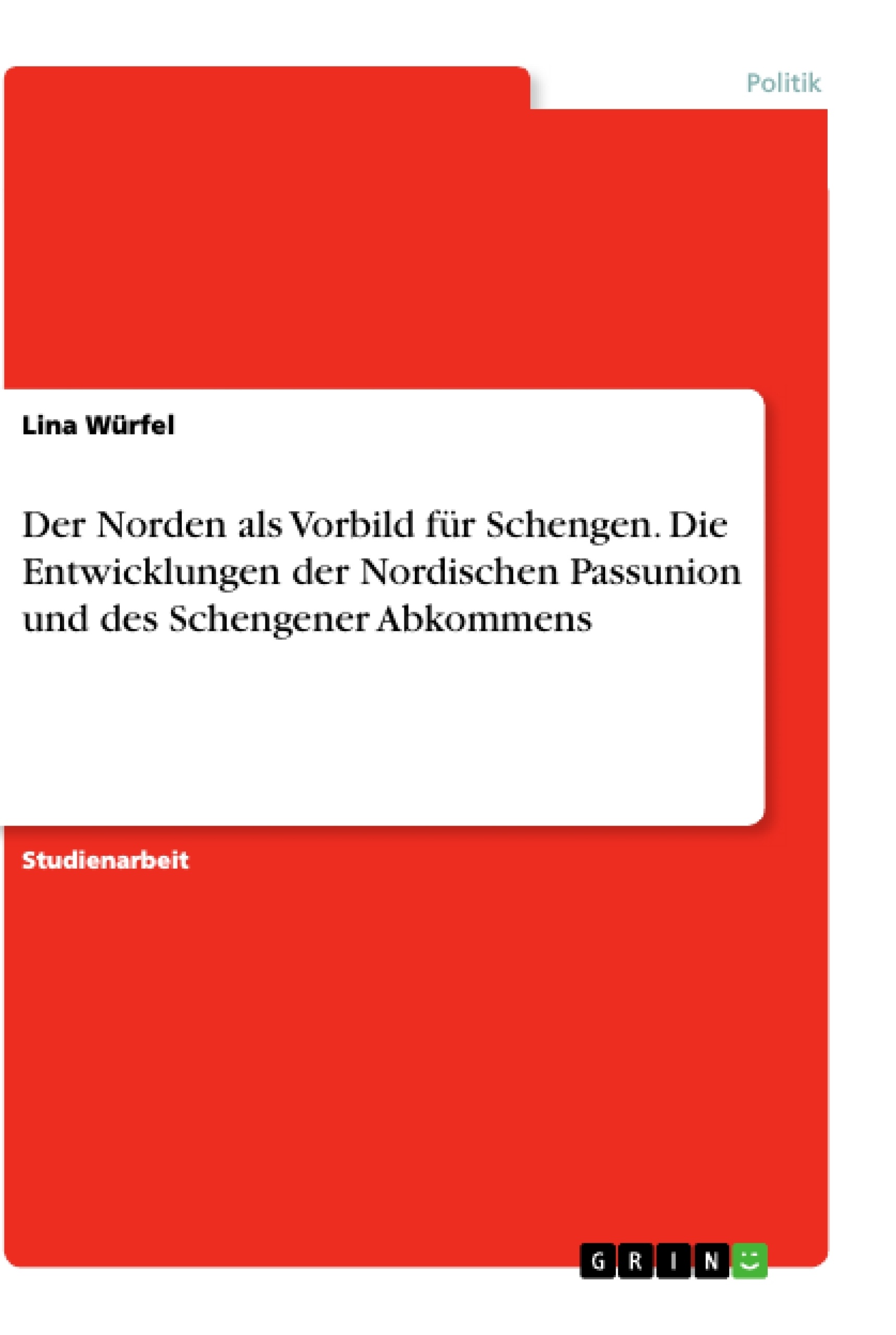Der Norden Europas gilt in vielen Bereichen als Vorbild: Finnische Schüler*innen belegen regelmäßig Spitzenplätze bei PISA-Tests (Kirstensen et al., 2016), ein schwedischer Automobilbauer beschließt schon in naher Zukunft auf die Neuentwicklung reiner fossiler Antriebe zu verzichten (Appel, Gropp, 2017) und die Profi-Fußballerinnen der norwegischen Nationalmannschaft erhalten seit 2018 genauso viel Lohn, wie ihre männlichen Kollegen (Garrelts, 2017).
Der ähnlich hohe Grad der Entwicklung der nordischen Länder in den verschiedensten Bereichen des Lebens kann u.a. auf die Tradition der Zusammenarbeit zurückgeführt werden. Denn die Länder liegen nicht nur geografisch nah beieinander, sondern auch in ihren gesellschaftlichen und sozialen Normen. Darauf aufbauend entstand im Zuge der Nordischen Integration der 1950er Jahre eine Zone der Reisefreiheit für Bürger*innen der Teilnehmerländer: die Nordische Passunion.
Circa 30 Jahre nachdem diese gegründet wurde, wurde etwas südlicher in Europa ein ähnliches Abkommen geschlossen: das Schengener Übereinkommen. Ähnlich der Passunion, wollten die Vertragsparteien es den Menschen ermöglichen, ohne Passkontrollen die Landesgrenzen zu überqueren. Bis zum heutigen Tage hat sich das 1985 geschlossene Überein-kommen durch Überarbeitungen und die Aufnahme in die EU als Schengen-Besitzstand enorm weiterentwickelt.
Das Ziel dieser Arbeit ist herauszufinden, ob sich die mitteleuropäischen Staaten ein Beispiel am Norden nahmen, als sie das Schengener Übereinkommen ausarbeiteten. Zunächst wird auf die Entwicklungsgeschichte der Nordischen Kooperation eingegangen, der die Nordische Passunion und viele weitere Institutionalisierungen entspringen. Danach wird anhand der historischen Entwicklung gezeigt, wie sich die passfreie Zone etablierte und über die Jahre bis zur Integration in das Schengen System entwickelte. Anschließend soll im dritten Teil der Arbeit auf die Entwicklung des Schengener Übereinkommens bis zur Aufnahme in die EU ein-gegangen werden. Im vierten Teil werden beide Abkommensstränge gegenübergestellt und mögliche Parallelen und Unterschiede beleuchtet, die dann im Fazit zur Beantwortung der Forschungsfrage beitragen. Ein Abkommensstrang stellt dabei die Gesamtheit aller Abkommen, Protokolle und weiterer Texte dar, die schlussendlich zur Nordischen Passunion bzw. dem Schengener Abkommen verschmelzen.
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Der Norden als Vorbild für Europa
1.2 Fragestellung
1.3 Vorgehensweise
2 Die Entwicklung der Nordischen Passunion von ihren Anfängen bis zur Integration in das Schengen mmnSystem
2.1 Begriffsbestimmungen
2.2 Die Nordische Passunion der 1950er Jahre
2.2.1 Nordische Kooperation
2.2.2 Der Weg zur Nordischen Passunion
2.2.3 Errichtung und Inhalt der Hauptdokumente der Nordischen Passunion
2.3 Reformen und weitere Entwicklung
2.3.1 Entwicklung bis zur Aufnahme in den Schengen acquis
2.3.2 Aufnahme in den Schengen acquis
3 Die Entwicklung des Schengener Abkommens von seinen Anfängen bis zur Integration in die EU
3.1 Das Schengener Übereinkommen vom 14. Juni 1985
3.1.1 Die EWG und das Saarbrückener Abkommen
3.1.2 Inhalt und Umfang des Übereinkommens
3.2 Reformen und weitere Entwicklung
3.2.1 Schengener Durchführungsübereinkommen 1990
3.2.2 Aufnahme in die EU
4 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Entwicklungen der Abkommensstränge
4.1 Unterschiede der Entwicklungen der Abkommen
4.2 Gemeinsamkeiten der Entwicklungen der Abkommen
5 Fazit und Ausblick
6 Quellenverzeichnis
6.1 Primärquellen
6.2 Sekundärquellen
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
1.1 Der Norden als Vorbild für Europa
Die Natur und Unberührtheit des europäischen Nordens erwecken in vielen Menschen die Sehnsucht nach der Ferne. Jedoch gilt nicht nur die Natürlichkeit der Länder als Beweggrund zur Reise, denn die Region ist auch in vielen anderen Bereichen ein erstrebenswertes Ziel. Beispiele dafür gibt es viele: Finnische Schüler*innen belegen regelmäßig Spitzenplätze bei PISA-Tests (Kirstensen et al., 2016, S. 191f), ein schwedischer Automobilbauer beschließt schon in naher Zukunft auf die Neuentwicklung reiner fossiler Antriebe zu verzichten (Appel, Gropp, 2017) und die Profi-Fußballerinnen der norwegischen Nationalmannschaft erhalten seit 2018 genauso viel Lohn, wie ihre männlichen Kollegen (Garrelts, 2017). Zudem erzeugt Norwegen 96% des Stroms in Wasserwerken (Deutsch-Norwegische Handelskammer, undatiert) und besteuert Alkohol, Tabak und Zucker exzeptionell hoch (o. A., 2017).
Der ähnlich hohe Grad der Entwicklung der nordischen Länder in den verschiedensten Bereichen des Lebens kann u.a. auf die Tradition der Zusammenarbeit zurückgeführt werden. Denn die Länder liegen nicht nur geografisch nah beieinander, sondern auch in ihren gesellschaftlichen und sozialen Normen. Schon in den 1870er Jahren begannen einzelne Gruppen von Wissenschaftler*innen und Gelehrten der nordischen Länder, sich bei regelmäßigen Treffen auszutauschen, um voneinander zu lernen (Kettunen et al., 2016, S. 70f). Auf Grundlage dieser Kooperationen entstanden Mitte des 20. Jahrhunderts Institutionen, wie der Nordic Council oder das Zollbündnis NORDEK. Es wurde aber auch eine Idee ins Leben gerufen, die es den Einwohner*innen des Nordens ermöglichen sollte, sich ohne Passkontrollen frei in den Gebieten der Mitgliedstaaten zu bewegen: die Nordische Passunion. Diese passfreie Zone beschränkte sich in ihrer Wirkung nicht nur auf die Reiseverkehrsfreiheit, sondern ermöglichte es den Menschen auch, sich über einen gewissen Zeitraum auf dem Gebiet der Vertragsparteien aufzuhalten, dort Berufe zu ergreifen und erleichterte es ihnen sogar, ihre Staatsbürgerschaft zu wechseln.
Circa 30 Jahre nachdem die Nordische Passunion gegründet wurde, wurde etwas südlicher in Europa ein ähnliches Abkommen geschlossen: das Schengener Übereinkommen. Ähnlich der Passunion, wollten die Vertragsparteien es den Menschen ermöglichen, ohne Passkontrollen die Landesgrenzen zu überqueren. Bis zum heutigen Tage hat sich das 1985 geschlossene Übereinkommen durch Überarbeitungen und die Aufnahme in die EU als Schengen-Besitzstand enorm weiterentwickelt.
1.2 Fragestellung
Das Ziel dieser Arbeit ist herauszufinden, ob sich die mitteleuropäischen Staaten ein Beispiel am Norden nahmen, als sie das Schengener Übereinkommen ausarbeiteten. Obwohl Nanz (1994, S. 93) behauptet, es hätte kein internationales Vorbild für das Schengener Durchführungsübereinkommen gegeben, soll geprüft werden, ob die Grundkonstrukte des Schengener Übereinkommens und seiner Nachfolgerabkommen vom Tun des Nordens Europas inspiriert wurden. Dementsprechend lautet die im Mittelpunkt stehende Forschungsfrage: Kann die Nordische Passunion als Vorbild für Schengen gesehen werden? Um das herauszufinden, werden die beiden Institutionalisierungen im Folgenden analysiert und in Kontext zueinander gesetzt.
1.3 Vorgehensweise
Zunächst wird auf die Entwicklungsgeschichte der Nordischen Kooperation eingegangen, der die Nordische Passunion und viele weitere Institutionalisierungen entspringen. Danach wird anhand der historischen Entwicklung gezeigt, wie sich die passfreie Zone etablierte und über die Jahre bis zur Integration in das Schengen System entwickelte. Anschließend soll im dritten Teil der Arbeit auf die Entwicklung des Schengener Übereinkommens bis zur Aufnahme in die EU eingegangen werden. Im vierten Teil werden beide Abkommensstränge gegenübergestellt und mögliche Parallelen und Unterschiede beleuchtet, die dann im Fazit zur Beantwortung der Forschungsfrage beitragen. Ein Abkommensstrang stellt dabei die Gesamtheit aller Abkommen, Protokolle und weiterer Texte dar, die schlussendlich zur Nordischen Passunion bzw. dem Schengener Abkommen verschmelzen.
Die Grundlage für den analytischen Vergleich der Abkommen stellen die vertraglichen Originaltexte und ihre Nachfolgerdokumente, um einen authentischen und präzisen Vergleich zu ermöglichen. Damit ein umfassendes Bild der Entstehungs- und Entwicklungsgeschichten der Nordischen Passunion und des Schengener Abkommens gezeichnet werden kann, wird ergänzend wissenschaftliche Literatur hinzugezogen.
2 Die Entwicklung der Nordischen Passunion von ihren Anfängen bis zur Integration in das Schengen System
2.1 Begriffsbestimmungen
Der Begriff der „nordischen Länder“ wird in der vorliegenden Arbeit synonym verwendet für die Teilnehmerstaaten der Nordischen Passunion. Bis 1965 sind das Finnland, Schweden, Dänemark und Norwegen und ab 1965 zudem Island. Die Färöer sowie Grönland sind nicht mit inbegriffen (Art. 14 NPÜ).
2.2 Die Nordische Passunion der 1950er Jahre
2.2.1 Nordische Kooperation
Die Nordische Passunion entspringt einer jahrzehntelangen Kooperation der nordischen Länder, die bis in die 1870er Jahre zurück führt. Sie ist das Ergebnis eines Annäherungsprozesses, der u.a. den Wissenstransfer von nordischen Akademiker*innen fördern und die Nachahmung von Lösungswegen ermöglichen sollte (Kettunen et al., 2016, S. 70f). Die Kollaboration der Staatsvertreter*innen war durch eine pragmatische und realistische Weltanschauung und einen Mangel an Formalität geprägt (Letto-Vanamo, Tamm, 2016, S. 104) - Eigenschaften, die auch ein Grund dafür sein können, dass die schwedische Regierung 1943 die Arbeitserlaubnispflicht für Angehörige der nordischen Staaten abschaffte, um die Einreise für politisch Verfolge zu erleichtern. Die rund 60.000 Flüchtlinge, die größtenteils aus Dänemark und Norwegen stammten, trugen dazu bei, das Arbeiter*innendefizit der schwedischen Industrie während der Kriegsjahre etwas auszugleichen (Tervonen, 2016, S. 133). Schwedens Wirtschaft profitierte sehr von den zusätzlichen Arbeitskräften und ließ zwei Jahre später die Visapflicht für Dän*innen, Norweger*innen und Isländer*innen und ab 1949 auch die für Finn*innen entfallen (ebd.). Mit der Wiederbelebung der Wirtschaft während der Nachkriegszeit ging, wie auch während des Wirtschaftswunders in der BRD, die Verbesserung der Arbeitnehmer*innenfreizügigkeit einher (Kettunen et al., 2016, S. 70). Zwischen 1949 und 1964 wurden Bürger*innen u.a. aus Italien, Griechenland, Portugal und der BRD von der Visapflicht ausgenommen (Tervonen, 2016, S. 133).
2.2.2 Der Weg zur Nordischen Passunion
Der mehrere Jahre anhaltende Prozess der Annäherung und Öffnung der nordischen Länder für einander mündete in den 1950er Jahren in der Entstehung der Nordischen Passunion, die Kettunen et al. (2016, S. 70) als „high point of Nordic social-political cooperation“ beschreiben. Der schwedische Vorstoß von 1943 kann als Startpunkt für viele Institutionalisierungen der 1950er und 60er Jahre interpretiert werden, nach dessen Vorbild weitere nordische Staaten Reise- und Arbeitsrestriktionen für Bewohner*innen des Nordens auf ihrem Staatsgebiet abschafften. Tervonen würdigt die Reise-Liberalisierungswelle von 1943 bis 1957 als ein einmaliges Ereignis:
,,A string of agreements and conventions between 1943 and 1957 abolished the requirements for a visa, work permit and a passport and guaranteed social security for those moving from one Nordic country to another ... Taken together, the agreements amounted to regional de-bordering and created a zone of free movement that remains unique to date in terms of the depth of freedom in mobility and social rights that it allows the citizens of Nordic countries.” (Tervonen, 2016, S. 132)
Aus diesem Zitat kann deutlich herausgelesen werden, dass die Nordische Passunion in ihrer Tiefe einmalig und in ihrer Bedeutung außerordentlich ist. Die ersten Verträge galten zunächst einseitig oder waren auf wenige Parteien beschränkt: Schweden erleichterte den Angehörigen der nordischen Staaten im eigenen Staatsgebiet Arbeit aufzunehmen, ohne, dass die schwedischen Staatsbürger*innen zusätzliche Rechte erhielten. Nach und nach ergaben sich jedoch Kooperationen oder die anderen nordischen Länder ergriffen ähnliche Maßnahmen wie Schweden. So beschlossen Dänemark und Schweden 1946 gemeinsam, die Arbeitserlaubnispflicht abzuschaffen und Finnland hob 1950 - fünf Jahre nach Schweden - die Visapflicht für Angehörige der nordischen Länder auf (Tervonen, 2016, S. 133). Als sich der Prozess fortsetzte, entschlossen sich die Verantwortlichen der Staaten, die nationalen Differenzen zu überwinden und die Zusammenarbeit durch die Errichtung von Institutionen zu fördern (Kettunen et. al, 2016, S. 78). Der 1952 gegründete Nordic Council, der aus Parlamentsmitgliedern der Teilnehmerländer besteht (The Nordic Council, undatiert), gilt als treibende Kraft hinter der fortschreitenden Institutionalisierung des Nordens und der Errichtung der Nordischen Passunion und dem gemeinsamen Arbeitsmarkt (Olesen, Strang, 2016, S. 29).
2.2.3 Errichtung und Inhalt der Hauptdokumente der Nordischen Passunion
Die Nordische Passunion fußt nicht nur auf einer Vielzahl von Verträgen, sondern besteht selbst aus mehreren Übereinkommen und Protokollen, die im Lauf der Zeit überarbeitet wurden. Die wichtigsten Schriftstücke sind das Protokoll über die Abschaffung der Pässe auf Reisen zwischen Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen (Nordische Passunion Protokoll: NPP) für deren Bürger*innen aus dem Jahre 1952 und das Übereinkommen zwischen Norwegen, Dänemark, Finnland und Schweden über die Aufhebung der Passkontrollen aller Reisenden an den innernordischen Grenzen (Nordische Passunion Übereinkommen: NPÜ), das 1957 unterzeichnet wurde und 1958 in Kraft trat.
In dem einseitigen Protokoll von 1952 beschlossen die Vertragsparteien, ihre Staatsbürger*innen von der Pflicht zu entbinden, bei Grenzübertritten und Reisen in das Gebiet eines Vertragsstaats innerhalb eines gewissen Zeitraumes einen Reisepass mitzuführen. Außerdem wurde beschlossen, unerlaubt ausgereiste Ausländer*innen innerhalb der Gebiete der Vertragsstaaten zurück zu nehmen. Die Möglichkeiten des Austritts aus dem Protokoll wegen Krieges oder ähnlich schwerwiegender Gründe wurden ebenfalls gegeben. In jedem Fall verpflichteten sich die Regierungen einander, über etwaige Änderungen zu unterrichten. Abschließend wurde die Möglichkeit für Island eröffnet, sich der passfreien Zone anzuschließen (NPP, 1952). Dieses Angebot nahm das Land allerdings erst im Jahre 1965 an, als es zur gemeinsamen Passunion, bzw. dem Übereinkommen von 1957, hinzustieß (ebd.).
In 15 Artikeln und drei Anhängen des NPÜ wird eine Freizügigkeitszone für alle Reisenden errichtet und u.a. Maßnahmen für die Kontrollen der Außengrenzen, die Nachverfolgung der nicht-nordischen Reisenden, die Einreisebewilligung oder -verweigerung geregelt. Der Zweck des NPÜ, nämlich das kontrollfreie Reisen, wird gleich im ersten Satz festgehalten: „The Contracting Parties ... being agreed to allow aliens to travel directly from one Nordic State to another via an authorised frontier control point without being submitted to passport control“ (Introduktion Abs. 2, NPÜ). Außerdem wird angestrebt, die Visaregelungen der Vertragsparteien zu harmonisieren, die bis zu diesem Zeitpunkt noch uneinheitlich geregelt sind (Introduktion Abs. 3, NPÜ). In Art. 1 NPÜ werden sodann sämtliche für das Übereinkommen bedeutende Begriffe, wie „Ausländer*in“, „nordischer Staat“ und „nordische Außengrenze“ definiert. Art. 2 NPÜ legt fest, wie die im Einleitungssatz angestrebten Ziele verwirklicht werden sollen. Dazu soll jede Vertragspartei an ihrer Außengrenze Kontrollen einführen, die nach dem Schema in Anhang 1 NPÜ ablaufen: An Land sollen die Grenzen nur an Kontrollpunkten überschritten werden, Reisende im Zug, Flugzeug oder Schiff sollen entweder im Vehikel oder am Ankunftshafen kontrolliert werden. Zudem sollen die Pässe auf Echtheit, Gültigkeit und Richtigkeit kontrolliert und überprüft werden, ob eine Einreiseerlaubnis vorliegen muss. Außerdem muss abgeglichen werden, ob der*die Einreisende zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben ist. Von der Kontrolle kann abgesehen werden, wenn es sich um Grenzbewohner*innen handelt, die Reisenden den Kontrolleur*innen bekannt sind oder die Kontrolle offensichtlich bedeutungslos erscheint. Zur Kontrolle der Länge des Aufenthalts, des Ortes der Einreise und persönlicher Informationen soll für jede*n nicht-nordische*n Einreisende*n eine Kontrollkarte erstellt werden (Art. 2 Abs. 2 NPÜ). Form und Inhalt der Karte sind in Anhang 2 NPÜ beschrieben, Beispielskizzen sind zusätzlich beigefügt (United Nations Treaty Series, Vol. 322, S. 264f).
Die Einreise kann verweigert werden, sobald der*die Einreisende ungültige Papiere bei sich hat, wenn keine Einreise- oder Arbeitserlaubnis vorliegt, keine ausreichenden ehrlichen Mittel für die Zeit des Aufenthalts und die Rückreise der Person zur Verfügung stehen oder beim Verdacht, eine bereits straffällig gewordene Person könne eine Straftat begehen, im Besonderen Sabotage, Spionage oder sonstige illegale Aktivitäten (Art. 6 NPÜ). Außerdem erhalten Menschen, die in der list of exelled aliens (Anhang 1, Abs. 2 NPÜ) zur Einreiseverweigerung ausgeschrieben sind, keine Einreiseerlaubnis (Art. 6 NPÜ). Demgegenüber werden in Art. 7 Ausnahmen von Art. 2 und 6 NPÜ genannt, wie z.B. Crew-Mitglieder auf Schiffen oder Flugzeugen.
Laut Art. 5 NPÜ können visumsfreie Ausländer*innen eine Aufenthaltsgenehmigung für einen nordischen Staat beantragen. Diese gilt jedoch nur für den ausstellenden Staat, wobei das 3-monatige Aufenthaltsrecht in anderen nordischen Staaten unberührt bleibt. Bei dortiger Arbeitsaufnahme oder einem längeren Aufenthalt muss die Person wiederum eine Genehmigung beantragen (Art. 5 Abs. 2 NPÜ). Die Kontrollen von nicht-nordischen Reisenden an den Binnengrenzen sind jedoch nicht gänzlich abgeschafft: Stichprobenkontrollen sind weiterhin erlaubt und Reisende ohne gültige Einreisegenehmigung dürfen abgewiesen werden (Art. 8 NPÜ). Dementsprechend verpflichten sich die Vertragsparteien dazu, illegal ausgereiste Personen aus anderen nordischen Staaten wieder zurück zu nehmen (Art. 10 NPÜ).
Damit alle Vertragsstaaten die gleichen Prozeduren durchführen und denselben Informationsstand haben, nennen Art. 4, 11 und Anhang 3 NPÜ Regelungen für die Informationsverteilung. U.a. zu diesem Zweck wird in Art. 13 NPÜ die Errichtung eines gemeinsamen Arbeitsausschusses, des Nordic Aliens Committee, beschlossen. Der Ausschuss besteht aus einer*einem Repräsentierenden je Mitgliedstaat und befasst sich mit Angelegenheiten von Bedeutung für die gemeinsame Passunion.
Abschließend beschließen die Vertragsparteien die Möglichkeit der Erweiterung der Passunion um Island, die Färöer Inseln und Grönland (Art. 14 NPÜ). Dieses Angebot nahm Island an und unterzeichnete am 24. September 1965 das Beitrittsabkommen zum Übereinkommen von 1958 (vgl. BI).
2.3 Reformen und weitere Entwicklung
2.3.1 Entwicklung bis zur Aufnahme in den Schengen acquis
In den Jahren 1973 und 1979 werden durch zwei Abkommen Änderungen an dem Übereinkommen von 1958 vorgenommen. Die Umgestaltungen, die das Übereinkommen von 1973 (Ü73) beinhaltet, sind vorrangig inhaltlicher Natur. Beispielsweise wird der Art. 5 Abs. 1 NPÜ dahingehend ergänzt, dass spezielle Berufsgruppen von der Aufenthaltsgenehmigungspflicht ausgenommen werden (Art. 1 lit (a) Ü73). Im Übereinkommen von 1979 (Ü79) werden weitaus tiefgreifendere Änderungen vorgenommen. U.a. wird der Text des Art. 3 NPÜ stark verkürzt, wohl zur Vereinfachung des Kontrollkartenverfahrens (Art. 2 Ü79). Eine weitere Vereinfachung wird für Art. 2 NPÜ vorgenommen, die bestimmt, dass es ab dem Inkrafttreten des Übereinkommens dem betreffenden nordischen Staat überlassen wird, in welchem Umfang er bei Ausreise aus dem Gebiet der Passunion die Pässe kontrolliert (Art. 1 Abs. 1 Ü79).
Zudem werden in Art. 7 Ü79 die drei Anhänge des NPÜ gelöscht, weshalb u.a. die Verlängerung des Textes des Art. 11 NPÜ notwendig ist, der sich vorher auf Anhang 3 berief (vgl. Art. 6 Ü79). Auch Art. 8 NPÜ wird immens verlängert, indem die Durchführung von gelegentlichen Passkontrollen an Binnengrenzen ausdrücklich, aber nur mit Begründung erlaubt wird (Art. 4 Ü79). Außerdem werden zeitliche Begrenzungen für die Beschlüsse über Kontrollen für Art. 8 NPÜ (ebd.) und für Fristen staatlichen Eingreifens in Art. 10 Abs. 3 NPÜ hinzugefügt.
2.3.2 Aufnahme in den Schengen acquis
Als der Schengenraum im südlicheren Teil Europas begann, sich in den 1990er Jahren auszuweiten und mit einem Protokoll des Amsterdamer Vertrages von 1997 als Schengen acquis in die EU aufgenommen wurde (vgl. Ü2000, S. 40), war die dritte Anpassung des Übereinkommens von 1957 unumgänglich. Schweden und Finnland waren neben Dänemark Mitgliedstaaten der EU geworden und hatten schon 1996 das Schengener Abkommen unterzeichnet (Tervonen, 2016, S. 134). Island und Norwegen ratifizierten dieses im Jahre 1999. Erst nach einer weiteren Überarbeitung des NPÜ konnten alle nordischen Staaten im März 2001 vollständige, bzw. assoziierte Mitglieder (Norwegen und Island) werden (Tervonen, 2016, S. 134).
Die Änderungen am NPÜ betreffen u.a. die Wortdefinitionen aus Art. 1 NPÜ, die im Zuge der Integration in den Schengenraum notwendig sind. Begriffe wie „Schengen-Staat“, „Nicht-Nordischer Schengen-Staat“, „Das Schengen Informationssystem“ und „Ausländer*in“ (Art. 1 Ü2000) müssen neu hinzugefügt und definiert werden. Alle weiteren Änderungen werden in Art. 2 Ü2000 aufgezählt. Die Bestimmung, dass die Passkontrollen an den Außengrenzen zu nicht-nordischen Schengen-Staaten aufgehoben werden müssen (Art. 2 lit. a Ü2000) und dass Ausländer*innen mit Aufenthaltsgenehmigung für einen Schengen-Staat sich bis zu drei Monate auf dem Gebiet der nordischen Staaten aufhalten dürfen (lit. e), wird darin u.a. genannt. Ebenso wird den Vertragsparteien erlaubt, auf den Gebrauch der Einreisekarten zu verzichten (lit. b). Dagegen dürfen sie nur Menschen abweisen, die im Schengener Informationssystem (SIS) vermerkt sind (lit. f und j). Eine Einreiseverweigerung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a NPÜ (nach Neufassung von 1979) ist unzulässig, sowie Binnengrenzkontrollen, die regelmäßig und ohne erkennbare Gefährdungslage durchgeführt werden (lit. i).Grundlegend und allumfassend gilt Art. 2 lit. l Ü2000: alle Vorschriften des NPÜ sollen im Lichte der Schengen Konvention interpretiert werden.
Obwohl die Nordische Passunion in das Schengensystem integriert wurde, wurde sie nicht gänzlich ersetzt: es gibt weiterhin „Extrarechte“ für Bürger*innen Skandinaviens, wie z.B. ein unbegrenztes Aufenthaltsrecht in einem Teilnehmerland oder die erleichterte Einbürgerung (Tervonen, 2016, S. 135). Um diese Entwicklung einordnen zu können und für Kapitel 4 vergleichbar zu machen, werden im Folgenden die Übereinkommen des Schengener Abkommens dargelegt und die Inhalte analysiert.
3 Die Entwicklung des Schengener Abkommens von seinen Anfängen bis zur Integration in die EU
3.1 Das Schengener Übereinkommen vom 14. Juni 1985
3.1.1 Die EWG und das Saarbrückener Abkommen
Der Grundstein für die Schaffung des freien Personenverkehrs in den Ländern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) wurde schon 1957 im EWG Vertrag (EWGV) gelegt. Um die Errichtung eines gemeinsamen Marktes zu ermöglichen, sollten zudem Zölle und mengenmäßige Beschränkungen aufgehoben (Kapitel 1, Abschnitt 1 EWGV) und der freie Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr zwischen den Mitgliedstaaten (MS) der EWG verwirklicht werden (Stobbe, 1989, S. 33). In den Jahren nach Vertragsabschluss wurde jedoch kaum Fortschritt in diesem Bereich erzielt, auch bedingt durch den Kalten Krieg und den Eisernen Vorhang, der durch Europa verlief. Besonders die 1980er Jahre waren eine fragile und euro-skeptischen Phase, in der der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl versuchte, mit der Abschaffung der Grenzkontrollen zum Nachbarland Frankreich „ein Zeichen für Europa [zu] setzen“ (Baumann, 2008, S. 19). Nach großen Bemühungen erreichten er und sein französischer Mitstreiter François Mitterrand im Sommer 1984 schließlich den Abschluss des bilateralen Saarbrückener Abkommens (SA) über den „schrittweisen Abbau der Kontrollen an der deutsch-französischen Grenze“ (SA, 1985). Bereits ein Jahr später wurde dieses durch das Schengener Übereinkommen ersetzt (Baumann, 2008, S. 20f).
3.1.2 Inhalt und Umfang des Übereinkommens
Das Schengener Übereinkommen (SÜ) von 1985 umfasst zwei bzw. drei thematische Teile: kurzfristige und langfristige Maßnahmen und Schlussbestimmungen. Zu Beginn wird festgelegt, für wen das Übereinkommen gilt: für Bürgerinnen und Bürger der vertragsschließenden Staaten und der anderen MS der Europäischen Gemeinschaften (Art. 1 SÜ). Die Begründer*innen des Schengener Übereinkommens verfolgten somit die Vorgabe des EWG Vertrages, einen freien Personenverkehr in den Vertragsstaaten zu etablieren.
Als erste Etappe sollen die kurzfristigen Maßnahmen bis zum 01.01.1986 (Art. 30 SÜ) umgesetzt werden, um die Kontrollen an den Binnengrenzen der Vertragsstaaten zu erleichtern (Hummer, 2010, S. 28). Dazu werden umfassende Regelungen zu verschiedenen Bereichen des Verkehrs und der gemeinsamen Kriminalitätsbekämpfung festgelegt: beispielsweise sollen Kontrollen des Personenverkehrs im Regelfall nur noch durch Sichtkontrollen stattfinden (Art. 2 SÜ), um einen gleichmäßigen Verkehrsfluss zu gewährleisten. Zur Erleichterung und weiteren Beschleunigung der Sichtkontrollen haben Autofahrer*innen die Möglichkeit durch grüne Scheiben, die an der Windschutzscheibe zu befestigen sind, anzuzeigen, dass sie die „grenzpolizeilichen Vorschriften einhalten, lediglich erlaubte Waren im Rahmen der Freigrenzen mit sich führen und die Devisenvorschriften einhalten“ (Art. 3 SÜ). In der Praxis werden aber trotzdem Pässe und evtl. mitgeführte Güter inspiziert, was die Wirkung der sogenannten „Europa-Plaketten“ verringert (Stobbe, 1989, S. 13f). Trotzdem habe das Kontrollverfahren die Überfahrtzeit deutlich vermindert (Stobbe, 1989, S. 14f), möglicherweise auch aufgrund der Liberalisierung der Grenzübertritte von Grenzraumbewohner*innen (Stobbe, 1989, S. 5), die „die Grenzen außerhalb der zugelassenen Grenzübergangsstellen und außerhalb der Öffnungszeiten ... überschreiten“ dürfen (Art. 6 S. 2 SÜ) - selbstverständlich nur unter Einhaltung der Freigrenzen und geltenden Vorschriften. Des Weiteren werden Regelungen getroffen, um Wartezeiten bei grenzüberschreitenden Eisenbahntransporten, Güterzügen und dem Binnenschiffverkehr zu verkürzen (Art. 14-16 SÜ). Artikel 8 und 9 SÜ listen Felder innerhalb der Bekämpfung von Kriminalität auf, in denen die Zusammenarbeit und Koordinierung der Vertragsparteien verbessert bzw. aufgenommen werden sollen. Dabei werden u.a. der illegale Handel mit Betäubungsmitteln (Art. 8f SÜ) und die unerlaubte Einreise von Personen (Art. 9 SÜ; vgl. Stobbe, 1989, S. 17) genannt.
Die kurzfristigen Regelungen bilden die Grundlage für die langfristig umzusetzenden Maßnahmen, die ab Art. 17 SÜ aufgezählt werden. Diese zielen auf den vollständigen Abbau der Grenzkontrollen bis zum 01.01.1990 ab (vgl. Stobbe, 1989, S. 19f; Hummer, 2010, S. 28; Art. 30 SÜ). Längerfristig soll u.a. die polizeiliche Zusammenarbeit geregelt werden, um die präventive Verbrechensbekämpfung zu fördern und die Fahndung zu erleichtern (Art. 18 lit. a SÜ). Außerdem sollen Harmonisierungen vor allem im Betäubungsmittelrecht, Waffen- und Sprengstoffverkehr, Hotelmelderecht (Art. 19 SÜ), aber auch im Ausländer*innenrecht für Angehörige von Staaten außerhalb der EG vorgenommen werden (Art. 20 S. 2 SÜ). Während sich die kurzfristigen Maßnahmen auf die Vergrößerung der Reisefreiheit der EG-Bürger*innen durch erste Annäherungsversuche zur Harmonisierung staatlicher Rechtsvorschriften konzentrieren, bauen die langfristigen Maßnahmen auf diese auf und verfeinern die Felder und Arten der Kooperation zwischen den Vertragsparteien. Da auch für die langfristigen Maßnahmen ein Enddatum für die Umsetzung gesetzt ist, ergibt sich für die Zeit danach die Notwendigkeit eines weiteren Übereinkommens, das neue Ziele aufstellt (Nanz, 1994, S. 93).
3.2 Reformen und weitere Entwicklung
3.2.1 Schengener Durchführungsübereinkommen 1990
Das Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ) wurde am 19.06.1990 durch die Vertragsparteien unterzeichnet. Inhaltlich ist das SDÜ, wie das SÜ, in zwei bzw. drei Teile aufgeteilt: Maßnahmen zur Abschaffung der Grenzkontrollen (Titel II SDÜ), Ausgleichsmaßnahmen (Titel III-VII SDÜ) und Begriffs- und Schlussbestimmungen (Titel I und VIII SDÜ). Da sich die Vertragsparteien in manchen Punkten nicht einigen konnten, wurden zusätzliche Übereinkommen geschlossen, um keine Lücken durch fehlende Ausgleichsmaßnahmen entstehen zu lassen (Nanz, 1994, S. 106). Beispielhaft kann das Dubliner Asylübereinkommen von 1990 genannt werden (ebd.). Im Folgenden werden die für den Vergleich dienlichen Titel besprochen.
Zuerst werden in Art. 1 SDÜ u.a. „Binnengrenzen“, „Außengrenzen“, „Drittstaat“ und „Drittausländer“ definiert. Die folgenden 37 Artikel des zweiten Titels befassen sich mit der Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen und dem Personenverkehr. In Art. 2 Abs. 1 SDÜ wird festgelegt, dass die „Binnengrenzen ... an jeder Stelle ohne Personenkontrollen überschritten werden“ dürfen. Die Außengrenzen dürfen nur an bestimmten Grenzübergangsstellen überquert werden (Art. 3 Abs. 1 SDÜ), die von den zuständigen Behörden in nationaler Zuständigkeit kontrolliert werden (Art. 6 Abs. 1 SDÜ). Dabei werden nicht nur die Papiere und der Grund der Reise abgefragt, sondern - insbesondere bei der Einreise von Drittausländer*innen - überprüft, ob der*die Reisende zur Fahndung ausgeschrieben ist oder eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt (Art. 6 Abs. 2 lit. a SDÜ). Drittstaatsausländer*innen, die die in Art. 5 SDÜ genannten Eigenschaften erfüllen, dürfen sich bis zu drei Monate im Gebiet der Vertragsparteien bewegen. Zum einen müssen die Reisenden die Voraussetzungen zur Einreise nach Art. 6 Abs. 2 lit. a SDÜ erfüllen, zum anderen müssen sie über ausreichende finanzielle Mittel für den Aufenthalt und die Rückreise verfügen (Art. 5 Abs. 1 lit. c SDÜ). Von der Erfüllung dieser Merkmale kann abgesehen werden, sofern humanitäre Gründe oder das nationale Interesse dies verlangen (Art. 5 Abs. 2 SDÜ). Sollte die Person dennoch nicht die Voraussetzungen erfüllen, die ihn*sie zur Einreise berechtigen, kann ihm*ihr diese verweigert werden (Art. 5 Abs. 2 S. 1 Hs. 1 SDÜ). Die Verweigerung ist auch gültig, wenn der*die Einreisende die nationale Sicherheit und Ordnung der Vertragsparteien bedroht (Art. 96 Abs. 2 SDÜ). Bei der Ausreise soll das Ausländer*innenrecht angewendet und überprüft werden, ob die Person zur Fahndung ausgeschrieben ist (Art. 6 Abs. 2 lit. d SDÜ). Art. 7 SDÜ verpflichtet die Vertragsparteien, einander zu unterstützen und eng zu kooperieren. Der in Art. 131 Abs. 1 SDÜ gegründete Exekutivausschuss soll gemäß Art. 8 SDÜ Entscheidungen bzgl. der Grenzkontrollen und -überwachung fällen.
Die Vereinheitlichung der Visapolitik[1] ist ein großes Ziel des SDÜ (Nanz, 1994, S. 98; Art. 9 Abs. 1 SDÜ). Der eingeführte Sichtvermerk für Drittausländer*innen berechtigt den*die Inhaber*in, sich bis zu drei Monate je sechs Monate im Hoheitsgebiet der Vertragsparteien aufzuhalten (Art. 10 Abs. 1 SDÜ). In Art. 9-17 SDÜ wird festgelegt, welcher der Vertragsstaaten für die Ausstellung des Sichtvermerks zuständig ist (Art. 12 Abs. 2 SDÜ), unter welchen Bedingungen ein Sichtvermerk (nicht) erteilt werden darf (Art. 13f SDÜ) und wo er unter gewissen Umständen gültig ist (vgl. Art. 16 SDÜ). Auch in diesem Bereich wirkt der Exekutivausschuss mit, indem er z.B. Regelungen festlegt (Art. 17 Abs. 1 SDÜ). Drittausländer*innen ohne Visumspflicht (Artikel 20 SDÜ) und Drittausländer*innen mit gültigem Aufenthaltstitel (Art. 21 SDÜ) haben die Möglichkeit, sich ebenso bis zu drei Monate ohne zusätzliche Genehmigungen im Gebiet der Vertragsstaaten aufzuhalten (Nanz, 1994, S. 100). Aufenthalte von über drei Monaten werden in Art. 18 SDÜ behandelt und berechtigen Drittausländer*innen, nationale Visa zu beantragen, mit denen sie sich weiterhin frei im Gebiet des ausstellenden Staates bewegen dürfen (Art. 18 SDÜ).
Im dritten Titel des SDÜ über die Polizei und Sicherheit werden sämtliche Ausgleichsmaßnahmen für diesen Bereich geregelt, u.a. die polizeiliche Zusammenarbeit (Art. 39-47 SDÜ), Rechtshilfe in Strafsachen (Art. 48-53 SDÜ), die Auslieferung (Art. 59-66 SDÜ) und Maßnahmen bezüglich Betäubungsmitteln, Feuerwaffen und Munition (Art. 70-91 SDÜ). Zudem wird die Kooperation der Rechtsorgane der Mitgliedstaaten behandelt (Huybreghts, 2015, S. 386). Im vierten Titel wird das Schengener Informationssystems errichtet. Vorrangig dient das SIS „dem Austausch von Informationen im Zusammenhang mit der Einreise, Visaerteilung und der polizeilichen Zusammenarbeit“ (Nanz, 1994, S. 104). Das Ziel ist der Schutz der öffentlichen Sicherheit durch nationale und technische Unterstützungseinheiten (ebd.).
Seit der Vertragsunterzeichnung des SDÜ wurden aus vielen Richtungen Änderungen, u.a. durch die Weiterentwicklung der Politik im Bereich der Justiz und des Inneren, den Vertrag von Lissabon und durch die Integration neuer Staaten in die EU, an dem Vertragstext vorgenommen (Huybreghts, 2015, S. 402f). Einige Regelungsbereiche wurden aus dem SDÜ ausgenommen und andere verblieben im Zuständigkeitsbereich des Schengen acquis, wie die Visapolitik, die Grenzpolitik und das SIS (Huybreghts, 2015, S. 403).
3.2.2 Aufnahme in die EU
Nachdem bis zum Ende der 1990er Jahre bereits 13 Staaten zum Schengener Abkommen hinzugetreten waren, wurde das System 1999 mit dem Vertrag von Amsterdam als „Schengen-Besitzstand“ in die EU aufgenommen (Hummer, 2010, S. 29). Die Haupt-Arbeitsbereiche für die Union waren die Grenzpolitik, der Datenschutz, das SIS, die Kooperation der Polizei und Justiz und die Visapolitik (Huybreghts, 2015, S. 381). Heute ist der entstandene Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union in den Art. 67-89 geregelt. Im Verlauf der Zeit wurden zudem immer mehr Institutionen und Organisationen um das Schengener Abkommen herum gegründet, um es zu entlasten und zu unterstützen (Hummer, 2010, S. 35).
Der Freizügigkeitsraum ohne Binnengrenzkontrollen stellt eine weltweit einmalige Institution dar. Bemerkenswert ist ebenso, dass dieser Raum nicht nur auf die Ermöglichung der Reisefreiheit abzielt, sondern zudem weitere Liberalisierungen in den verschiedensten Bereichen ermöglicht.
4 Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Entwicklungen der Abkommensstränge
In diesem Kapitel soll herausgearbeitet werden, inwiefern sich die zwei Abkommensstränge ähneln bzw. unterscheiden. Dabei sollen vorrangig das Übereinkommen zur Abschaffung von Passkontrollen von 1957 (NPÜ) und das Schengener Durchführungübereinkommen (SDÜ) von 1990 betrachtet werden. Das Protokoll von 1952 (NPP) und das Schengener Übereinkommen von 1985 (SÜ) werden nur teilweise erwähnt, da sie wegen ihres geringen Umfangs für den Vergleich von nur begrenztem Interesse sind.
Zur Rekapitulation werden in der nachfolgenden Tabelle die Hauptbestandteile des NPÜ und SDÜ kurz wiedergegeben:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1 Hauptbestandteile des NPÜ und SDÜ (eigener Entwurf)
Anhand des kurzen Überblicks können bereits einige Überlappungen festgestellt werden. Es wird aber auch ersichtlich, dass das Schengener Durchführungsübereinkommen Themenfelder umfasst, die im NPÜ nicht vorkommen.
4.1 Unterschiede der Entwicklungen der Abkommen
Der Text des NPÜ umfasst im Großteil lediglich die Abschaffung der Grenzkontrollen und Ausgleichsmaßnahmen, die sich auf den Informationsaustausch zwischen den Teilnehmerstaaten, die Errichtung eines zuständigen Komitees und die Einreisebestimmungen beschränken. Dahingegen umfasst das SDÜ zusätzlich die Kooperationsfelder Sicherheit, Transport und Datenschutz. Die Hauptursachen des verschieden großen Umfangs sind wohl die unterschiedlichen Zielstellungen und Arbeitsweisen der jeweiligen Vertragsparteien. Die nordischen Länder verfolgen mit der Errichtung der Passunion eine sozialpolitische Agenda und besitzen eine eher pragmatische Weltanschauung, die sich besonders in der Kürze der Abkommen von 1952 und 1957 wiederspiegelt. Folglich besteht das NPP aus knapp einer Seite Text und das NPÜ aus lediglich 15 Artikeln und drei Anhängen. Dagegen streben die Vertragspartner des SÜ und SDÜ ein weit größeres Ziel an, als lediglich die Schaffung einer Freizügigkeitszone. Sie bemühen sich um die Verwirklichung des Binnenmarktes, verfolgen also eine ökonomische Agenda, für die neben der Freizügigkeit für Personen auch die für Waren und Kapital erreicht werden muss. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit eines größeren thematischen Umfangs des SDÜ mit 142 Artikeln und mehreren Anhängen.
Auch bei den Kontrollen an den Binnengrenzen wird unterschiedlich verfahren. Während das NPÜ, besonders in der novellierten Fassung von 1979, erlaubt, gelegentliche Passkontrollen durchzuführen (Art. 4 Ü79), verbietet das SDÜ jegliche Art der Binnengrenzkontrollen (Art. 2 SDÜ).
4.2 Gemeinsamkeiten der Entwicklungen der Abkommen
Die Abkommensstränge weisen jedoch nicht nur Unterschiede auf, sondern auch einige Gemeinsamkeiten. Diese lassen sich vor allem im tatsächlichen Regelungsinhalt wiederfinden. Beide Abkommensstränge - beginnend mit dem NPP und dem SÜ - sind zunächst exklusiv für eine spezifische Bevölkerungsgruppe vorgesehen (Abs. 1 NPP; Art. 1 SÜ) und öffnen sich in ihren Erweiterungen als NPÜ und SDÜ allen Reisenden auf dem Gebiet der Vertragsstaaten (Introduktion Abs. 2 NPÜ; Art. 2 Abs. 1 SDÜ). Auch wird in beiden Übereinkommen festgelegt, dass sich die Vertragsparteien darüber einig sind, ihre jeweiligen Visaregelungen einander anzupassen, um für das jeweilige kontrollfreie Gebiet in Zukunft einheitliche Visa vergeben zu können (Introduktion Abs. 3 NPÜ; Art. 9 SDÜ). Nahezu komplett identisch sind die aufgelisteten Gründe zur Einreiseverweigerung in Art. 5 Abs. 1 SDÜ und Art. 6 NPÜ. Ebenso gelten für die Genehmigung des Aufenthalts in beiden Freizügigkeitszonen sehr ähnliche Grundsätze. Beide Übereinkommen unterscheiden visafreie und visapflichtige Drittausländer*innen, erteilen ihnen eine dreimonatige Aufenthaltsfrist mit Verlängerungsmöglichkeit und regeln das Procedere für deren Genehmigung und Gültigkeit (vgl. Art. 5 NPÜ; Art. 5 Abs. 2f und 9-19 SDÜ).
Die bisher aufgezählten Punkte deuten eine mögliche Vorbildfunktion der Nordischen Passunion für das SÜ und SDÜ an. Jedoch handelt es sich um Faktoren, die für die Errichtung multinationaler Freizügigkeitszonen vermutlich unerlässlich sind. In den Vertragstexten finden sich dennoch zwei weitere Punkte, die auf die Vorbildfunktion der Nordischen Passunion hindeuten können.
Zum Ersten werden in beiden Übereinkommen Komitees gegründet. Während sich das Nordic Aliens Committee mit Aufgaben, die für die gemeinsame Passzone von Wichtigkeit sind, beschäftigt (Art. 13 NPÜ), überprüft der Exekutivausschuss die richtige Anwendung des SDÜ (Art. 131-133 SDÜ). Zwar scheinen die Aufgabenfelder der Arbeitsgruppen unterschiedlich, im Grunde gilt aber auch hier: das NPÜ ist eher pragmatisch und das SDÜ sehr explizit und abschließend gefasst. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, dass das Nordic Aliens Committee als Vorbild für die Einrichtung des Exekutivausschusses galt.
Der zweite Punkt ist die Informationsverteilung, die trotz der unterschiedlichen Regelungsweisen in den Abkommen Parallelen aufweist. Die gegenseitige Informationspflicht bei Änderungen des Status quo des NPP wird bereits im Protokoll erwähnt (Abs. 4 NPP) und auch im NPÜ gilt diese Pflicht zur Unterstützung des Kontrollkartenverfahrens und der Aktualisierung der list of expelled aliens weiter (Art. 4, Anhang 3 NPÜ). Im SÜ wird die Koordination und der Informationsaustausch in Bezug auf den Kampf gegen Kriminalität (Art. 8f SÜ) vermerkt und im SDÜ (Art. 7 SDÜ) weiter vergrößert und um das SIS erweitert. Sowohl das Kontrollkartenverfahren als auch das Schengener Informationssystem zielen auf die Informationssammlung der Reisenden durch ihr Gebiet ab, um einen Überblick über die sich auf ihrem Gebiet befindlichen Personen zu erhalten und die Sicherheit zu erhöhen. Es ist somit denkbar, dass die Anstöße, die das NPP und NPÜ zur Informationsverteilung gegeben haben, als Grundlage für die Erstellung des SIS gedient haben.
5 Fazit und Ausblick
In der Gegenüberstellung konnten viele Beispiele aufgezeigt werden, die belegen können, dass Ähnlichkeiten zwischen den Abkommenssträngen vorliegen. Für die Teilbereiche der Visaregelung (Introduktion Abs. 3 NPÜ, Art. 9 SDÜ) und Einreiseverweigerung (Art. 5 Abs. 1 SDÜ, Art. 6 NPÜ) konnten nahezu deckungsgleiche Maßnahmen identifiziert werden. Auch gleicht sich der Prozess der Öffnung der Passfreiheit für alle Reisenden (Introduktion Abs. 2 NPÜ, Art. 2 Abs. 1 SDÜ), nachdem diese vorerst lediglich für eine spezifische Gruppe zugänglich war (Abs. 1 NPP; Art. 1 SÜ). Ebenso nehmen beide Übereinkommen eine Einteilung in visafreie und visapflichtige Drittausländer*innen vor und haben ähnliche Standards bei der Genehmigung und Anerkennung des Aufenthaltsrechts (vgl. Art. 5 NPÜ, Art. 5 Abs. 2f und 9-19 SDÜ). Beide Abkommen errichten zudem Komitees (Art. 13 NPÜ, Art. 131-133 SDÜ) und Richtlinien und Mittel zur Kommunikation (Abs. 4 NPP, Art. 4 und Anhang 3 NPÜ, Art. 8f SÜ, Art. 7 und Art. 92-119 SDÜ).
In der Gesamtschau ergibt sich eine große Zahl an Überlappungen des NPÜ und des SDÜ. Der Vergleich kann jedoch lediglich Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Vertragstexte aufzeigen. Ob die Ersteller*innen des Schengener Übereinkommens und Durchführungsübereinkommens von der Existenz und dem Inhalt der Nordischen Passunion wussten und sich daran ein Beispiel nahmen, kann durch die reine Textanalyse weder verifiziert noch falsifiziert werden. Um dies herauszufinden, bedarf es einer historisch-biografischen Analyse und evtl. Interviews der Mitwirkenden an den Schengener Abkommen. Geschichtlich gesehen scheint es jedoch undenkbar, dass sich keine*r der Begründer*innen des Schengener Übereinkommens jemals im Gebiet der Nordischen Passunion bewegt hat. Beim Reisen auf dem Gebiet hätte auffallen müssen, dass dort Grenzüberfahrten grundsätzlich ohne Kontrollen stattfinden. Das Wissen darüber kann sowohl als Inspiration für die Errichtung einer ‚eigenen‘ Freizügigkeitszone als auch für deren inhaltlichen Aufbau gegolten haben.
Nanz (1994, S. 93) Behauptung, es hätte kein internationales Vorbild für das Schengener Durchführungsübereinkommen gegeben, mag in Hinblick auf dem Umfang des SDÜ berechtigt sein. Jedoch muss ihm in seiner Grundaussage in Bezug auf die Existenz und den möglichen Vorbildcharakter der Nordischen Passunion widersprochen werden. Insofern kann die Forschungsfrage, ob die Nordische Passunion als Vorbild für das Schengener Abkommen gesehen werden kann, mit ‚ja‘ beantwortet werden.
Unabhängig von der ursprünglichen Motivation zur Errichtung der jeweiligen Freizügigkeitszone, haben beide Abkommensstränge schlussendlich zu einem Prozess des Zusammenwachsens, der Verbindung und des Vertrauens der europäischen Staaten beigetragen. Dass dieser Zustand und die dahinterstehenden Werte nicht unerschütterlich sind, hat u.a. die Krisensituation in Europa ab dem Sommer 2015 gezeigt. Deshalb möchte ich abschließend an alle Politiker*innen und Bürger*innen appellieren, nicht zu vergessen, dass lange und schwierige Wege beschritten werden mussten, um das Europa, wie wir es heute kennen, zu erreichen. Gleichzeitig soll jedoch auch ein Blick in die Zukunft gerichtet werden, die andernorts schon stattfindet. Die Inspiration dazu kann, wie eingangs erwähnt, in nahezu jedem Politikbereich gefunden werden. Sowohl in der Bildung als auch im Umweltschutz, bei Technologien und im Verbraucher*innenschutz haben die nordischen Länder, oder einige von ihnen, den südlicheren Nachbarländern einiges voraus. Vom Tun der anderen zu lernen sollte in einer globalisierten Gemeinschaft keine Ausnahme mehr darstellen, sondern den Ansatzpunkt für das eigene Streben.
6 Quellenverzeichnis
6.1 Primärquellen
(BI). Convention Between Denmark, Finland, Norway and Sweden Concerning the Waiver of Passport Control at the Intra-Nordic Frontiers. Signed at Copenhagen on 12 July 1957. Accession. United Nations. New York (Vol. 959), S. 840. Abgerufen am 02.04.2019 von https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20959/v959.pdf
(EWGV). Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Rom 25.03.1957, Dokument 11957E/TXT. Abgerufen am 21.03.2019 von
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957E/TXT&from=DE
(NPP). Protocol Concerning the Abolition of passports for Travel Between Sweden, Denmark, Finland and Norway. Signed at Stockholm, on 14 July 1952. United Nations, New York (Vol. 198), S.42. Abgerufen am 02.04.2019 von https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20198/v198.pdf
(NPÜ). Convention Between Denmark, Finland, Norway and Sweden Concerning the Waiver of Passport Control at the Intra-Nordic Frontiers. Signed at Copenhagen, on 12. July 1957. United Nations, New York (Vol. 322), S. 282-298. Abgerufen am 02.04.2019 von https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20322/v322.pdf
(SA). Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Französischen Republik über den schrittweisen Abbau der Kontrollen an der deutsch-französischen Grenze vom 13. Juli 1984. (1985). Archiv Des Völkerrechts (Vol. 23, No. 1/2), S. 220-224. Abgerufen am 07.05.2019 von http://www.jstor.org/stable/40798579
(SDÜ). Schengen-Besitzstand - Übereinkommen zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen. ABl. EU 2000 L 239, S. 19-62.
(SÜ). Schengen-Besitzstand - Übereinkommen zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen. ABl. EU 2000 L 239, S. 13-18.
(Ü73). Convention Between Denmark, Finland, Norway and Sweden Concerning the Waiver of Passport Control at the Intra-Nordic Frontiers. Agreement Supplementing the Above-Mentioned Convention Signed at Copenhagen on 2 April 1973. United Nations, New York (Vol. 901), S. 96-97. Abgerufen am 04.04.2019 von
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20901/v901.pdf
(Ü79). Convention Between Denmark, Finland, Norway and Sweden Concerning the Waiver of Passport Control at the Intra-Nordic Frontiers. Agreement Amending the Above-Mentioned Convention Signed at Copenhagen on 27 July 1979. United Nations, New York (Vol. 1159), S. 442-443. Abgerufen am 04.04.2019 von
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201159/v1159.pdf
(Ü2000). Agreement of 18 September 2000 Between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden Supplementing the Nordic Passport Convention of 12 July 1957, as Amended by the Agreement of 27 July 1979 and the Supplementary Agreement of 2 April 1973. United Nations, New York (Vol. 2155), S.40-43. Abgerufen am 04.04.2019 von https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202155/v2155.pdf
6.2 Sekundärquellen
Appel, H., Gropp, M. (17.05.2017). Volvo geht auf Distanz zum Diesel. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurt am Main. Abgerufen am 13.03.2019 von https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/volvo-geht-auf-distanz-zum-diesel-15018850.html
Baumann, M. (2008). Der Einfluss des Bundeskanzleramts und des Bundesministeriums des Innern auf die Entwicklung einer europäischen Grenzpolitik. In U. Hunger, C. M. Aybek, A. Ette, I. Michalowski, Migrations- und Integrationsprozesse in Europa. Vergemeinschaftung oder nationalstaatliche Lösungswege? S. 17-33. Wiesbaden.
Deutsch-Norwegische Handelskammer (undatiert). Erneuerbare Energien. Oslo. Abgerufen am 13.03.2019 von https://norwegen.ahk.de/kernbereiche/potenzialmaerkte/erneuerbare-energien/
Duden.de (undatiert). Sichtvermerk, der. Bibliographisches Institut GmbH. Berlin. Abgerufen am 15.04.2019 von www.duden.de/rechtschreibung/sichtvermerk
Garrelts, N. (10.10.2017). Norwegens Fußballfrauen verdienen bald so viel wie die Männer. Der Tagesspiegel. Berlin. Abgerufen am 27.03.2019 von https://www.tagesspiegel.de/sport/lohngleichheit-im-fussball-norwegens-fussballfrauen-verdienen-bald-so-viel-wie-die-maenner/20433914.html
Hummer, W. (2010). Die Europäische Union - das unbekannte Wesen. Die EU in 240 Bildern. Wien.
Huybreghts, G. (2015). The Schengen Convention and the Schengen Acquis: 25 years of evolution. ERA Forum (Vol. 16 No. 3), S. 379-426.
Kettunen, P., Lundberg, U., Österberg, M., Petersen, K. (2016). The Nordic Model and the Rise and Fall of Nordic Cooperation. In J. Strang, Nordic Cooperation. A European Region in Transition. S. 69-91.
Kirstensen, P. H., Lilja, K., Moen, E., Morgan, G. (2016). Nordic Countries as Laboratories for Transnational Learning. In J. Strang, Nordic Cooperation. A Europaen Region in Transition. S. 183-204.
Letto-Vanamo, P., Tamm, D. (2016). Cooperation in the Field of Law. In J. Strang, Nordic Cooperation. A European Region in Transition. S. 93-107.
Nanz, K.-P. (1994). Das Schengener Übereinkommen: Personenfreizügigkeit in integrationspolitischer Perspektive. Integration (Vol. 17 No. 2), S. 92-108.
o. A. (26.12.2017). Nå trer disse lovene og avgiftene i kraft. VG. Oslo. Abgerufen am 27.03.2019 von https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Eop3yP/naa-trer-disse-lovene-og-avgiftene-i-kraft
Olesen, T. B., Strang, J. (2016). European challenge to Nordic institutional cooperation. Past, present and future. In J. Strang, Nordic Cooperation. A European Region in Transition. S. 27-47.
Stobbe, E. (1989). Das Schengener Übereinkommen. Inhalt, Wirsamkeit, Bedeutung. In G. Ress, M. R. Will, Vorträge, Reden und Berichte aus dem Europa-Institut. Vol. 156. S. 2-4.
Tervonen, M. (2016). The Nordic Passport Union and its Discontents. In J. Strang, Nordic Cooperation. A European Region in Transition. S. 131-145.
The Nordic Council (undatiert). Nordic Co-operation. Kopenhagen. Abgerufen am 30.03.2019 von https://www.norden.org/en/information/nordic-council
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, Ziele und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält.
Was beinhaltet das Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis umfasst: Abkürzungsverzeichnis, Einleitung (mit Unterpunkten: Der Norden als Vorbild für Europa, Fragestellung, Vorgehensweise), die Entwicklung der Nordischen Passunion von ihren Anfängen bis zur Integration in das Schengen-System, die Entwicklung des Schengener Abkommens von seinen Anfängen bis zur Integration in die EU, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Entwicklungen der Abkommensstränge, Fazit und Ausblick, sowie ein Quellenverzeichnis (Primär- und Sekundärquellen).
Welche Themen werden in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung behandelt das Thema, inwiefern der Norden als Vorbild für Europa dienen kann, die Fragestellung der Arbeit (Kann die Nordische Passunion als Vorbild für Schengen gesehen werden?) und die Vorgehensweise der Analyse.
Was wird unter der Entwicklung der Nordischen Passunion behandelt?
Dieser Abschnitt behandelt Begriffsbestimmungen, die Nordische Passunion der 1950er Jahre (Nordische Kooperation, Der Weg zur Nordischen Passunion, Errichtung und Inhalt der Hauptdokumente), Reformen und weitere Entwicklung (bis zur Aufnahme in den Schengen Acquis, Aufnahme in den Schengen Acquis).
Was wird unter der Entwicklung des Schengener Abkommens behandelt?
Dieser Abschnitt behandelt das Schengener Übereinkommen vom 14. Juni 1985 (Die EWG und das Saarbrückener Abkommen, Inhalt und Umfang des Übereinkommens), Reformen und weitere Entwicklung (Schengener Durchführungsübereinkommen 1990, Aufnahme in die EU).
Welchen Vergleich ziehen die Abkommensstränge?
Der Vergleich der Abkommensstränge untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Entwicklungen der Abkommen, um die Frage zu beantworten, ob die Nordische Passunion als Vorbild für das Schengener Abkommen gesehen werden kann.
Welche Quellen werden verwendet?
Es werden Primärquellen (Verträge, Abkommen, Protokolle) und Sekundärquellen (wissenschaftliche Literatur) verwendet, um die Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte der Nordischen Passunion und des Schengener Abkommens zu analysieren.
Was sind die Hauptdokumente der Nordischen Passunion?
Die Hauptdokumente sind das Protokoll über die Abschaffung der Pässe auf Reisen zwischen Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen (1952) und das Übereinkommen zwischen Norwegen, Dänemark, Finnland und Schweden über die Aufhebung der Passkontrollen aller Reisenden an den innernordischen Grenzen (1957).
Was ist das Schengener Durchführungsübereinkommen?
Das Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ) wurde am 19.06.1990 unterzeichnet und regelt die Abschaffung der Grenzkontrollen, Ausgleichsmaßnahmen, Begriffs- und Schlussbestimmungen im Schengen-Raum.
Was ist das Schengener Informationssystem (SIS)?
Das Schengener Informationssystem (SIS) dient dem Austausch von Informationen im Zusammenhang mit der Einreise, Visaerteilung und der polizeilichen Zusammenarbeit.
Wie wurde das Schengener Abkommen in die EU aufgenommen?
Das Schengener Abkommen wurde 1999 mit dem Vertrag von Amsterdam als "Schengen-Besitzstand" in die EU aufgenommen.
- Quote paper
- Lina Würfel (Author), 2019, Der Norden als Vorbild für Schengen. Die Entwicklungen der Nordischen Passunion und des Schengener Abkommens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/493870