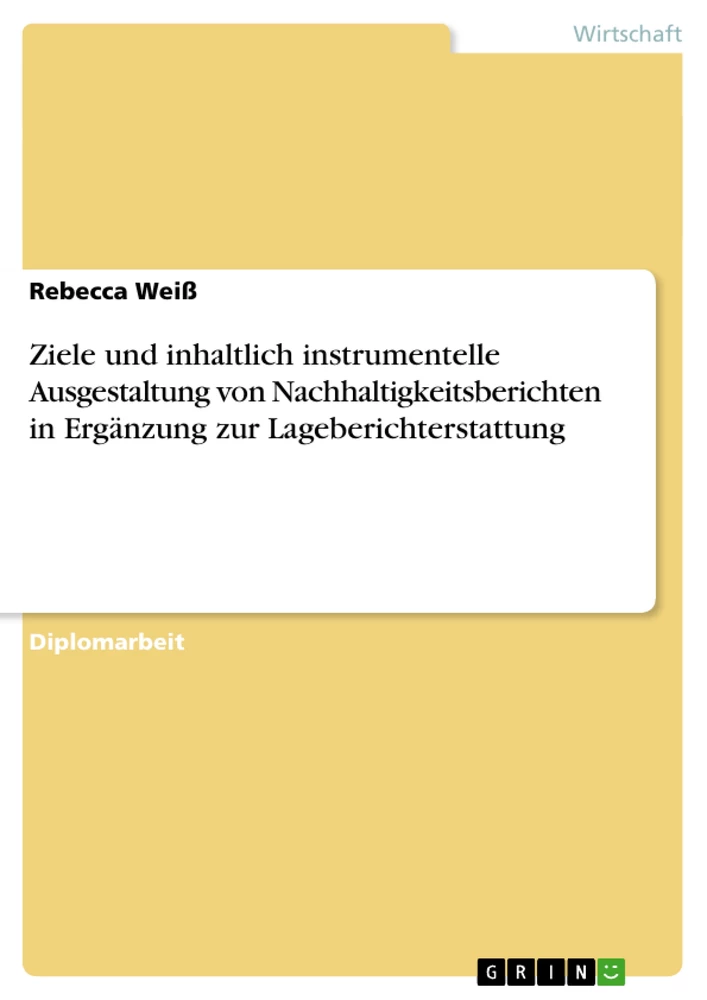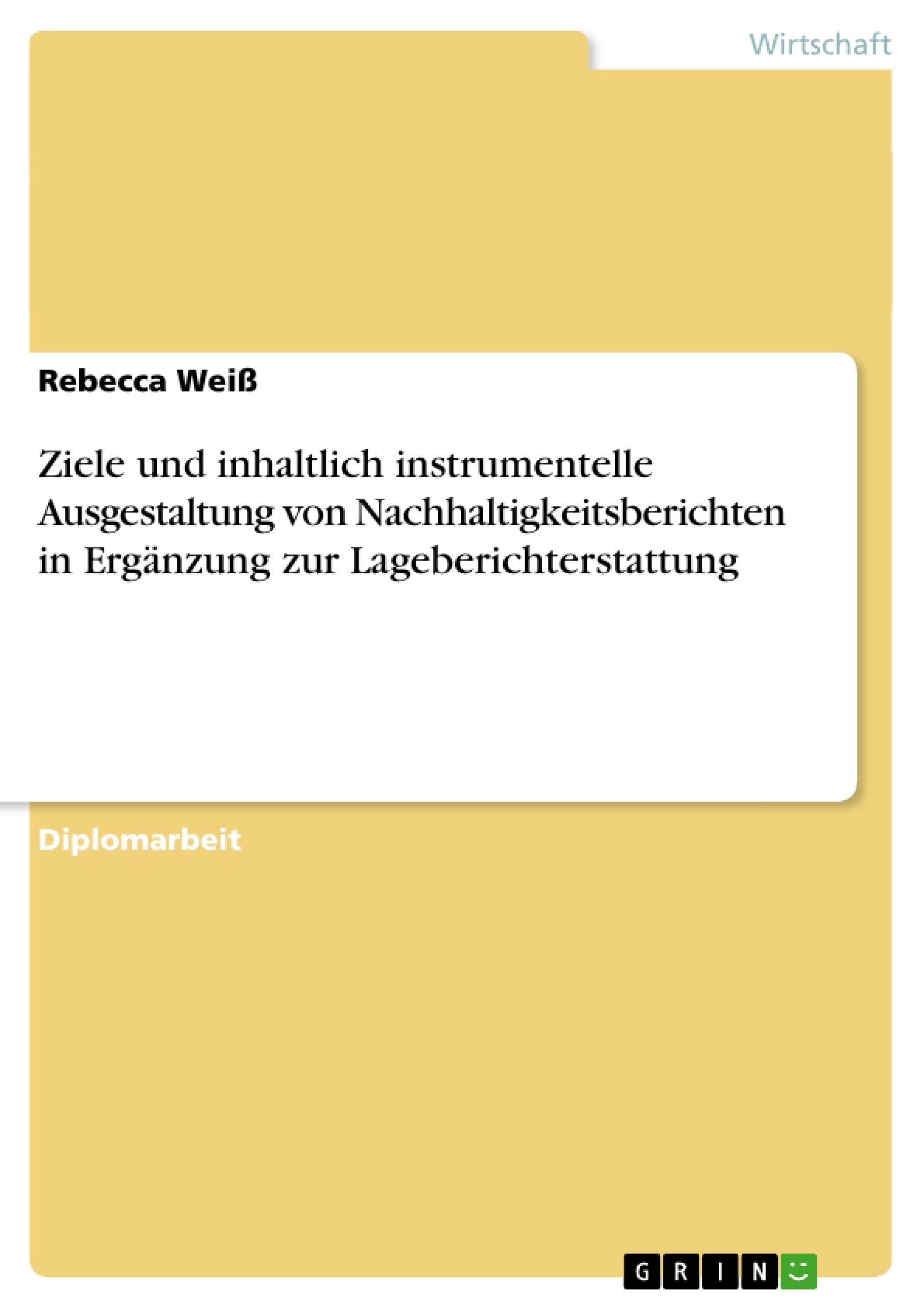In den letzten Jahren erfolgte eine rasante Veränderung der Umwelt deutscher Unternehmen. Durch Internationalisierung und Globalisierung verschärfte sich der Wettbewerb von Unternehmen auf dem Kapitalmarkt um Eigen- und Fremdkapitalgeber immens. Mangelnde Unternehmensberichterstattung, die sich nahezu ausschließlich auf Finanzgrößen und eine vergangenheitsorientierte Betrachtung bezog, führte häufig zu Informationslücken seitens der Kapitalgeber. Fehleinschätzungen des Unternehmenswertes und daraus resultierende Fehlinvestments waren die Folge dieses Berichterstattungssystems.
Aus diesem Grund erfolgte am 6. März 1998 eine Erweiterung des Kontrollsystems des deutschen Aktien- und Handelsrechts durch das KonTraG, so dass sich daraufhin der Anspruch auf Risikoberichterstattung im Lagebericht neu definierte.3Um den gewachsenen Informationsbedürfnissen der Anspruchsgruppen eines Unternehmens noch besser zu entsprechen, erweiterte der Gesetzgeber die Lageberichterstattung am Ende des Jahres 2004 durch das Bil-ReG. Nunmehr muss auch über zukünftige Chancen sowie über nichtfinanzielle Leistungsindikatoren wie für die Lage bedeutende Umwelt- und Arbeitnehmerbelange im Lagebericht informiert werden. Vor dem Hintergrund dieser Veränderungen muss gefragt werden: Reicht die derzeitige Lageberichterstattung aus, um die langfristige Stabilität des Unternehmens glaubhaft zu kommunizieren? Denn an dieser sind die Stakeholder eines Unternehmens letztlich interessiert, wenn davon ausgegangen wird, dass die langfristige Sicherung der Unternehmensexistenz Grundlage für die langfristige Sicherung der Ansprüche der Stakeholder ist. Eine internationale Entwicklung, die diesen Ansprüchen gerecht zu werden versucht, erfolgt in der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Sie wird auf freiwilliger Basis vorgenommen und soll objektiv die ökonomischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen des unternehmerischen Handelns vermitteln. Mit Nachhaltigkeitsberichten werden jedoch nicht nur die Akteure des erwähnten Kapitalmarkts angesprochen, obwohl die „financial community“ laut einer Untersuchung von Klaffke und Krick eine wichtige Zielgruppe der Nachhaltigkeitsberichterstattung darstellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2 Ableitung von Zielen der Nachhaltigkeitsberichterstattung aus den Informationsansprüchen der Anspruchsgruppen an die Berichterstattung des Unternehmens
- 2.1 Korrelation zwischen Unternehmenswert und Nachhaltigkeit
- 2.1.1 Identifizierung von Werttreibern des Unternehmenswertes
- 2.1.2 Auswirkungen nachhaltiger Unternehmenspolitik auf den Unternehmenswert
- 2.1.3 Zusammenfassung und Teilergebnis
- 2.2 Informationsansprüche der Stakeholder eines Unternehmens und diesbezügliche Beurteilung der Lageberichterstattung
- 2.2.1 Informationsbedürfnisse der Stakeholder eines Unternehmens
- 2.2.2 Aussagekraft des Lageberichts nach § 289 HGB bezüglich der identifizierten Informationsansprüche
- 2.2.2.1 Zweck und Inhalte der Lageberichterstattung
- 2.2.2.2 Kritische Beurteilung der Aussagekraft des Lageberichts
- 2.3 Ziele von Nachhaltigkeitsberichten
- 2.3.1 Das Hauptziel der Nachhaltigkeitsberichterstattung: Umfassendere Information der Stakeholder eines Unternehmens über die Wahrung ihrer Interessen und die langfristige Stabilität des Unternehmens
- 2.3.2 Zielbegründung für Stakeholder
- 2.3.3 Zielbegründung insbesondere für Shareholder und potentielle Investoren
- 2.4 Zwischenfazit
- 3 Inhaltlich instrumentelle Ausgestaltung von Nachhaltigkeitsberichten in Ergänzung zum Lagebericht
- 3.1 Nachhaltigkeitsberichte als ein Signalinstrument zur Kommunikation der langfristigen Stabilität des Unternehmens
- 3.1.1 Asymmetrische Informationen in Form von Qualitätsunsicherheiten
- 3.1.2 Signaling in Form von Nachhaltigkeitsberichten
- 3.2 Prinzipien der Nachhaltigkeitsberichterstattung
- 3.2.1 Gesamtsystem der Prinzipien
- 3.2.2 Zentrale Prinzipien zur Erhöhnung der Glaubwürdigkeit und Qualität von Nachhaltigkeitsberichten
- 3.2.2.1 Einbeziehung von Stakeholdern
- 3.2.2.2 Vollständigkeit, Neutralität und Relevanz
- 3.2.2.3 Genauigkeit, Überprüfbarkeit und Vergleichbarkeit
- 3.3 Informationsinhalte von Nachhaltigkeitsberichten
- 3.3.1 Gesamtsystem der Inhalte von Nachhaltigkeitsberichten
- 3.3.2 Zentrale Inhalte eines Nachhaltigkeitsberichts und deren Ausgestaltung
- 3.3.2.1 Vision und Strategie
- 3.3.2.2 Profil des Unternehmens
- 3.3.2.3 Kontrollstrukturen und Managementsysteme
- 3.3.2.4 Leistungsindikatoren und GRI-Content-Index
- 3.4 Ausbau betriebswirtschaftlicher Instrumente unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zur Absicherung der Inhalte von Nachhaltigkeitsberichten
- 3.4.1 Szenarioanalyse als Instrument zur Strategiefindung
- 3.4.2 Ökoeffizienz-Analyse
- 3.4.3 Strategieumsetzung mit der Balanced Scorecard
- 3.4.4 Kennzahlen zur Operationalisierung unternehmerischer Ziele
- 3.5 Zwischenfazit
- Analyse der Korrelation zwischen Unternehmenswert und Nachhaltigkeit
- Identifizierung der Informationsbedürfnisse der Stakeholder
- Bewertung der Aussagekraft der Lageberichterstattung im Hinblick auf die Informationsansprüche der Stakeholder
- Ableitung der Ziele von Nachhaltigkeitsberichten zur umfassenderen Information der Stakeholder
- Inhaltliche Ausgestaltung von Nachhaltigkeitsberichten als Signalinstrument zur Kommunikation der langfristigen Stabilität des Unternehmens
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, wie Nachhaltigkeitsberichte als Ergänzung zur traditionellen Lageberichterstattung dienen können, um den Informationsbedürfnissen der Stakeholder eines Unternehmens gerecht zu werden. Im Zentrum steht die Analyse der Korrelation zwischen Unternehmenswert und Nachhaltigkeit sowie die Identifizierung von Werttreibern, die durch nachhaltige Unternehmenspolitik beeinflusst werden.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit stellt die Problemstellung und die Zielsetzung der Diplomarbeit vor. Es erläutert den Aufbau der Arbeit und gibt einen Überblick über die einzelnen Kapitel.
Kapitel 2 widmet sich der Ableitung der Ziele der Nachhaltigkeitsberichterstattung aus den Informationsansprüchen der Stakeholder an die Berichterstattung des Unternehmens. Es analysiert die Korrelation zwischen Unternehmenswert und Nachhaltigkeit und untersucht die Auswirkungen nachhaltiger Unternehmenspolitik auf die Werttreiber des Unternehmenswertes. Zudem werden die Informationsbedürfnisse der Stakeholder eines Unternehmens sowie die Aussagekraft des Lageberichts nach § 289 HGB bezüglich der identifizierten Informationsansprüche beleuchtet.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit der inhaltlich instrumentellen Ausgestaltung von Nachhaltigkeitsberichten in Ergänzung zum Lagebericht. Es betrachtet Nachhaltigkeitsberichte als Signalinstrument zur Kommunikation der langfristigen Stabilität des Unternehmens und diskutiert die Prinzipien und Inhalte der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Darüber hinaus werden betriebswirtschaftliche Instrumente unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten beleuchtet, die zur Absicherung der Inhalte von Nachhaltigkeitsberichten beitragen können.
Schlüsselwörter
Nachhaltigkeitsberichterstattung, Unternehmenswert, Stakeholder, Lagebericht, Signalling, Prinzipien, Inhalte, betriebswirtschaftliche Instrumente, Szenarioanalyse, Ökoeffizienz-Analyse, Balanced Scorecard, Kennzahlen, GRI-Content-Index.
- Quote paper
- Rebecca Weiß (Author), 2005, Ziele und inhaltlich instrumentelle Ausgestaltung von Nachhaltigkeitsberichten in Ergänzung zur Lageberichterstattung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49384