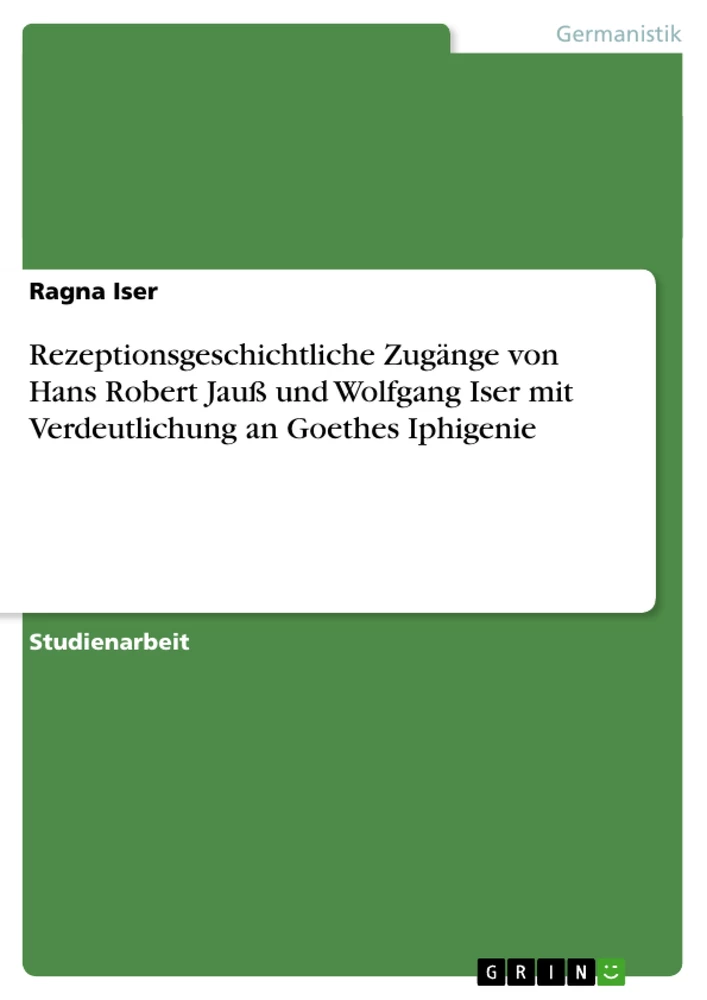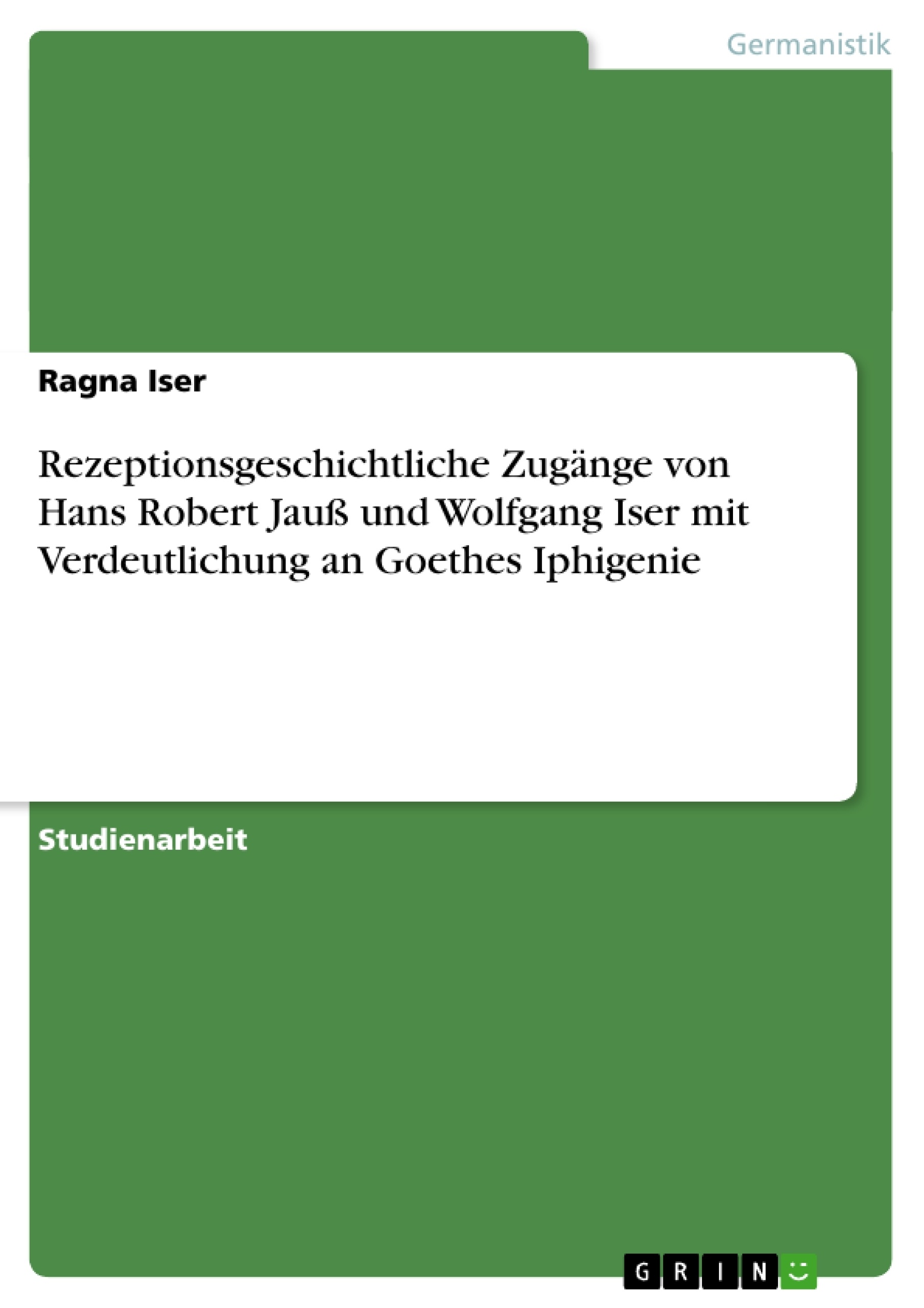In der Literaturwissenschaft stand jahrzehntelang die Tatsache im Mittelpunkt, dass Texte geschrieben werden, das heißt, es ging vor allem um die Produktions- und Darstellungsästhetik der Literatur. Die Rolle des Lesers wurde in die Untersuchungen nicht mit einbezogen. Dies änderte sich mit den Rezeptionstheorien von Hans Robert Jauß und dem Modell der Wirkungsästhetik von Wolfgang Iser, die sich mit dem vernachlässigten Bereich des dritten Standes, sprich dem Leser, auseinandersetzen. Beide Wissenschaftler haben in ihren abstrakten Theorien die Rolle des Publikums, das Leseverhalten und den Leseakt untersucht.
Die Hausarbeit beschäftigt sich zunächst mit den Theorien der Rezeptionsästhetik bzw. -geschichte und Wirkungsästhetik und erläutert diese. Doch auch Kritik an den Modellen und die Weiterentwicklungen der literarischen Zugänge im Wandel der Zeit werden behandelt. Anhand einer Interpretation von Hans Robert Jauß zu Goethes „Iphigenie“ werden die Theorien verdeutlicht.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Thema sehr komplex ist und nicht ganz einfach zu verstehen. Demzufolge besitzt auch die Literatur einen hohen wissenschaftlichen Anspruch. Selbst Lexikonartikel, die eigentlich helfen, einen groben Überblick über ein Thema zu erhalten oder dies vereinfachen, bringen keinen großen Fortschritt im Themaverständnis. Es muss sich somit sehr intensiv mit der Literatur auseinander gesetzt werden. Hilfreich ist es auch, sich den komplexen Theorien über ihre Anwendungen, sprich Interpretationen, anzunähern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rezeptionsgeschichtlicher Zugang zur Literatur
- Erläuterung der Begriffe Rezeptionsästhetik bzw. – geschichte und Wirkungsästhetik
- Wandel der Zeit und Kritik an der Theorie von Iser
- Auseinandersetzung mit einer Interpretation von Goethes „Iphigenie“
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Rezeptionsgeschichte und Wirkungsästhetik, indem sie die Theorien von Hans Robert Jauß und Wolfgang Iser erläutert und kritisch betrachtet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Analyse des Lesers als aktivem Faktor im Literaturprozess und der Bedeutung des historischen Kontextes. Die Arbeit verdeutlicht die Konzepte anhand einer Interpretation von Goethes „Iphigenie“ und beleuchtet die Komplexität der Rezeptionstheorien.
- Die Rolle des Lesers in der Literatur
- Rezeptionsästhetik und Wirkungsästhetik im Wandel der Zeit
- Der Einfluss des historischen Kontextes auf die Literatur
- Interpretation von Goethes „Iphigenie“ im Kontext der Rezeptionstheorien
- Komplexität und wissenschaftlicher Anspruch der Literaturtheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Rezeptionstheorie als Gegenreaktion auf die dominierenden Produktionsästhetiken vor und hebt die Bedeutung des Lesers für den Verstehensprozess von Texten hervor. Im zweiten Kapitel wird die Rezeptionsästhetik nach Jauß erläutert. Dabei wird die Rezeptionsgeschichte als „sukzessive Entfaltung eines im Werk angelegten Sinnpotentials“ definiert und die Rolle des Lesers als aktiver Faktor im Kommunikationsprozess hervorgehoben. Der Erwartungshorizont, welcher sich aus bekannten Normen, Werken und dem Gegensatz von Fiktion und Wirklichkeit zusammensetzt, wird als Grundlage für die Leserreaktion und den Verstehensprozess von Texten dargestellt.
Schlüsselwörter
Rezeptionsgeschichte, Wirkungsästhetik, Hans Robert Jauß, Wolfgang Iser, Erwartungshorizont, Literaturgeschichte, Kommunikationsprozess, Leseaktivitäten, Textverständnis, Interpretation, Goethes „Iphigenie“
- Citar trabajo
- Ragna Iser (Autor), 2005, Rezeptionsgeschichtliche Zugänge von Hans Robert Jauß und Wolfgang Iser mit Verdeutlichung an Goethes Iphigenie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49368