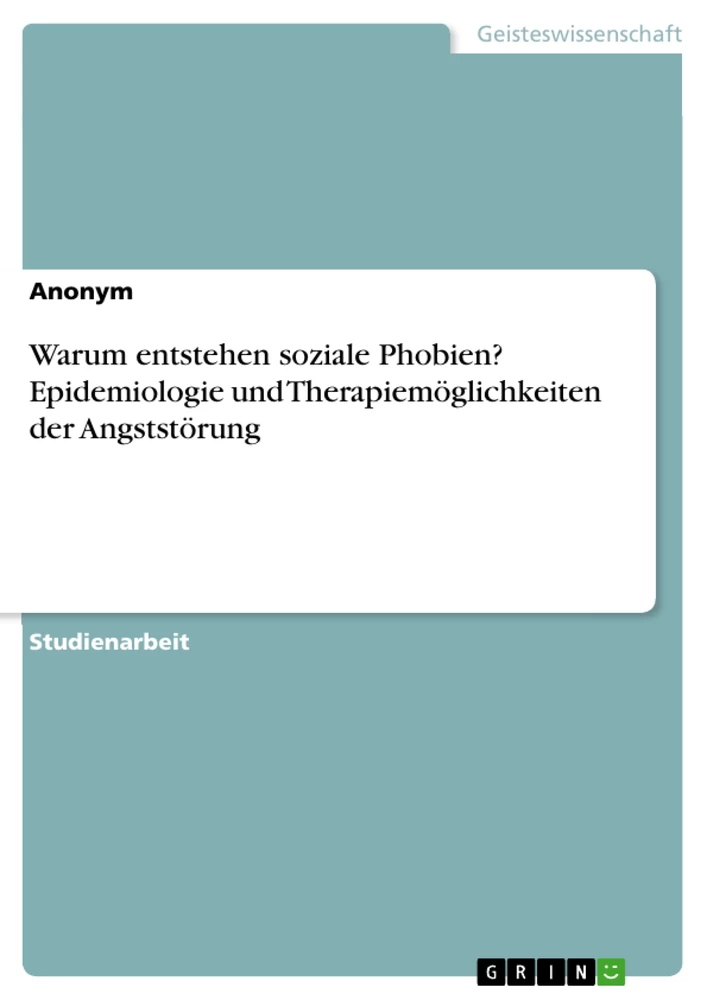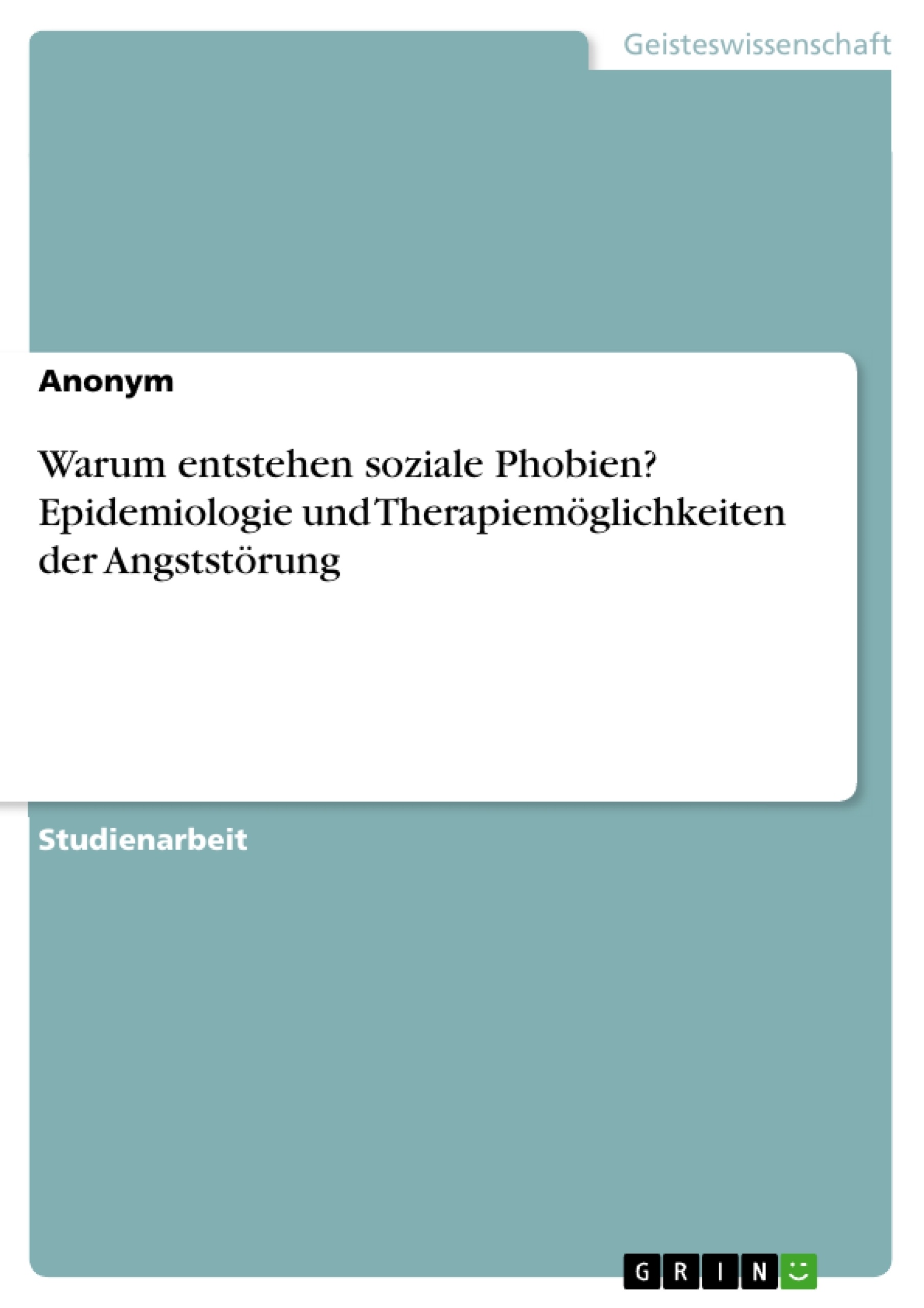Menschen, die an einer Sozialen Phobie leiden, haben Angst vor Menschen, die sie normalerweise zum Leben brauchen. Warum entsteht sie dann?
Zu Beginn der Arbeit werden die notwendigen Begriffe der sozialen Phobie definiert. Anschließend wird ein kurzer Einblick in die Epidemiologie der Angststörung und Therapiemöglichkeiten gegeben. Der Autor bezieht sich auf folgende These von Aristoteles um den Widerspruch mit der sozialen Phobie zu verdeutlichen. Diese besagt, dass der Mensch ohne soziale Kontakte nicht überlebensfähig ist. Dem nachgestellt sind Fallbeispiele von Menschen mit Sozialphobien, anhand deren der Autor seine erarbeiteten Lösungsansätze erläutert.
Nicht wenige Menschen der Bevölkerung sind an einer sozialen Phobie erkrankt. Einer der häufigsten Angststörung, die ein Leben der Betroffenen stark einschränkt und therapiert werden kann und muss, um Betroffenen wieder mehr Lebensqualität zu gewährleisten. Durch die Erklärung der sozial-phobischen Störung soll herausgefunden werden, welchen Einfluss Menschen auf diese spezielle Phobie haben können, obwohl Menschen ohne andere Menschen nicht lebensfähig sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsklärungen
- 2.1 Definition „Phobie“
- 2.2 Definition „Sozial“
- 3. Soziale Phobie
- 3.1 Epidemiologie
- 3.2 Abgrenzung der Sozialen Phobie
- 3.3 Therapiemöglichkeiten
- 3.4 Fallbeispiele
- 4. Zoon politikon nach Aristoteles
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den scheinbaren Widerspruch zwischen der menschlichen Abhängigkeit von sozialen Kontakten und dem Auftreten sozialer Phobien. Ziel ist es, die Entstehung sozialer Phobien zu beleuchten und mögliche Erklärungsansätze zu finden. Dabei wird der Bezug zu Aristoteles' These vom „zoon politikon“ hergestellt.
- Definition und Abgrenzung sozialer Phobien
- Epidemiologische Aspekte und Therapiemöglichkeiten
- Der Mensch als soziales Wesen (Aristoteles)
- Der Widerspruch zwischen sozialer Abhängigkeit und sozialer Phobie
- Mögliche Erklärungen für die Entstehung sozialer Phobien
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Frage nach der Entstehung sozialer Phobien im Kontext der menschlichen Abhängigkeit von sozialen Kontakten. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit, der die Definition relevanter Begriffe, einen Einblick in die Epidemiologie und Therapiemöglichkeiten sozialer Phobien, die Auseinandersetzung mit Aristoteles' Konzept des „zoon politikon“ und schließlich die Präsentation von Lösungsansätzen umfasst. Der Widerspruch zwischen dem essentiellen Bedürfnis nach sozialen Kontakten und der Angst vor sozialen Situationen, die soziale Phobie charakterisiert, wird als Kernproblem formuliert, das im Laufe der Arbeit untersucht werden soll.
2. Begriffsklärungen: Dieses Kapitel liefert die notwendigen Definitionen für ein umfassendes Verständnis der Hausarbeit. „Phobie“ wird als unangemessene, stark ausgeprägte Angst vor bestimmten Situationen oder Objekten definiert, die trotz deren Ungefährlichkeit auftritt und mit körperlichen Symptomen einhergeht. Die Komponente „Sozial“ wird im Kontext zwischenmenschlicher Handlungen und der Gesellschaft erläutert. Hier werden soziale Beziehungen, Netzwerke und Lebensräume als zentrale Aspekte des sozialen Umfelds eines Menschen hervorgehoben und mit entsprechenden Zitaten untermauert. Die klare Definition dieser zentralen Begriffe sichert die einheitliche Verwendung in der weiteren Analyse.
3. Soziale Phobie: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit der Sozialen Phobie. Es beleuchtet epidemiologische Aspekte der Störung, grenzt sie von anderen Angststörungen ab und beschreibt verschiedene Therapiemöglichkeiten. Zusätzlich werden Fallbeispiele vorgestellt, die die Auswirkungen der Sozialen Phobie auf das Leben Betroffener veranschaulichen. Die Zusammenfassung der epidemiologischen Daten, der Abgrenzungskriterien und der Therapieoptionen bietet ein fundiertes Verständnis der Erkrankung. Die Fallbeispiele dienen als Illustration der individuellen Manifestation und der weitreichenden Folgen der Störung.
4. Zoon politikon nach Aristoteles: Dieses Kapitel analysiert Aristoteles' Konzept des „zoon politikon“, des Menschen als soziales Wesen, und dessen Relevanz für das Verständnis sozialer Phobien. Es wird der fundamentale Zusammenhang zwischen dem menschlichen Dasein und der Notwendigkeit sozialer Interaktion herausgearbeitet. Die Auseinandersetzung mit Aristoteles' Philosophie dient als Grundlage für die spätere Diskussion des scheinbaren Paradoxons: Wie kann eine Störung entstehen, die das essentielle Bedürfnis des Menschen nach sozialen Kontakten untergräbt?
Schlüsselwörter
Soziale Phobie, Angststörung, soziale Kontakte, Aristoteles, zoon politikon, Epidemiologie, Therapie, zwischenmenschliche Beziehungen, Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Soziale Phobie im Kontext des "zoon politikon"
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit untersucht den Widerspruch zwischen dem menschlichen Bedürfnis nach sozialen Kontakten und dem Auftreten sozialer Phobien. Sie definiert den Begriff der Sozialen Phobie, beleuchtet epidemiologische Aspekte und Therapiemöglichkeiten, analysiert Aristoteles' Konzept des "zoon politikon" und versucht, mögliche Erklärungen für die Entstehung sozialer Phobien zu finden.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Begriffsklärungen (Definition von Phobie und Sozialem), Soziale Phobie (Epidemiologie, Abgrenzung, Therapiemöglichkeiten, Fallbeispiele), Zoon politikon nach Aristoteles und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Wie werden soziale Phobie und der Begriff "Sozial" definiert?
„Phobie“ wird als unangemessene, stark ausgeprägte Angst vor bestimmten Situationen oder Objekten definiert, die trotz deren Ungefährlichkeit auftritt und mit körperlichen Symptomen einhergeht. „Sozial“ wird im Kontext zwischenmenschlicher Handlungen und der Gesellschaft erläutert, wobei soziale Beziehungen, Netzwerke und Lebensräume als zentrale Aspekte hervorgehoben werden.
Welche epidemiologischen Aspekte und Therapiemöglichkeiten der Sozialen Phobie werden behandelt?
Das Kapitel "Soziale Phobie" beleuchtet epidemiologische Daten, grenzt die Störung von anderen Angststörungen ab und beschreibt verschiedene Therapiemöglichkeiten. Zusätzlich werden Fallbeispiele zur Veranschaulichung der Auswirkungen auf Betroffene präsentiert.
Welche Rolle spielt Aristoteles' "zoon politikon"?
Aristoteles' Konzept des "zoon politikon", des Menschen als soziales Wesen, wird analysiert, um den fundamentalen Zusammenhang zwischen menschlichem Dasein und sozialer Interaktion herauszuarbeiten. Es dient der Diskussion des scheinbaren Paradoxons: Wie kann eine Störung entstehen, die das essentielle Bedürfnis nach sozialen Kontakten untergräbt?
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Soziale Phobie, Angststörung, soziale Kontakte, Aristoteles, zoon politikon, Epidemiologie, Therapie, zwischenmenschliche Beziehungen, Gesellschaft.
Was ist die Zielsetzung der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Entstehung sozialer Phobien und sucht nach möglichen Erklärungsansätzen. Der Bezug zu Aristoteles' These vom „zoon politikon“ soll dabei helfen, den scheinbaren Widerspruch zwischen sozialer Abhängigkeit und sozialer Phobie zu verstehen.
Wo finde ich Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel?
Die Zusammenfassungen der Kapitel 1-4 sind im Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel" detailliert beschrieben und geben einen Überblick über den jeweiligen Inhalt.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2016, Warum entstehen soziale Phobien? Epidemiologie und Therapiemöglichkeiten der Angststörung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/492956