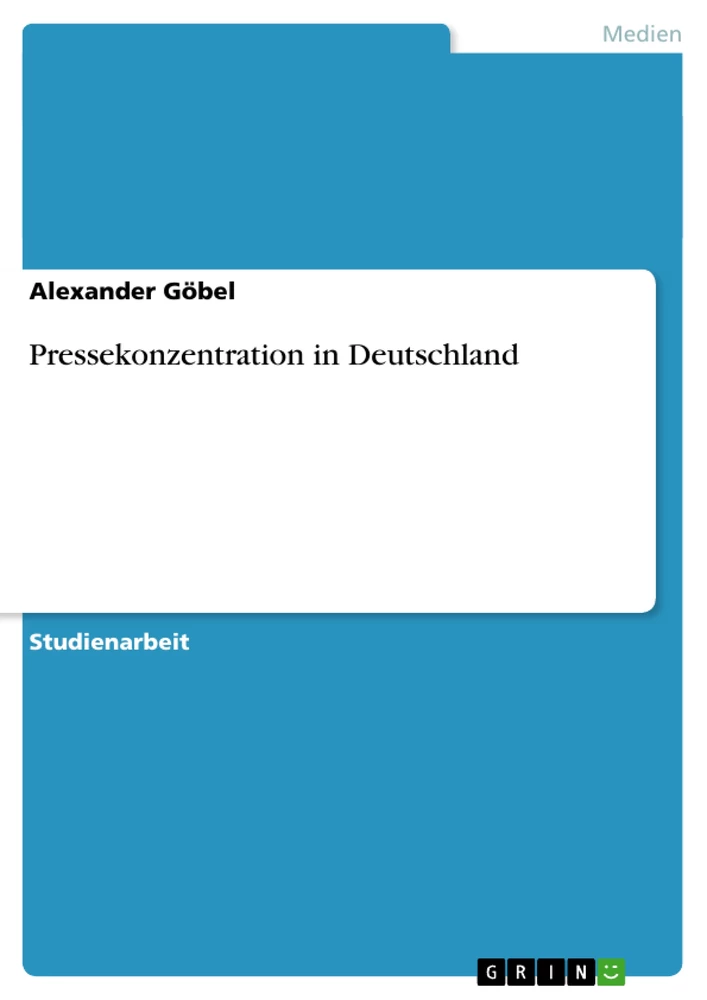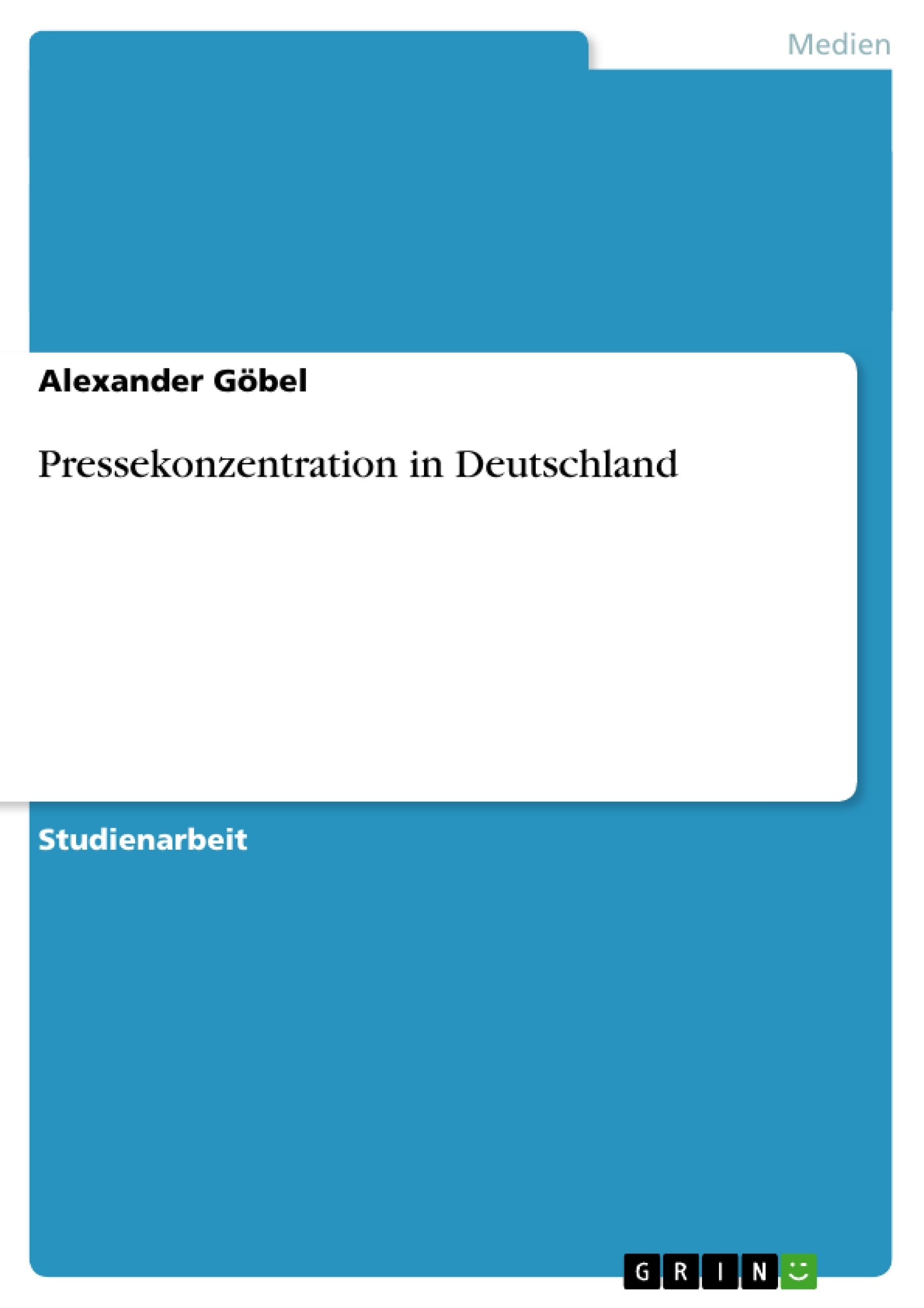Die Krise im Zeitungsmarkt hält an, und die Rezession im Werbemarkt ist noch nicht überwunden. Allerdings haben die Zeitungs- und Zeitschriftenverlage in den ersten Monaten dieses Jahres keine weiteren Einbrüche bei den Werbeumsätzen gemeldet und einige Verlage sogar wieder leichte Zugewinne verzeichnen können. Wie lange es aber noch dauert, bis das Anzeigengeschäft wieder deutlich zunehmen wird, ist noch nicht absehbar. Prognosen zufolge werden Tages-, Wochen- und Sonntagszeitungen jedoch noch bis zum Jahr 2007 die stärkste Werbeträgergruppe in Deutschland bleiben.
Trotzdem waren die meisten Verlage seit Beginn der Werbekrise im Jahr 2001 zunächst ausschließlich mit Kostenbegrenzungen beschäftigt, um sich der neuen Situation anzupassen. Etliche Lokalausgaben sind inzwischen eingestellt und immer mehr Verlagsunternehmen schließen sich zusammen, indem Verlage Anteile anderer Verlage kaufen oder sie ganz übernehmen. Die jüngsten Fälle betrafen die Frankfurter Rundschau, die von der SPD-Medienholding Deutsche Druck- und Verlags GmbH zu 90 Prozent übernommen worden ist, die beim Kartellamt angemeldete mehrheitliche Übernahme der Rhein-Zeitung in Koblenz durch den Saarbrücker Zeitungsverlag und damit durch den Holtzbrinck-Konzern sowie den zunächst minoritären Einstieg des Springer-Konzerns beim Westfalen-Blatt in Bielefeld. So hat die Medienkrise die ohnehin schon seit über drei Jahrzehnten anhaltende Konzentration des Pressewesens mithin verschärft.
Im Vergleich zum ersten Quartal 2002 sind die Konzentrationswerte für den Zeitungsmarkt im ersten Quartal 2004 allerdings weitgehend gleich geblieben. Der Marktanteil der fünf größten Verlagsgruppen bei den Abonnementzeitungen liegt mit 28,8 Prozent exakt auf dem gleichen Niveau und beträgt bei den Boulevardzeitungen 95,1 Prozent gegenüber 94,6 Prozent im Jahr 2002. Im Gesamtmarkt ist der Anteil der zehn auflagenstärksten Verlagsgruppen aufgrund von Auflagenverlusten bei Boulevardzeitungen (BILD, Express) sogar erstmals seit vielen Jahren leicht rückläufig und liegt bei 56,1 Prozent (56,3 Prozent im Jahr 2002).
In der folgenden Seminararbeit werden die verschiedenen Formen, Ursachen, Entwicklungen und Auswirkungen der Pressekonzentration seit der Gründung der Bundesrepublik aufgezeigt und die aktuelle Entwicklung im Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt geschildert. Letztlich werde ich auf die derzeitig vom Bundeswirtschaftsminister geplanten Neuregelungen des Kartellrechts für die Presse eingehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aktuelle Situation im Zeitungsmarkt
- Phasen der Pressekonzentration
- Entwicklung der Pressekonzentration
- Die Pressestatistik
- Presse in der DDR
- Formen der Pressekonzentration
- Die Publizistische Konzentration
- Die Verlagskonzentration
- Gründe für Konzernbildungen
- Die Auflagenkonzentration
- Die Lokalkonzentration
- Folgen der Lokalkonzentration
- Maßnahmen gegen die Pressekonzentration
- Die „Michel-Kommission“
- Die „Günther-Kommission“
- Pressefusionskontrolle
- Novellierung der Presseklausel im Kartellrecht
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Pressekonzentration in Deutschland und untersucht deren Formen, Ursachen, Entwicklungen und Auswirkungen. Sie beleuchtet die aktuelle Situation im Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt und geht auf die vom Bundeswirtschaftsminister geplanten Neuregelungen des Kartellrechts für die Presse ein.
- Entwicklung der Pressekonzentration in Deutschland seit der Gründung der Bundesrepublik
- Die verschiedenen Formen der Pressekonzentration, wie publizistische, Verlags- und Auflagenkonzentration
- Ursachen der Pressekonzentration, wie beispielsweise der Konkurrenzkampf zwischen Alt- und Neuverlegern und die Werbekrise
- Die Auswirkungen der Pressekonzentration auf den Medienmarkt und die Meinungsvielfalt
- Die Maßnahmen gegen die Pressekonzentration, wie die Michel- und Günther-Kommission sowie die Novellierung der Presseklausel im Kartellrecht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die aktuelle Situation im Zeitungsmarkt dar, die durch die anhaltende Krise und die Rezession im Werbemarkt geprägt ist. Die Konzentration des Pressewesens hat sich durch die Medie nkrise verstärkt, dennoch sind die Konzentrationswerte für den Zeitungsmarkt im ersten Quartal 2004 im Vergleich zum ersten Quartal 2002 weitgehend gleich geblieben. Die Seminararbeit beleuchtet die verschiedenen Formen, Ursachen, Entwicklungen und Auswirkungen der Pressekonzentration seit der Gründung der Bundesrepublik und beschreibt die aktuelle Entwicklung im Zeitungs- und Zeitschriftenmarkt. Sie geht auf die derzeitig vom Bundeswirtschaftsminister geplanten Neuregelungen des Kartellrechts für die Presse ein.
Phasen der Pressekonzentration
Die Entwicklung der Pressekonzentration in Deutschland seit dem Ende des zweiten Weltkrieges wird in diesem Kapitel behandelt. Nach der Auflösung der Druckereien und Redaktionen durch die alliierten Besatzungsmächte wurde ein Lizenzzwang für die Herausgabe von Zeitungen eingeführt. Nach Aufhebung des Lizenzzwangs kam es zu zahlreichen Zeitungsneugründungen, die zu einem scharfen Konkurrenzkampf führten, der den ersten Pressekonzentrationsprozess in der Bundesrepublik Deutschland einleitete. Dieser Prozess manifestierte sich in zahlreichen Einstellungen, Übernahmen und Zusammenschlüssen. 1976 wurde der absolute Tiefstand des Zeitungsgesamtbestandes in Westdeutschland erreicht. Es gab nur noch 121 publizistischen Einheiten, die in 1229 redaktionellen Ausgaben erschienen und von nur noch 403 Verlagen herausgegeben wurden. Zugleich stiegen die Auflagen der Tageszeitungen zwischen 1954 und 1976 von 13,4 Mio. auf 19,5 Mio. an. In diesem Zusammenhang werden die Auflagenkonzentration und die Verlagskonzentration in Kapitel 3 näher betrachtet.
Die Pressestatistik
Walter J. Schütz begann 1954 erstmals, das Zeitungswesen statistisch zu erfassen und prägte die Differenzierung nach „publizistischer Einheit“, „(redaktionellen) Ausgaben“, und „Verlagen als Herausgeber“. Diese Unterscheidung wird im Kapitel erläutert.
Presse in der DDR
Presse, Rundfunk und Fernsehen in der DDR waren in das Prinzip der staatlichen Gewaltenkonzentration eingebunden und somit der verlängerte politische Arm von SED und Staat. Die Strukturen der Zeitungslandschaft in der DDR entstanden 1952 nach der Aufteilung des DDR-Territoriums in 15 Bezirke und blieben seitdem beinahe unverändert. Insgesamt erschienen 38 Tageszeitungen. Außer dem von der SED in Millionenauflage herausgegebenen „Neuen Deutschland“ gab es überregionale Tageszeitungen der Blockparteien und Massenorganisationen sowie regionale Tageszeitungen in den 15 DDR-Bezirken.
Schlüsselwörter
Pressekonzentration, Zeitungsmarkt, Verlagskonzentration, Auflagenkonzentration, Lokalkonzentration, Publizistische Konzentration, Medie nkrise, Kartellrecht, Meinungsvielfalt, Lizenzzwang, Altverleger, Neuverleger, Bundeswirtschaftsminister, Michel-Kommission, Günther-Kommission, Pressefusionskontrolle.
- Quote paper
- Alexander Göbel (Author), 2004, Pressekonzentration in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49208