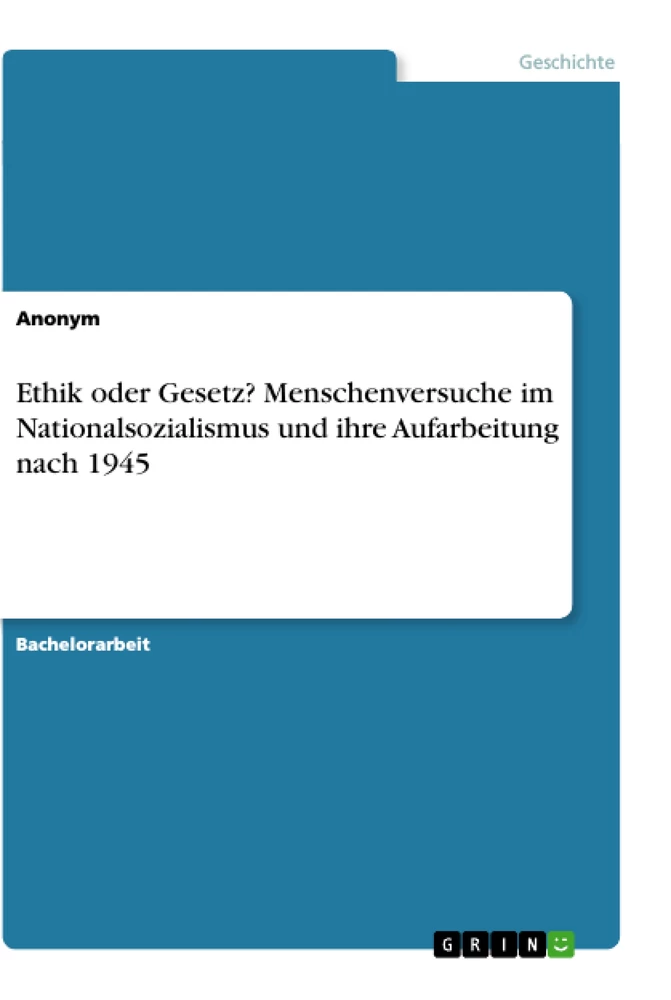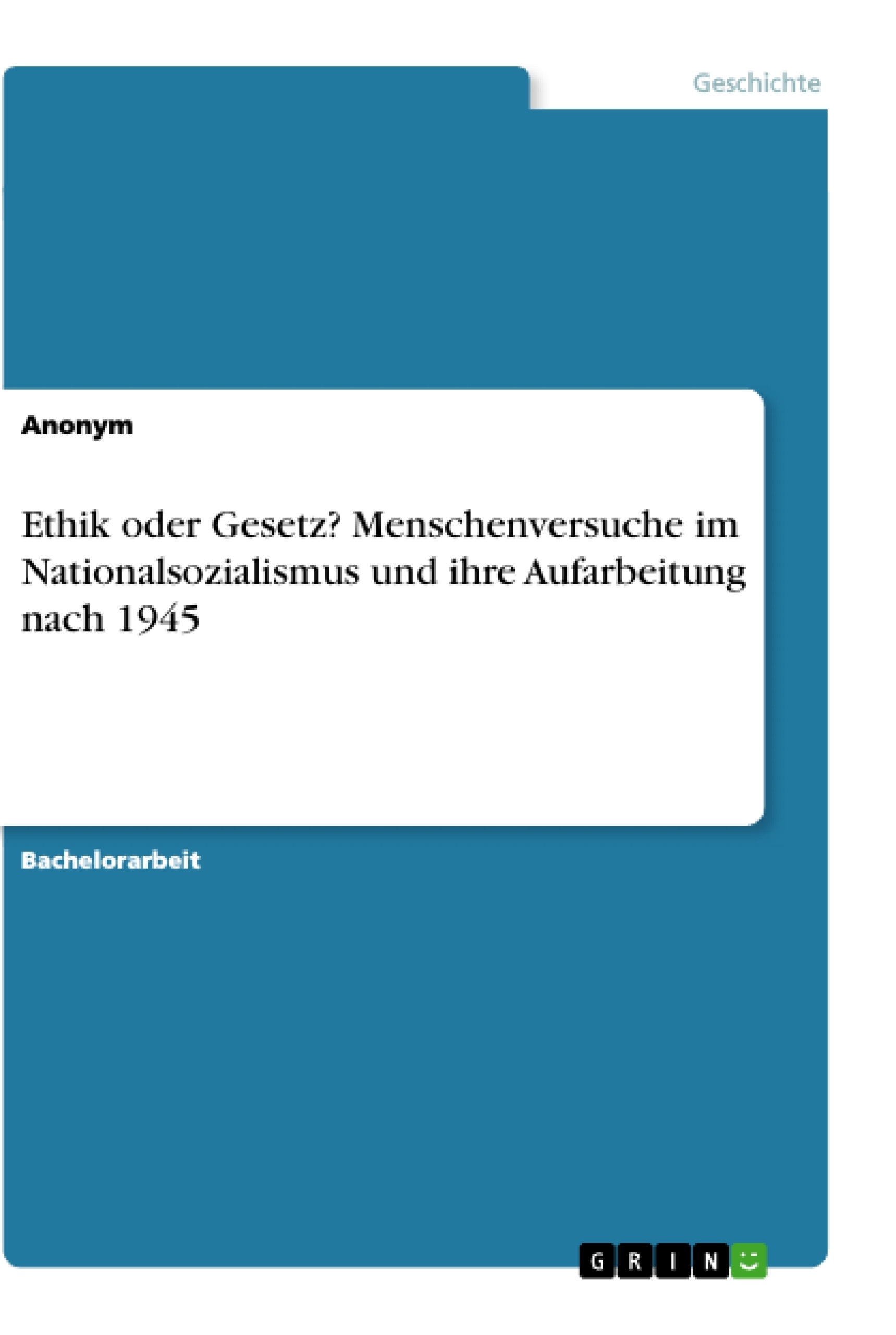Die Hauptaufgabe des Arztes besteht in seiner Berufung des Heilens. Doch im Nationalsozialismus dreht sich dieses Ärztebild um: Anstatt zu heilen, töten sie. Sie führen Menschenversuche durch, bewachen Folter und Erschießungen, selektieren, schicken Menschen in die Gaskammern. Die Versuche entziehen sich teilweise jeglicher wissenschaftlicher Grundlage, ein gebrochenes Bein genügt für die Erklärung zum "Arbeitsunfähigen" und die Entscheidung des Arztes für den Gastod.
Diese Bachelorarbeit soll den Umgang nach 1945 mit der Entartung der ärztlichen Ethik ergründen. Wie gingen die Alliierten mit dieser Art von Verbrechen um? Verfuhren sie bei der Bewertung der Taten nach ethischen oder nach rechtlichen Gesichtspunkten? Wie sahen die neuen Regelungen zu Humanexperimenten aus, welchen Einfluss hatte die NS-Vergangenheit auf diese? Außerdem soll versucht werden, durch die Aussagen der Täter eine Erklärung für ihre Verbrechen zu finden. Was sagen sie über ihre Taten und das Verhältnis zu diesen aus? Sahen die Ärzte die Möglichkeit einer neuen Forschung, die nicht mehr durch Vorbehalte gegenüber Menschenversuchen eingeschränkt war? Und wenn ja, war dies bei allen Ärzten so und zu welchem Zweck?
In dieser Arbeit werden speziell die Prozesse der beiden Ärzte Hans-Wilhelm Münch und Herta Oberheuser betrachtet, über die vor allem Aussagen aus den Nürnberger und Krakauer Prozessen vorliegen; bei beiden gab es aber auch noch spätere Verfahren. Herta Oberheuser wurde wegen ihrer Menschenversuche im Konzentrationslager Ravensbrück zu 20 Jahren Haft verurteilt, Hans-Wilhelm Münch hingegen trotz seiner Versuche in Auschwitz freigesprochen. Es scheint also Unterschiede in der ethischen Betrachtung ihrer Arbeit gegeben zu haben, sowohl aus der Sicht der Täter selbst als auch aus der der rechtsprechenden Gewalt. Wie wurden ihre Taten rückblickend betrachtet, bewertetet und (teilweise) legitimiert? Um diesen Fragen nachzugehen, soll in dieser Arbeit vorerst beschrieben werden, wie die Regelungen zu Humanexperimenten vor dem Nationalsozialismus aussahen und wie es zu einer ethisch neuen Betrachtung von diesen nach der nationalsozialistischen Machtübernahme kam. Anschließend wird ein kurzer Überblick über die verschiedenen Arten von medizinischen Verbrechen während des Dritten Reiches gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Eine neue Art der Forschung
- Regelungen von Humanexperimenten vor und während des Nationalsozialismus
- Umgang mit Menschenversuchen in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945
- Rechtliche Regelung
- Aufarbeitung von Menschenversuchen des Nationalsozialismus im Nürnberger Ärzteprozess
- Strafrechtlicher und gesellschaftlicher Umgang mit den Menschenversuchen des Nationalsozialismus nach 1945 - Zwei Beispiele
- Das Beispiel Herta Oberheuser
- Nürnberger Prozess
- Rückkehr in den ärztlichen Beruf und Prozess um die Schließung ihrer Praxis
- Das Beispiel Hans-Wilhelm Münch
- Krakauer Prozess
- Neue Aussagen und Ermittlungen
- Das Beispiel Herta Oberheuser
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Aufarbeitung von Menschenversuchen im Nationalsozialismus nach 1945. Sie untersucht, wie die Alliierten mit diesen Verbrechen umgingen und welche ethischen und rechtlichen Gesichtspunkte bei der Bewertung der Taten eine Rolle spielten.
- Die Entwicklung der rechtlichen Regelungen für Humanexperimente vor und während des Nationalsozialismus
- Die Aufarbeitung von Menschenversuchen im Nürnberger Ärzteprozess
- Die ethische und rechtliche Bewertung von Menschenversuchen durch die Prozesse gegen Herta Oberheuser und Hans-Wilhelm Münch
- Der Einfluss der NS-Vergangenheit auf die neuen Regelungen zu Humanexperimenten
- Die Motivationen und Rechtfertigungen der Täter im Hinblick auf ihre Verbrechen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit vor und beleuchtet die Bedeutung von Menschenversuchen im Nationalsozialismus. Sie verdeutlicht die moralische Abwertung von Menschen und die Umdeutung des ärztlichen Berufsauftrags während des Nationalsozialismus.
Kapitel 2 beleuchtet die Entwicklung der rechtlichen Regelungen zu Humanexperimenten vor und während des Nationalsozialismus. Es werden die Anfänge der Diskussionen um rechtliche Regelungen in Deutschland und die kontroverse Debatte um die Versuche des Dermatologen Albert Neisser im späten 19. Jahrhundert dargestellt. Der Fokus liegt darauf, wie sich die ethische Bewertung von Humanexperimenten im Laufe der Zeit veränderte und wie es zu einer neuen Betrachtungsweise dieser Versuche nach der nationalsozialistischen Machtübernahme kam.
Kapitel 3 befasst sich mit dem Umgang mit Menschenversuchen in der Bundesrepublik Deutschland nach 1945. Es wird die Rolle des Nürnberger Ärzteprozesses bei der Aufarbeitung der Verbrechen hervorgehoben und der Einfluss der NS-Vergangenheit auf neue Regelungen zu Humanexperimenten betrachtet.
Kapitel 4 bietet zwei Fallbeispiele für den strafrechtlichen und gesellschaftlichen Umgang mit den Menschenversuchen des Nationalsozialismus: Herta Oberheuser und Hans-Wilhelm Münch. Die Aussagen der Täter und ihre Prozesse werden analysiert, um ein besseres Verständnis für ihre Motivationen und die ethische Bewertung ihrer Taten zu gewinnen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Menschenversuche, Nationalsozialismus, Medizin, Ethik, Recht, Nürnberger Ärzteprozess, Herta Oberheuser, Hans-Wilhelm Münch, Krakauer Prozess, Rechtliche Regelungen, Aufarbeitung, Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2017, Ethik oder Gesetz? Menschenversuche im Nationalsozialismus und ihre Aufarbeitung nach 1945, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/491768