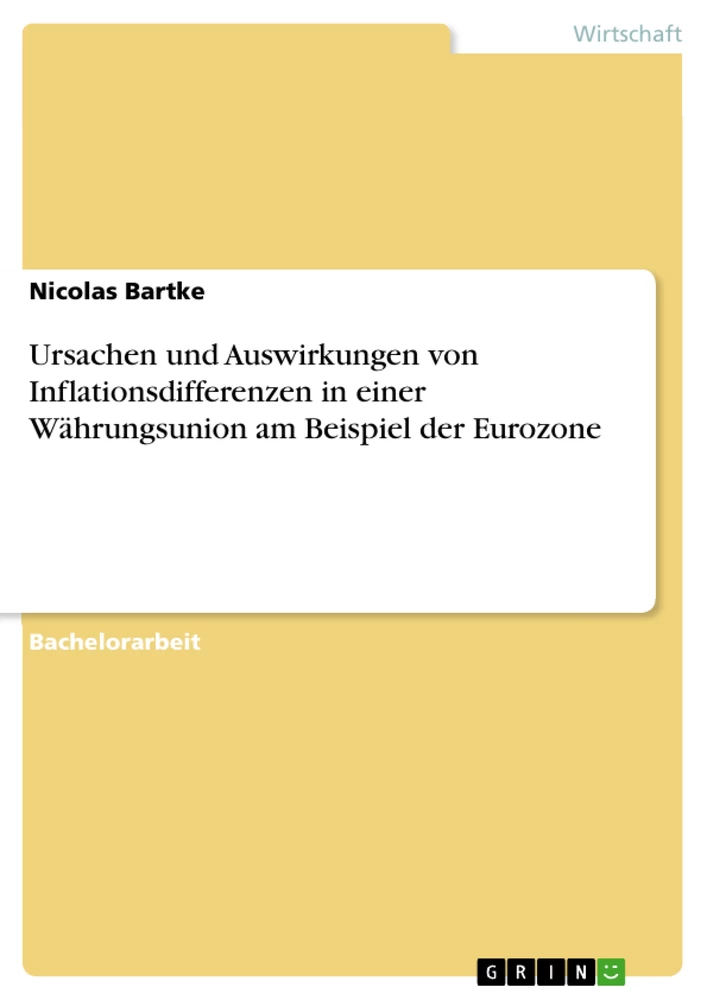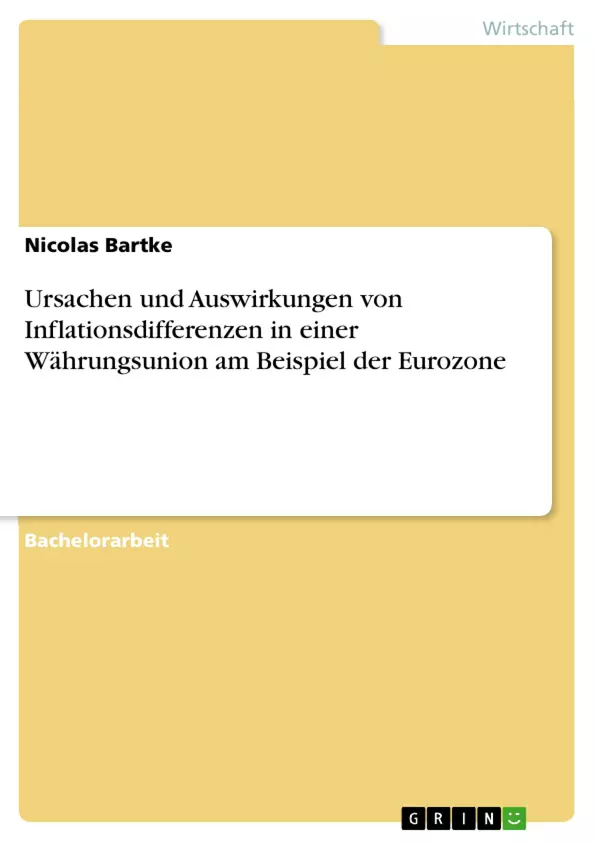Diese Bachelorarbeit widmet sich einerseits der Frage, wie die hohen, persistenten Inflationsdifferenzen in der europäischen Währungsunion entstehen konnten und was in jüngerer Vergangenheit zu ihrem Absinken beigetragen hat. Andererseits soll auf die ökonomischen und sozialen Folgen der divergenten Inflationsentwicklung eingegangen werden. Austrittsszenarien – wie sie im Zusammenhang mit der Griechenlandkrise erwogen wurden – finden nur am Rande Erwähnung und sind kein zentraler Bestandteil der Arbeit.
Der erste Teil befasst sich mit möglichen Ursachen von Inflationsdifferenzen. Zunächst soll hierbei auf den Einfluss unterschiedlicher Konsumgewohnheiten und nationaler Preis- und Steuerpolitiken auf die nationalen Warenkörbe eingegangen werden, bevor im zweiten Kapitel zuerst die asymmetrische Wirkungsweise von Kostenschocks am Beispiel von Wechselkursänderungen und Ölpreisschocks erläutert wird sowie im Anschluss die Wirkungsweise asymmetrischer Nachfrageschocks. Das dritte Kapitel befasst sich mit auslastungsbedingte Inflationsdifferenzen vor dem Hintergrund nicht vollständig harmonisierter Konjunkturzyklen. Im Anschluss wird auf die bereits angedeutete Problematik der einerseits unkoordinierten und stark eingeschränkten Fiskalpolitik und der andererseits gemeinschaftlichen Geldpolitik eingegangen. Das fünfte Kapitel behandelt in einem ersten Teil die zentrale Rolle der Löhne und das Konzept der Lohnstückkosten sowie in einem zweiten Teil die Bedeutung heterogener Lohnregime und möglicher Interessenskonflikte der Gewerkschaften für die nationalen Inflationsraten. Im sechsten Kapitel wird vor dem Hintergrund von Preis- und Lohnrigiditäten auf die Rolle der Inflationspersistenz im Kontext der divergenten Inflationsentwicklung eingegangen. Das letzte Kapitel des ersten Abschnitts widmet sich dem asymmetrischen Inflationsdruck, der von nicht-handelbaren Gütern im Zuge einer nachholenden Entwicklung und vor dem Hintergrund fehlallokierten Kapitals ausgehen kann.
Der zweite Teil befasst sich mit den ökonomischen und sozialen Auswirkungen von Inflationsdifferenzen. Hierbei wird zunächst auf die Notwendigkeit von Inflationsdifferenzen als Korrekturmechanismus eingegangen, bevor im zweiten Kapitel die konträre Wirkungsweise des Realzins- und Wechselkurskanals erläutert wird. Das letzte Kapitel der Arbeit behandelt den Zusammenhang zwischen Inflationsdifferenzen einerseits und der Verschuldung sowie hoher Leistungsbilanzungleichgewichte andererseits.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ursachen
- Indirekte Steuern, administrierte Preise und HVPI
- Kompositionseffekt
- Administrierte Preise
- Indirekte Steuern
- Asymmetrische Wirkungsweise von Schocks und Wechselkursänderungen
- Ölpreisschock
- Wechselkursänderungen
- Nachfrageschock
- Konjunkturzyklen (die Rolle der Produktionslücke)
- Die Produktionslücke
- Konjunkturzyklen in der Eurozone
- Fiskal- und Geldpolitik
- Fiskalpolitik und Staatsverschuldung
- Geldpolitik
- Löhne
- Der Zusammenhang zwischen Löhnen und Inflation
- Heterogene Lohnregime
- Eine politökonomische Perspektive auf die Lohnfindung
- Erwartungsbildung
- Preis- und Lohnrigiditäten
- Inflationsdruck durch nicht-handelbare Güter
- Inflationspersistenz
- Nachholende Entwicklung (Samuelson-Balassa-Effekt)
- Fehlallokation freien Kapitals (der umgekehrte Samuelsson-Balassa-Effekt)
- Auswirkungen
- Lohnstückkostendifferenzen als Korrekturmechanismus
- Einstiegswechselkurse
- Reaktion auf wirtschaftliche Über- und Unterauslastung
- Vergleich mit den USA
- Realzinsen und Realer Wechselkurs
- Realzinskanal
- Wechselkurskanal
- Leistungsbilanz und Verschuldung
- Die Leistungsbilanz
- Der reale effektive Wechselkurs
- Die Leistungsbilanzsalden der GIPSZ-Staaten
- Kritik an der internen Abwertung
- Sektorale Strukturen und die Überwindung der Krise
- Deutsche Leistungsbilanzüberschüsse
- Ein alternatives Szenario
- Fazit und Ausblick
- Analyse der Ursachen von Inflationsdifferenzen in der Eurozone
- Bewertung der Auswirkungen von Inflationsdifferenzen auf die Wettbewerbsfähigkeit und das Wirtschaftswachstum
- Untersuchung des Einflusses von Schocks und Wechselkursänderungen auf die Inflation
- Diskussion der Rolle von Fiskal- und Geldpolitik in Bezug auf Inflationsunterschiede
- Bewertung der Rolle von Lohnstückkostendifferenzen als Korrekturmechanismus
- Einleitung: Die Einleitung gibt einen Überblick über die Thematik und erläutert die Relevanz von Inflationsdifferenzen in der Eurozone. Sie stellt die Forschungsfrage und die Vorgehensweise der Arbeit dar.
- Ursachen: Dieses Kapitel untersucht die Ursachen von Inflationsdifferenzen in der Eurozone. Es werden verschiedene Faktoren analysiert, die zu unterschiedlichen Preistrends in den Mitgliedsstaaten beitragen können, wie z.B. indirekte Steuern, administrierte Preise, asymmetrische Schocks, Konjunkturzyklen, Fiskal- und Geldpolitik, Löhne und Erwartungen.
- Auswirkungen: Dieses Kapitel beleuchtet die Auswirkungen von Inflationsdifferenzen auf die Wirtschaft der Eurozone. Es analysiert die Rolle von Lohnstückkostendifferenzen als Korrekturmechanismus, den Einfluss auf Realzinsen und den realen Wechselkurs sowie die Auswirkungen auf die Leistungsbilanz und die Verschuldung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Ursachen und Auswirkungen von Inflationsdifferenzen in der Eurozone. Sie analysiert, wie sich unterschiedliche Preistrends in den Mitgliedsstaaten der Währungsunion auf die wirtschaftliche Entwicklung auswirken.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit wichtigen Themen und Begriffen wie Inflationsdifferenzen, Eurozone, Währungsunion, Preistrends, Wettbewerbsfähigkeit, Wirtschaftswachstum, Schocks, Wechselkursänderungen, Fiskal- und Geldpolitik, Lohnstückkostendifferenzen, Realzinsen, Realer Wechselkurs, Leistungsbilanz, Verschuldung und Samuelson-Balassa-Effekt.
Häufig gestellte Fragen
Warum gibt es Inflationsunterschiede in der Eurozone?
Ursachen sind unter anderem unterschiedliche Lohnentwicklungen, nationale Steuerpolitiken, asymmetrische Schocks und abweichende Konjunkturzyklen.
Was ist der Samuelson-Balassa-Effekt?
Er beschreibt, wie Produktivitätssteigerungen im Industriesektor eines aufholenden Landes zu höheren Preisen bei nicht-handelbaren Gütern (Dienstleistungen) führen.
Welche Rolle spielen die Lohnstückkosten?
Differenzen in den Lohnstückkosten beeinflussen die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedsstaaten und sind ein wesentlicher Treiber für Inflationsunterschiede.
Was bewirkt der Realzinskanal?
In Ländern mit höherer Inflation sind die Realzinsen bei einheitlichem EZB-Leitzins niedriger, was die Nachfrage und damit die Inflation weiter anheizen kann.
Wie hängen Inflation und Leistungsbilanz zusammen?
Anhaltend höhere Inflation führt zu einem Verlust an Wettbewerbsfähigkeit, was oft hohe Leistungsbilanzdefizite und steigende Verschuldung zur Folge hat.
- Arbeit zitieren
- Nicolas Bartke (Autor:in), 2018, Ursachen und Auswirkungen von Inflationsdifferenzen in einer Währungsunion am Beispiel der Eurozone, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/491534