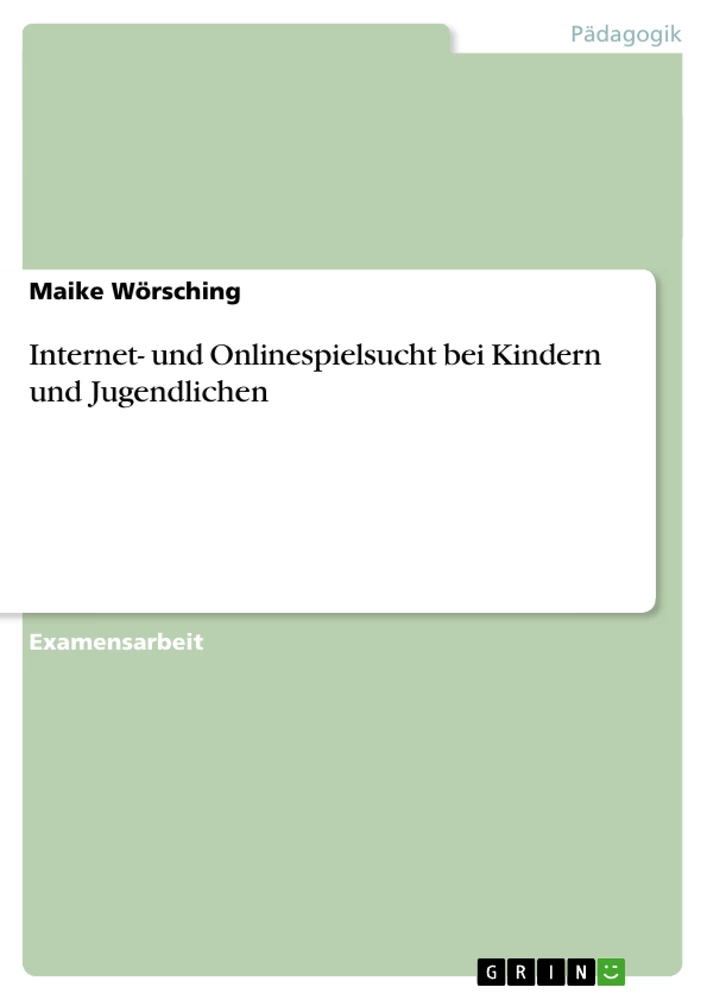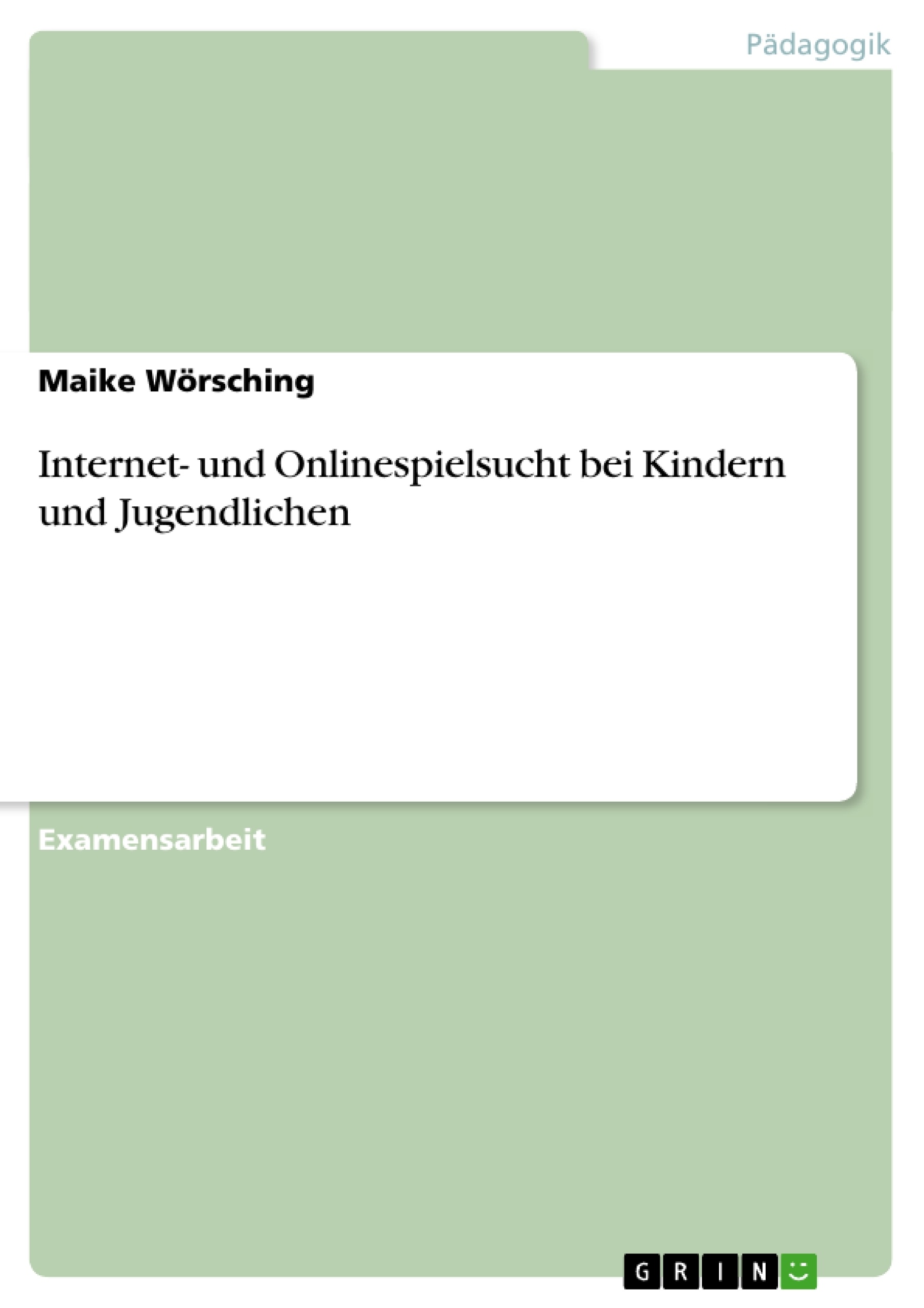Computer und Internet gewinnen in der heutigen Gesellschaft rapide an Einfluss und Bedeutung. Medienwissenschaftler und Pädagogen, aber auch Eltern und Vorgesetzte betrachten diese Medien aber immer häufiger als zweischneidiges Schwert. Vor einigen Jahren als Informations-, Bildungs- und Kommunikationsmedium gelobt, beklagen sie nun die negativen Begleiterscheinungen. So wird der Internetnutzer ständig reizüberflutet und verliert bisweilen die Übersicht. Auch wird das Internet oft ungeniert als Mittel zur Agitation eingesetzt oder bietet Raum für Menschen mit gewissen Vorlieben, die in der Gesellschaft nicht oder kaum akzeptiert werden würden. Weiterhin taucht in diesem Zusammenhang immer wieder der Vorwurf auf, das Internet verursache Abhängigkeiten oder mache gar süchtig. Besonders anfällig dafür seien Kinder und Jugendliche, die etliche Stunden am Tag surfen, chatten oder spielen.
Mit meiner Studienarbeit versuche ich, dem „Suchtfaktor Internet“ ein Stück weit auf den Grund zu gehen. Sollten diese Vorwürfe nämlich zutreffen, hätte dies weit reichende Konsequenzen für den Schulalltag. Denn nachlassende Konzentrations- und Leistungsfähigkeit gehen oft mit einem suchtartigen Verhalten einher. Weiterhin sähen sich in diesem Fall auch Lehrer und Lehrerinnen mit einer neuartigen Problematik konfrontiert, was von ihnen verlangen würde, sich darüber in dem Maße zu informieren, dass sie im Stande sind, eine Diagnose zu stellen und Präventions- oder Interventionsmaßnahmen anzubieten.
Problematisch war für mich das Fehlen einer zufrieden stellenden und allgemeingültigen Definition der Computer- und Internetsucht in der Literatur. Dieses Phänomen sofern es existiert - ist noch zu jung, um wissenschaftlich schon in aller Konsequenz untersucht zu sein. Nachdem ich einen grundlegenden Überblick zum Suchtbegriff geschaffen habe, habe ich daher zunächst vorhandene Suchtdefinitionen auf ihre Vereinbarkeit mit Begleiterscheinungen von exzessivem Internetkonsum hin überprüft. Die daraus gewonnenen Ergebnisse verwende ich im Anschluss in einer ergebnisoffenen Studie. Ich habe einen Fragenkatalog zu den Themenkomplexen Sucht und Internet ausgearbeitet. Dieser diente in Interviews mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen als Grundlage, um deren Internetgebrauchsgewohnheiten kennen zu lernen und heraus zu finden, ob sie bezüglich einer Suchtgefährdung Probleme bei ihrem Internetkonsum feststellen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Suchtbegriff
- 2.1 Sucht oder Abhängigkeit?
- 2.2 Einteilung der Süchte
- 2.3 Charakteristik einer Sucht
- 2.4 Faktoren und Motive einer Sucht
- 3. Internetsucht
- 3.1 Daten zur Internet- und Computernutzung
- 3.2 Internetsucht – Fakt oder Fiktion? Ein Forschungsüberblick
- 3.2.1 Internetsucht ist möglich
- 3.2.2 Internetsucht gibt es nicht
- 3.3 Erscheinungsbild der Internetsucht
- 3.3.1 Anzeichen für die Internetsucht
- 3.3.2 Warum macht das Internet süchtig?
- 3.3.3 Welche Bereiche des Internet sind besonders betroffen?
- 3.3.4 Auswirkungen der Internetsucht
- 3.3.4.1 Soziale Auswirkungen
- 3.3.4.2 Gesundheitliche Auswirkungen
- 3.3.4.3 Berufliche und schulische Auswirkungen
- 3.3.5 Wann ist man internetsüchtig?
- 3.4 Internetsucht bei Kindern und Jugendlichen
- 3.4.1 Betroffene Bereiche
- 3.4.1.1 Computer- und Onlinespiele
- 3.4.1.2 Kontakte knüpfen
- 3.4.2 Interventionsmöglichkeiten für Eltern betroffener Kinder
- 3.4.1 Betroffene Bereiche
- 4. Empirische Studie zum Problembewusstsein Jugendlicher bezüglich ihres Internet- und Onlinespiele-Konsums
- 4.1 Fragestellung
- 4.2 Charakterisierung des Interviews
- 4.3 Überlegungen beim Erstellen der Interviewfragen
- 4.4 Interviewfragen
- 4.5 Vorgehensweise bei der Erhebung
- 4.5.1 Zugang zum Untersuchungsfeld
- 4.5.2 Durchführung der Interviews und Aufzeichnung
- 4.5.2.1 Angaben zur Person
- 4.5.2.2 Einleitung
- 4.5.2.3 Leitfaden
- 4.6 Überlegungen zur Interpretation der Interviews
- 4.6.1 Transkription
- 4.6.2 Redigierte Aussagen
- 4.6.2.1 Selektieren der bedeutungstragenden Aussagen
- 4.6.2.2 Auslassen von Redundanzen und Füllseln
- 4.6.2.3 Transformieren in unabhängige Aussagen des Interviewpartners
- 4.6.2.4 Paraphrasieren
- 4.6.3 Auswertung der Interviews
- 4.7 Interpretation der Interviews
- 4.7.1 Redigierte Aussagen der interviewten Jugendlichen
- 4.7.2 Auswertung der Aussagen der interviewten Jugendlichen
- 4.8 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 5. Resümee
- 6. Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Internet- und Onlinespielsucht bei Kindern und Jugendlichen im Kontext des Sachunterrichts (Biologie). Ziel ist es, das Problembewusstsein Jugendlicher bezüglich ihres Konsums zu erforschen und die Auswirkungen exzessiven Internetgebrauchs zu beleuchten. Die Studie soll hilfreiche Informationen für Lehrer*innen liefern, um Präventions- und Interventionsmaßnahmen zu entwickeln.
- Definition und Charakteristika von Sucht
- Auswirkungen des exzessiven Internetkonsums auf Kinder und Jugendliche
- Empirische Untersuchung des Problembewusstseins Jugendlicher
- Analyse der Internetnutzung von Jugendlichen (Spiele, soziale Kontakte)
- Implikationen für den Schulalltag und pädagogisches Handeln
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Internet- und Onlinespielsucht bei Kindern und Jugendlichen ein und hebt die wachsende Bedeutung und den gleichzeitig ambivalenten Charakter von Internet und Computer hervor. Sie beschreibt den Anlass der Arbeit, das Fehlen einer einheitlichen Definition von Internetsucht und die daraus resultierende Notwendigkeit einer eigenen empirischen Studie zur Untersuchung des Problembewusstseins Jugendlicher. Die Arbeit legt dar, dass erhöhte Internetnutzung mit nachlassender Konzentrations- und Leistungsfähigkeit in Verbindung gebracht wird und Lehrer*innen vor neue Herausforderungen im Umgang mit dieser Problematik stellt.
2. Der Suchtbegriff: Dieses Kapitel liefert einen Überblick über den Suchtbegriff, unterscheidet zwischen Sucht und Abhängigkeit, und klassifiziert verschiedene Suchtformen. Es beleuchtet die Charakteristika von Suchtverhalten und analysiert die Faktoren und Motive, die zu Sucht führen können. Diese Grundlagen bilden die Basis für die spätere Auseinandersetzung mit der Internetsucht.
3. Internetsucht: Das Kapitel widmet sich umfassend dem Phänomen der Internetsucht. Es präsentiert Daten zur Internetnutzung, diskutiert die Kontroverse um die Existenz der Internetsucht und beschreibt das Erscheinungsbild der Sucht, einschließlich ihrer Anzeichen, Ursachen und Auswirkungen auf soziale, gesundheitliche und schulische Bereiche. Der Fokus liegt dabei auf der Internetsucht bei Kindern und Jugendlichen, mit einer detaillierten Betrachtung der betroffenen Internetbereiche (Spiele, soziale Netzwerke) und möglichen Interventionsmöglichkeiten für Eltern.
4. Empirische Studie zum Problembewusstsein Jugendlicher bezüglich ihres Internet- und Onlinespiele-Konsums: Dieses Kapitel beschreibt eine empirische Studie, die das Problembewusstsein Jugendlicher in Bezug auf ihren Internet- und Onlinespiele-Konsum untersucht. Es legt die Fragestellung dar, charakterisiert die Methodik (Interviews), beschreibt die Vorgehensweise bei der Datenerhebung und -auswertung, und präsentiert die Ergebnisse der Interviews mit mehreren Jugendlichen. Die Analyse der Interviews befasst sich mit dem Vorwissen der Jugendlichen zum Thema Sucht, ihren Hauptaktivitäten im Internet, der Bedeutung digitaler Medien in ihrem Leben, dem Einfluss der Eltern und der Einschätzung der Jugendlichen bezüglich einer möglichen Suchtgefährdung.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit: Internet- und Onlinespielsucht bei Kindern und Jugendlichen
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Phänomen der Internet- und Onlinespielsucht bei Kindern und Jugendlichen. Sie umfasst eine Literaturrecherche zum Thema Sucht, eine detaillierte Betrachtung der Internetsucht und ihrer Auswirkungen, sowie eine empirische Studie, die das Problembewusstsein Jugendlicher bezüglich ihres Internet- und Onlinespiele-Konsums erforscht. Die Arbeit richtet sich an Lehrer*innen und bietet Informationen zur Prävention und Intervention.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Charakteristika von Sucht, Auswirkungen exzessiven Internetkonsums, empirische Untersuchung des Problembewusstseins Jugendlicher, Analyse der Internetnutzung von Jugendlichen (Spiele, soziale Kontakte), Implikationen für den Schulalltag und pädagogisches Handeln. Es wird zwischen Sucht und Abhängigkeit unterschieden und verschiedene Suchtformen klassifiziert. Die Arbeit beleuchtet auch die Kontroverse um die Existenz der Internetsucht.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Der Suchtbegriff, Internetsucht, Empirische Studie zum Problembewusstsein Jugendlicher bezüglich ihres Internet- und Onlinespiele-Konsums, und Resümee. Jedes Kapitel ist in Unterkapitel unterteilt, die die einzelnen Aspekte detailliert behandeln. Die empirische Studie umfasst die Fragestellung, die Methodik (Interviews), die Vorgehensweise bei der Datenerhebung und -auswertung sowie die Interpretation der Ergebnisse.
Welche Methodik wurde in der empirischen Studie verwendet?
Die empirische Studie verwendet qualitative Interviews mit Jugendlichen, um deren Problembewusstsein bezüglich ihres Internet- und Onlinespiele-Konsums zu erforschen. Die Vorgehensweise beinhaltet die Rekrutierung der Teilnehmer, die Durchführung der Interviews, die Transkription, die Redigierung der Aussagen (Selektion, Auslassung von Redundanzen, Paraphrasieren) und die Auswertung der Interviews. Die Analyse der Interviews konzentriert sich auf das Vorwissen der Jugendlichen zum Thema Sucht, ihre Hauptaktivitäten im Internet, die Bedeutung digitaler Medien in ihrem Leben, den Einfluss der Eltern und die Einschätzung der Jugendlichen bezüglich einer möglichen Suchtgefährdung.
Welche Ergebnisse liefert die empirische Studie?
Die Ergebnisse der empirischen Studie werden im Kapitel "Empirische Studie..." präsentiert. Sie beinhalten die redigierten Aussagen der interviewten Jugendlichen und eine Auswertung dieser Aussagen. Die Zusammenfassung der Ergebnisse gibt Aufschluss über das Problembewusstsein der Jugendlichen bezüglich ihres Internetkonsums und ihrer Onlinespieleaktivitäten.
Welche Zielgruppe spricht diese Arbeit an?
Diese Arbeit richtet sich in erster Linie an Lehrer*innen, um ihnen hilfreiche Informationen zur Prävention und Intervention im Bereich der Internet- und Onlinespielsucht bei Kindern und Jugendlichen zu liefern.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit werden im Resümee zusammengefasst. Sie basieren auf den Ergebnissen der Literaturrecherche und der empirischen Studie und liefern einen Überblick über die Erkenntnisse zum Thema Internet- und Onlinespielsucht bei Kindern und Jugendlichen.
- Quote paper
- Maike Wörsching (Author), 2006, Internet- und Onlinespielsucht bei Kindern und Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/49119