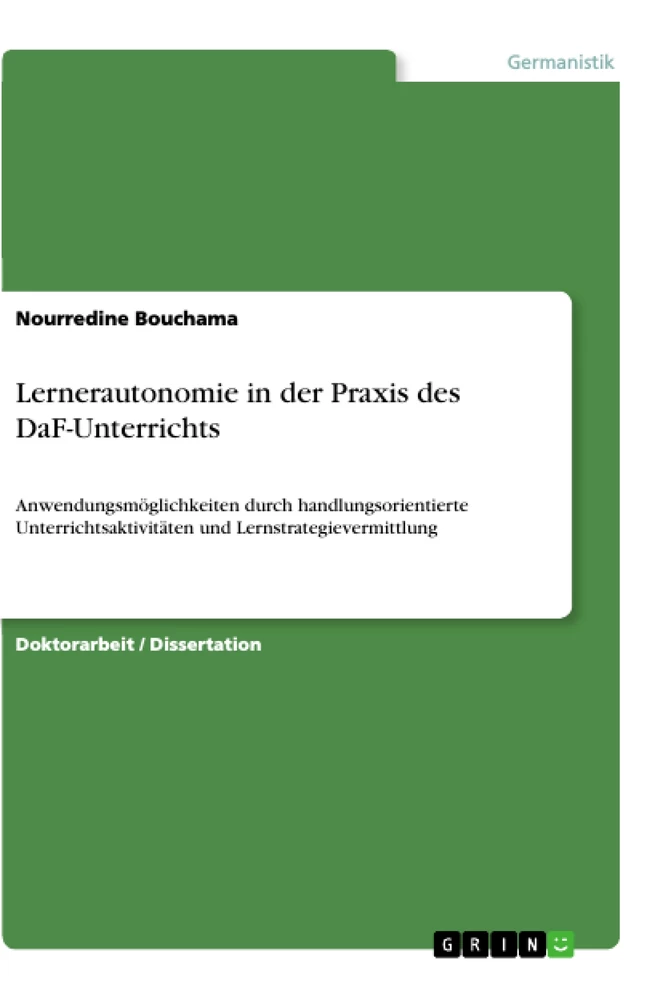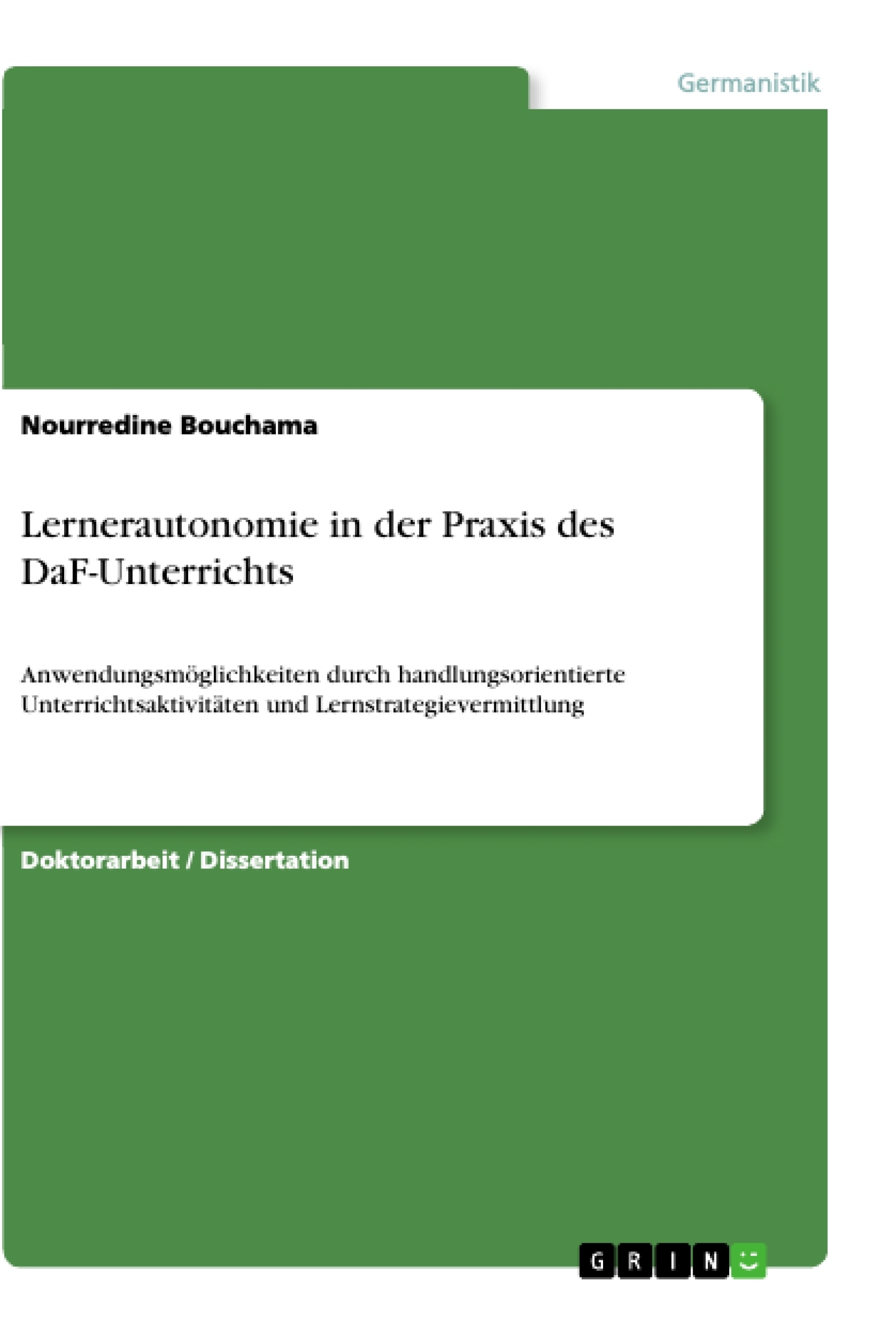Diese Doktorarbeit ist ein Beitrag zur Erforschung beziehungsweise Anwendung der Lernerautonomie in der schulischen DaF-Unterrichtspraxis. Die Berücksichtigung der Lernerautonomie im Unterricht ist unentbehrlich für ein modernes Fremdsprachenlernen. Die praktische Anwendung der Lernerautonomie in der Schulrealität fordert aber eine Gereimtheit der bestehenden Lernerautonomie Konzeptionen mit den curricularen und unterrichtlichen Faktoren. Dabei muss auf die absolute Autonomie verzichtet und die Verstricktheit der Autonomie und Heteronomie in Bezug auf die Lernaufgaben anerkannt werden. Die konkrete Einbettung einer mit den schulischen Lernsituationen kompatiblen Lernerautonomie steht zwischen den zwei Extremen, die entweder das Konzept Lernerautonomie durch Verabsolutierung trivialisieren oder das Konzept Lernen durch die Dominanz der Lehrerperson und der curricularen Vorgaben stark reduzieren.
In dieser Arbeit wird Lernerautonomie in den fremdsprachendidaktischen Ansätzen und im Unterricht begründet. Dazu wird sie in einen Zusammenhang mit der bestehenden Mehrsprachigkeit, der Steigerung der Lern- und Leistungsmotivation gebracht. Außerdem wird Lernerautonomie durch Anschlussstellen, und zwar durch ergänzende Unterrichtsprinzipien, handlungsorientierte Lernaufgaben und Vermittlung der Lernstrategien, ans konkrete Unterrichtsgeschehen gekoppelt und einbezogen. Diese Forschungsarbeit leistet ein konkretes in der Praxis geprüftes autonomieförderndes Unterrichtsmodell, das den Individualitäten des einzelnen Schülers Rechnung trägt und ihn durch handlungsorientierte Lernaufgaben und bewusst machende Lernstrategien befähigt, die Verantwortung über seinen eigenen Lernprozess allmählich zu übernehmen und sich stufenweise von den heteronomen Fremdbestimmungen zu befreien. Dabei werden die Lernerautonomie Förderungsbereiche, nämlich Lerner-Individualitäten, Aufgabentypen und Lernstrategievermittlung in curriculare Vorgaben, unterrichtliche Faktoren und Unterrichtsgeschehen berücksichtigt und eingebettet.
Durch nomologisch-analytische, experimentelle, quantitative Methode werden die erhobenen Daten statistisch untersucht und analysiert. Dabei werden die Akzeptanz des Modells, die Lernqualität, die Lernmotivation und die Autonomieförderungsqualität im Unterrichtsmodell verifiziert. Im Fazit werden Ergebnisse des theoretischen, des praktischen und empirischen Teils mit Ausblick dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Erkenntnisinteresse und theoretische Verortung des Themas
- 1.2 Methodologisches Vorgehen
- 1.3 Problematik und Fragestellungen
- 1.4 Aufbau der Forschungsarbeit
- 2 Theoretische Hintergrundkenntnisse über Autonomie
- 2.1 Historischer Rückblick
- 2.1.1 Autonomie in der Antike (bei den Griechen)
- 2.1.2 Autonomie in den Aufklärungszeiten
- 2.1.3 (Lerner-) Autonomie in der Reformpädagogik
- 2.1.4 (Lerner-) Autonomie in den Nachkriegszeiten
- 2.1.5 Autonomie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
- 2.1.6 Von individueller zur sozialen (Lerner-) Autonomie
- 2.2 Verwandte Begriffe zu (Lerner-) Autonomie
- 2.3 Bestehende Definitionen und Definitions-Chaos der Lernerautonomie
- 2.4 Zusammenfassung des Kapitels
- 3 Lerner-Individualitäten als Faktoren der Lernerautonomie im Unterricht
- 3.1 Wirkungen der Lernstile und Persönlichkeitsmerkmale im Unterricht
- 3.1.1 Wirkung der Lernstile auf die interaktive Teilnahme an den Lernaufgaben
- 3.1.2 Wirkung der Lernstile auf Informationsverarbeitung
- 3.1.3 Wirkung der Lernstile auf Kommunikation in der Lerngruppe
- 3.1.4 Implikationen für Lernerautonomie im Unterricht
- 3.2 Wirkung der Wahrnehmungsfaktoren und Lernertypen
- 3.3 Lernstrategien
- 3.4 Lernstrategien im schulischen Tertiärsprachen Lernen
- 3.5 Zusammenfassung des Kapitels
- 4 (Lerner-) Autonomiekonzeptionen und Kritik der reinen Autonomie
- 4.1 Autonomiekonzepte in der Fremdsprachendidaktik
- 4.2 Kritik der reinen Autonomie
- 4.3 Kompatible Autonomiekonzeption
- 4.4 Zusammenfassung des Kapitels
- 5 Lernerautonomie in der Didaktik des Fremdsprachenunterrichts
- 5.1 Forschungsüberblick
- 5.2 Lernerautonomie in den didaktischen Ansätzen
- 5.3 Anknüpfungsmöglichkeiten und Anschlussstellen der Lernerautonomie im Fremdsprachenunterricht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Dissertation untersucht die praktische Anwendung von Lernerautonomie im DaF-Unterricht. Das Hauptziel ist es, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie handlungsorientierte Unterrichtsaktivitäten und die Vermittlung von Lernstrategien die Entwicklung der Lernerautonomie fördern können. Die Arbeit analysiert theoretische Grundlagen der Lernerautonomie, berücksichtigt individuelle Lernstile und -strategien und beleuchtet verschiedene didaktische Ansätze.
- Theoretische Fundierung des Konzepts der Lernerautonomie
- Einfluss individueller Faktoren (Lernstile, Lernstrategien) auf die Lernerautonomie
- Analyse verschiedener didaktischer Ansätze im Hinblick auf die Förderung der Lernerautonomie
- Konkrete Anwendungsmöglichkeiten handlungsorientierter Unterrichtsaktivitäten
- Vermittlung von Lernstrategien zur Stärkung der Lernerautonomie
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Dissertation ein, indem es das Erkenntnisinteresse und die theoretische Verortung des Themas Lernerautonomie im DaF-Unterricht darlegt. Es werden die methodologische Vorgehensweise, die Problematik und die Forschungsfragen präzisiert, bevor der Aufbau der gesamten Arbeit skizziert wird.
2 Theoretische Hintergrundkenntnisse über Autonomie: Dieses Kapitel bietet einen umfassenden historischen Überblick über das Konzept der Autonomie, beginnend von der Antike bis zur Gegenwart. Es werden verschiedene Definitionen und Konzeptionen von Lernerautonomie beleuchtet, die Herausforderungen eines „Definitions-Chaos“ diskutiert und verwandte Konzepte abgegrenzt. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Verständnisses von Autonomie, von individuellen hin zu sozialen Aspekten.
3 Lerner-Individualitäten als Faktoren der Lernerautonomie im Unterricht: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss individueller Lernervariablen auf die Entwicklung von Lernerautonomie. Es werden Lernstile (z.B. reflexiv vs. impulsiv, ambiguitätstolerant vs. ambiguitätsintolerant), Wahrnehmungstypen und Lernstrategien analysiert und deren Auswirkungen auf die Interaktion im Unterricht, die Informationsverarbeitung und die Kommunikation in Lerngruppen detailliert beschrieben. Der Zusammenhang zwischen diesen individuellen Merkmalen und der Förderung von Lernerautonomie wird deutlich herausgearbeitet.
4 (Lerner-) Autonomiekonzeptionen und Kritik der reinen Autonomie: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Autonomiekonzeptionen in der Fremdsprachendidaktik, darunter handlungstheoretische, situativ-technizistische, konstruktivistische und kognitionspsychologisch basierte Ansätze. Es werden die Konzepte miteinander verglichen und kritisch hinterfragt, wobei die Grenzen und die potenziellen Probleme einer „reinen Autonomie“ im Fokus stehen. Die Diskussion mündet in die Vorstellung einer kompatiblen Autonomiekonzeption.
5 Lernerautonomie in der Didaktik des Fremdsprachenunterrichts: Dieses Kapitel bietet einen Forschungsüberblick zur Lernerautonomie im Fremdsprachenunterricht, sowohl in deutsch- als auch englischsprachiger Literatur. Verschiedene didaktische Ansätze (kommunikativer, handlungsorientierter, prozessorientierter, lernerzentrierter Ansatz) werden im Hinblick auf ihre Anknüpfungspunkte an die Förderung der Lernerautonomie analysiert. Das Kapitel zeigt Möglichkeiten auf, wie die Prinzipien von Sprachbewusstheit, Handlungsorientierung und Authentizität die Entwicklung von Lernerautonomie unterstützen können.
Schlüsselwörter
Lernerautonomie, DaF-Didaktik, Handlungsorientierung, Lernstrategien, Lernstile, kommunikativer Ansatz, prozessorientierter Ansatz, lernerzentrierter Ansatz, Fremdsprachendidaktik, Autonomiekonzeptionen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Dissertation: Lernerautonomie im DaF-Unterricht
Was ist der Gegenstand dieser Dissertation?
Die Dissertation untersucht die praktische Anwendung von Lernerautonomie im Deutsch als Fremdsprache (DaF)-Unterricht. Das Hauptziel ist es, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie handlungsorientierte Unterrichtsaktivitäten und die Vermittlung von Lernstrategien die Entwicklung der Lernerautonomie fördern können.
Welche Themen werden in der Dissertation behandelt?
Die Arbeit behandelt theoretische Grundlagen der Lernerautonomie, berücksichtigt individuelle Lernstile und -strategien und beleuchtet verschiedene didaktische Ansätze. Konkret werden historische Entwicklungen des Autonomiebegriffs, der Einfluss individueller Faktoren (Lernstile, Lernstrategien) auf die Lernerautonomie, verschiedene didaktische Ansätze zur Förderung der Lernerautonomie und konkrete Anwendungsmöglichkeiten handlungsorientierter Unterrichtsaktivitäten untersucht. Die Vermittlung von Lernstrategien zur Stärkung der Lernerautonomie spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.
Wie ist die Dissertation aufgebaut?
Die Dissertation ist in fünf Kapitel gegliedert: Kapitel 1 bietet eine Einleitung mit Erkenntnisinteresse, Methodik und Forschungsfragen. Kapitel 2 behandelt die theoretischen Grundlagen der Autonomie historisch und konzeptionell. Kapitel 3 untersucht den Einfluss individueller Lernermerkmale auf die Lernerautonomie. Kapitel 4 befasst sich mit verschiedenen Autonomiekonzeptionen in der Fremdsprachendidaktik und deren Kritik. Kapitel 5 analysiert die Lernerautonomie in verschiedenen didaktischen Ansätzen des Fremdsprachenunterrichts.
Welche Methoden werden in der Dissertation angewendet?
Die Dissertation beschreibt die methodologische Vorgehensweise im ersten Kapitel. Die genaue Methodik wird im Text detailliert dargestellt, jedoch ist aus diesem Preview keine genaue Beschreibung der angewandten Methoden ersichtlich.
Welche Schlüsselbegriffe sind zentral für die Dissertation?
Zentrale Schlüsselbegriffe sind Lernerautonomie, DaF-Didaktik, Handlungsorientierung, Lernstrategien, Lernstile, kommunikativer Ansatz, prozessorientierter Ansatz, lernerzentrierter Ansatz, Fremdsprachendidaktik und Autonomiekonzeptionen.
Welche Forschungsfragen werden in der Dissertation bearbeitet?
Die konkreten Forschungsfragen werden im ersten Kapitel der Dissertation präzisiert. Aus diesem Preview lassen sich die genauen Fragestellungen nicht entnehmen.
Welche Ergebnisse werden in der Dissertation präsentiert?
Die Ergebnisse der Dissertation sind aus diesem Preview nicht ersichtlich. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über die behandelten Themen, aber keine konkreten Ergebnisse.
Für wen ist diese Dissertation relevant?
Diese Dissertation ist relevant für DaF-Lehrende, Studierende der Fremdsprachendidaktik und Wissenschaftler*innen, die sich mit Lernerautonomie und handlungsorientiertem Unterricht beschäftigen.
Wo kann ich die vollständige Dissertation finden?
Die Information über den Zugriff auf die vollständige Dissertation ist in diesem Preview nicht enthalten.
Welche historischen Aspekte der Autonomie werden behandelt?
Kapitel 2 bietet einen umfassenden historischen Überblick über das Konzept der Autonomie, beginnend von der Antike bis zur Gegenwart. Es werden verschiedene Entwicklungsstufen und Definitionen des Autonomiebegriffs beleuchtet, inklusive der Antike (bei den Griechen), der Aufklärung, der Reformpädagogik, der Nachkriegszeit und der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der Fokus liegt auf der Entwicklung des Verständnisses von Autonomie, von individuellen hin zu sozialen Aspekten.
- Quote paper
- Doktor Nourredine Bouchama (Author), 2019, Lernerautonomie in der Praxis des DaF-Unterrichts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/491048