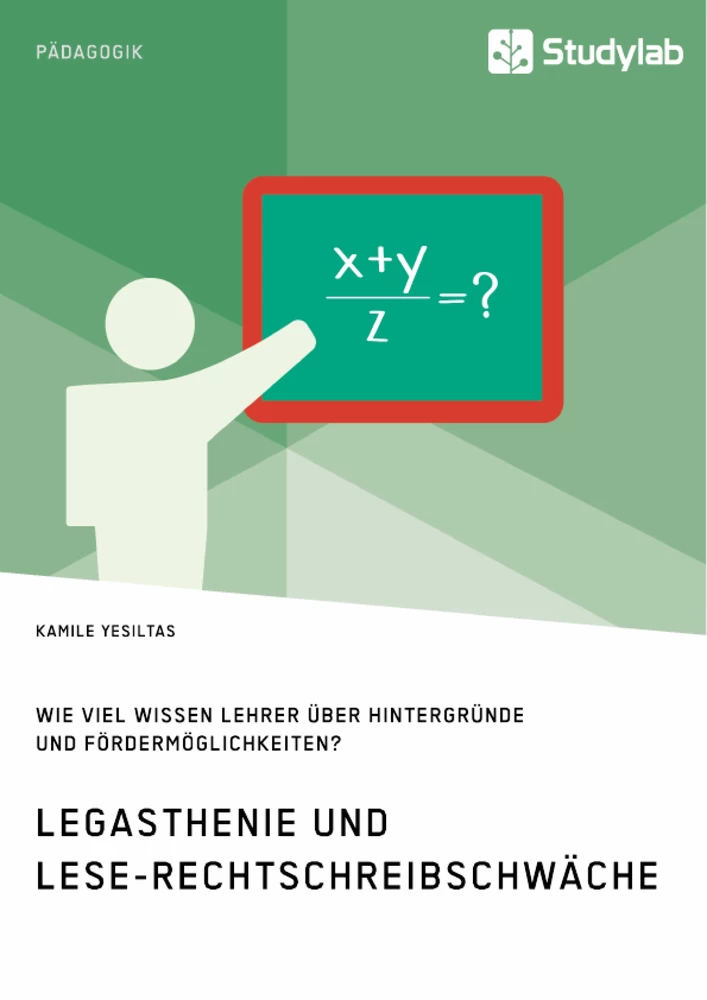Lesen und Schreiben spielen in unserem Leben eine wichtige Rolle. Ob nun beim Einkaufen, im Straßenverkehr oder in der Kommunikation: das geschriebene Wort ist kaum aus unserem Alltag wegzudenken. Doch es gibt Menschen, die erhebliche Probleme beim Lese- und Rechtschreiberwerb haben. Legasthenie erschwert so die Teilhabe an der Gesellschaft und bestimmt die berufliche Zukunft eines Menschen.
Doch wie viel wissen Lehrerinnen und Lehrer weiterführender Schulen über Legasthenie? Welche Möglichkeiten der Förderung gibt? Lassen sich Fördermaßnahmen auch in den Regelunterricht integrieren? Kamile Yesiltas sammelt in ihrer Publikation alles Wissenswerte über Legasthenie und ermittelt, wo bei vielen Lehrkräften noch Aufklärungsbedarf herrscht.
Wie unterscheidet sich Legasthenie von einer Lese-Rechtschreibschwäche? Wann und wie kann man eine Legasthenie diagnostizieren? Yesiltas erklärt die Phasen des Schriftspracherwerbs und geht auf die Symptome einer Legasthenie ein. Im Anschluss stellt sie Fördermöglichkeiten im Schulunterricht sowie Maßnahmen für einen Nachteilsausgleich vor.
Aus dem Inhalt:
- LRS;
- Schule;
- Förderunterricht;
- Bildung;
- Inklusion;
- Dyslexie
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Gliederung der Arbeit
- 2 Theoretische Verortung
- 2.1 Begriffsbestimmung Legasthenie
- 2.2 Abgrenzung zu Lese-Rechtschreibschwäche
- 2.3 Kriterien für die Diagnose von LRS
- 2.4 Diskrepanzkriterium
- 2.5 Entwicklung des Schriftspracherwerbs (nach Uta Frith 1986)
- 2.5.1 Logografische Phase
- 2.5.2 Alphabetische Phase
- 2.5.3 Orthografische Phase
- 2.6 Prävalenz
- 2.7 Symptome der LRS
- 2.8 Ursachen
- 2.9 Komorbiditäten und Folgeerkrankungen
- 3 Diagnose von LRS
- 3.1 Wann ist die Diagnose der LRS möglich?
- 3.2 Wer diagnostiziert LRS?
- 3.3 Wie wird diagnostiziert?
- 4 Fördermöglichkeiten
- 4.1 Schulische Förderung
- 4.2 Förderung im Regelunterricht
- 4.3 Probleme im Regelunterricht
- 4.4 Außerschulische Förderung
- 4.5 Exkurs
- 5 Ziel des Kapitels
- 6 Datenerhebung
- 6.1 Methodisches Vorgehen
- 6.2 Der Fragebogen
- 6.3 Vorgehensweise der Befragung
- 6.4 Beschreibung der Auswertungsmethode
- 7 Ergebnisse der Untersuchung
- 7.1 Demografische Daten der befragten Personen
- 7.2 Erfahrungen der Lehrkräfte mit Legasthenie
- 7.3 Ergebnisse zum inhaltlichen Teil des Fragebogens
- 8 Interpretation der Ergebnisse
- 9 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Wissen von Lehrkräften weiterführender Schulen über Legasthenie/LRS. Ziel ist die Erhebung und Analyse des Wissensstands sowie der Einstellungen der Lehrkräfte zu verschiedenen Aspekten von Legasthenie. Die Ergebnisse sollen Aufschluss darüber geben, ob ein grundlegendes Verständnis vorhanden ist und welche Wissenslücken bestehen.
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung von Legasthenie und Lese-Rechtschreibschwäche
- Diagnosemethoden und Kriterien für die Feststellung von LRS
- Ursachen und Komorbiditäten von Legasthenie
- Fördermöglichkeiten im schulischen und außerschulischen Kontext
- Wissen und Einstellungen von Lehrkräften zu Legasthenie
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Motivation der Autorin, sich mit dem Thema Legasthenie auseinanderzusetzen, ausgehend von einer persönlichen Begegnung. Sie begründet die Relevanz des Themas und skizziert die Ziele ihrer empirischen Untersuchung mittels Fragebogen, die das Wissen von Lehrkräften weiterführender Schulen zu Legasthenie/LRS ergründen soll. Die Gliederung der Arbeit wird detailliert dargestellt.
2 Theoretische Verortung: Dieses Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu Legasthenie/LRS. Es werden verschiedene Begriffsbestimmungen diskutiert und die Abgrenzung zur Lese-Rechtschreibschwäche erläutert. Die diagnostischen Kriterien, das Diskrepanzkriterium, die Entwicklung des Schriftspracherwerbs nach Uta Frith (mit den Phasen Logografie, Alphabetische Phase und Orthografie), die Prävalenz, Symptome, Ursachen und Komorbiditäten von LRS werden detailliert dargestellt und anhand von wissenschaftlichen Quellen belegt.
3 Diagnose von LRS: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Diagnose von LRS. Es beleuchtet Fragen nach dem Zeitpunkt der möglichen Diagnose, wer befugt ist, eine Diagnose zu stellen (z.B. Schulpsychologen, Therapeuten), und welche diagnostischen Verfahren eingesetzt werden (z.B. standardisierte Tests). Das Kapitel diskutiert die Herausforderungen und Unsicherheiten in der Praxis der Diagnose.
4 Fördermöglichkeiten: Das Kapitel beschreibt verschiedene Fördermöglichkeiten für Kinder mit LRS, sowohl im schulischen als auch im außerschulischen Bereich. Es werden konkrete Förderprogramme vorgestellt und die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus hervorgehoben. Der Nachteilsausgleich im schulischen Kontext wird als wichtiger Aspekt der individuellen Förderung diskutiert.
6 Datenerhebung: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Es wird das methodische Vorgehen der schriftlichen Befragung erläutert, der Aufbau des Fragebogens detailliert dargestellt und die Vorgehensweise der Datenerhebung und -auswertung beschrieben, inklusive der verwendeten Software (SYSTAT).
7 Ergebnisse der Untersuchung: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es werden demografische Daten der teilnehmenden Lehrkräfte (Alter, Geschlecht, Schulform, Fach) sowie die Ergebnisse zu den Fragen nach den Erfahrungen mit Legasthenie, dem Wissen über Definitionen, Symptome, Ursachen und Fördermöglichkeiten vorgestellt und durch Tabellen und Abbildungen visualisiert.
Schlüsselwörter
Legasthenie, LRS, Lese-Rechtschreibschwäche, Diagnose, Fördermöglichkeiten, Schulische Förderung, Außerschulische Förderung, Nachteilsausgleich, phonologische Bewusstheit, neurophysiologische Faktoren, Komorbiditäten, empirische Untersuchung, Lehrkräfte, weiterführende Schulen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Wissen von Lehrkräften über Legasthenie/LRS
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Wissen von Lehrkräften weiterführender Schulen über Legasthenie/LRS. Sie erhebt und analysiert den Wissensstand und die Einstellungen der Lehrkräfte zu verschiedenen Aspekten von Legasthenie.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Ziel ist es, Aufschluss darüber zu geben, ob ein grundlegendes Verständnis von Legasthenie/LRS bei Lehrkräften vorhanden ist und welche Wissenslücken bestehen. Die Arbeit soll den Wissensstand bezüglich Begriffsbestimmung, Diagnosemethoden, Ursachen, Fördermöglichkeiten und Komorbiditäten beleuchten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Begriffsbestimmung und Abgrenzung von Legasthenie und Lese-Rechtschreibschwäche, Diagnosemethoden und Kriterien für die Feststellung von LRS, Ursachen und Komorbiditäten von Legasthenie, Fördermöglichkeiten im schulischen und außerschulischen Kontext, sowie das Wissen und die Einstellungen von Lehrkräften zu Legasthenie.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in verschiedene Kapitel: Einleitung, Theoretische Verortung (mit Begriffsbestimmung, Abgrenzung, Diagnostik, Entwicklung des Schriftspracherwerbs nach Frith, Prävalenz, Symptome, Ursachen und Komorbiditäten), Diagnose von LRS, Fördermöglichkeiten, Datenerhebung (Methoden, Fragebogen, Auswertung), Ergebnisse der Untersuchung (demografische Daten, Lehrererfahrungen, Ergebnisse zum Fragebogen), Interpretation der Ergebnisse und Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick.
Welche Methoden wurden zur Datenerhebung eingesetzt?
Die Datenerhebung erfolgte mittels eines schriftlichen Fragebogens. Das Kapitel "Datenerhebung" beschreibt detailliert das methodische Vorgehen, den Aufbau des Fragebogens und die Auswertungsmethode (inkl. verwendeter Software: SYSTAT).
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der Untersuchung werden im Kapitel "Ergebnisse der Untersuchung" präsentiert. Sie beinhalten demografische Daten der teilnehmenden Lehrkräfte sowie die Ergebnisse zu deren Erfahrungen mit Legasthenie und ihrem Wissen über Definitionen, Symptome, Ursachen und Fördermöglichkeiten. Die Ergebnisse werden tabellarisch und grafisch aufbereitet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Legasthenie, LRS, Lese-Rechtschreibschwäche, Diagnose, Fördermöglichkeiten, Schulische Förderung, Außerschulische Förderung, Nachteilsausgleich, phonologische Bewusstheit, neurophysiologische Faktoren, Komorbiditäten, empirische Untersuchung, Lehrkräfte, weiterführende Schulen.
Wie wird Legasthenie/LRS in der Arbeit definiert und von anderen Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten abgegrenzt?
Die Arbeit bietet eine umfassende Begriffsbestimmung von Legasthenie/LRS und erläutert die Abgrenzung zur Lese-Rechtschreibschwäche. Verschiedene Definitionen werden diskutiert und anhand wissenschaftlicher Quellen belegt.
Welche Fördermöglichkeiten für Kinder mit LRS werden in der Arbeit beschrieben?
Die Arbeit beschreibt schulische und außerschulische Fördermöglichkeiten für Kinder mit LRS. Sie stellt konkrete Förderprogramme vor und betont die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus. Der Nachteilsausgleich im schulischen Kontext wird als wichtiger Aspekt der individuellen Förderung diskutiert.
- Quote paper
- Kamile Yesiltas (Author), 2019, Legasthenie und Lese-Rechtschreibschwäche. Wie viel wissen Lehrer über Hintergründe und Fördermöglichkeiten?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/490967