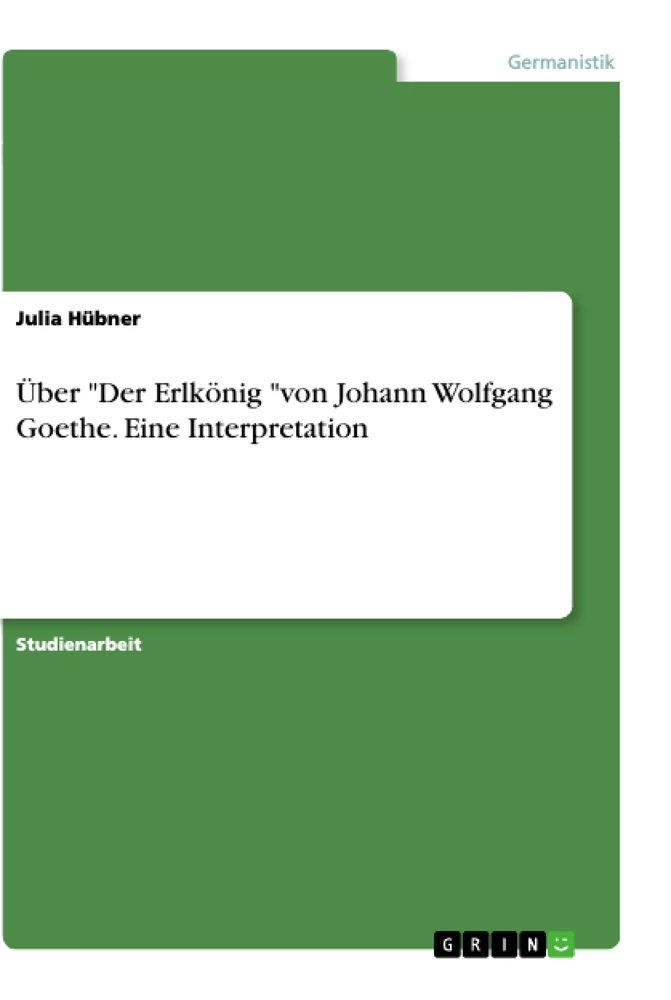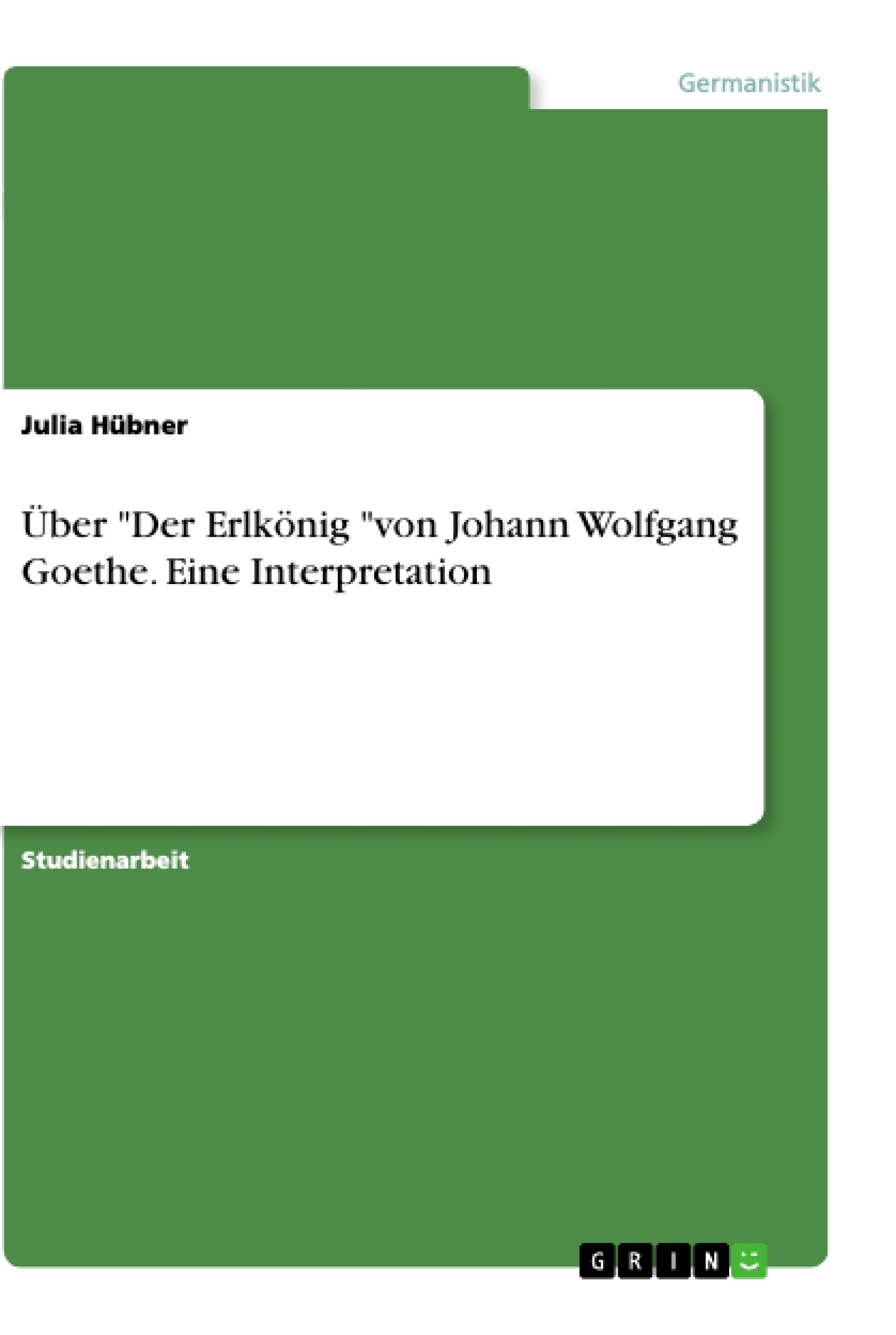Diese Arbeit untersucht die Ballade "Der Erlkönig" von Johann Wolfgang von Goethe (1782). Die Ballade beschreibt den nächtlichen Ritt eines Vaters mit seinem kranken Sohn. Das Kind glaubt den Erlkönig zu sehen der ihn mitnehmen will. Der Junge ist sehr verängstigt. Der Vater seinerseits versucht ihn immer wieder zu beruhigen. Er reitet so schnell er kann um den heimischen Hof zu erreichen. Das Kind stirbt jedoch vorher.
Johann Wolfgang von Goethe schrieb seine Ballade „der Erlkönig“ für die Komödie „Die Fischerin“, ein Singspiel. In diesem Stück sang die Hauptfigur die Ballade während der Ausübung ihrer Arbeit. Als Inspiration diente Goethe eine Begebenheit von der er während seines Aufenthalts in Jena Kenntnis erlangte. Ein wohlhabender Landwirt brachte sein einziges und erkranktes Kind zu einem berühmten Mediziner nach Jena. Nachdem dieser dem Kind nicht helfen konnte machte sich der Vater wieder auf den Rückweg. Das Kind starb während dieser Reise. Ein weiterer Ideengeber war Johann Gottfried Herder. Er übertrug die dänische Volksballade „Erlkönigs Töchter“ ins Deutsche. Dabei machte er den Fehler, das dänische Wort „ellerkonge“ mit „Erlkönig“ statt mit „Elfenkönig“ zu übersetzen. Bei der Konzeption seiner Ballade folgte Goethe diesem Übersetzungsfehler.
Inhaltsverzeichnis
- Zum Inhalt
- Zur Entstehungsgeschichte
- Zur Ballade
- Die Form
- Die Sprache
- Der Spannungsaufbau
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Goethes Ballade "Erlkönig" im Hinblick auf ihre Struktur, Sprache und den Spannungsaufbau. Ziel ist es, die literarischen Mittel aufzuzeigen, die Goethe zur Erzeugung der atmosphärischen Dichte und der emotionalen Wirkung einsetzt.
- Analyse der sprachlichen Mittel (Alliterationen, Anaphern, Wiederholungen)
- Untersuchung des Spannungsaufbaus über die Strophen hinweg
- Interpretation der verschiedenen Figuren und ihrer Perspektiven
- Erklärung der Entstehungsgeschichte und des Kontextes
- Analyse der formalen Aspekte (Reimschema, Rhythmus)
Zusammenfassung der Kapitel
Zum Inhalt: Die Ballade erzählt von einem nächtlichen Ritt eines Vaters mit seinem kranken Sohn. Das Kind sieht den Erlkönig und wird von ihm gelockt, während der Vater versucht, es zu beruhigen. Trotz der Bemühungen des Vaters stirbt das Kind am Ende des Ritts. Die Geschichte ist geprägt von Angst, Verzweiflung und dem Kampf zwischen Realität und Fantasie, wobei die Grenze zwischen beiden verschwimmt.
Zur Entstehungsgeschichte: Goethe schrieb "Erlkönig" für das Singspiel "Die Fischerin". Die Inspiration stammte aus einer wahren Begebenheit, die er in Jena erfuhr: der Tod eines Kindes auf einer Reise zu einem Arzt. Der Übersetzungsfehler von Herder, der das dänische Wort "ellerkonge" mit "Erlkönig" anstatt "Elfenkönig" übersetzte, beeinflusste Goethes Interpretation.
Zur Ballade: Goethe schuf mit "Erlkönig" eine naturmagische Ballade, die den Fokus auf die Liebe im Sturm und Drang erweitert. Die Natur wird als verführerisch und sogar tödlich dargestellt, wobei das Kind im Gegensatz zum rational denkenden Vater empfänglich für die magischen Kräfte der Natur ist. Die Ballade zeigt den Kontrast zwischen kindlicher Fantasie und erwachsener Vernunft.
Die Form: Die Ballade besteht aus acht Strophen mit je vier Versen und einem Paarreimschema (aabb). Der Rhythmus und die Sprechweisen der Figuren (ruhig beim Vater, unruhig beim Sohn, schmeichelnd beim Erlkönig) tragen zum Spannungsaufbau bei. Die Verwendung von Verben wie "wiegen", "tanzen", "singen" erzeugt eine Melodie, die abrupt durch den Erlkönigs Gewaltandrohung unterbrochen wird.
Die Sprache: Goethe verwendet Stilmittel wie Alliterationen ("schöne Spiele spiel", "bunte Blumen") und Anaphern ("mein Vater, mein Vater"). Die häufige Wiederholung von Wörtern wie "Vater", "Sohn", "Kind" und die direkte Anrede verstärken die emotionale Wirkung. Der Wechsel vom Präsens zum Präteritum am Ende unterstreicht den tragischen Ausgang.
Der Spannungsaufbau: Die Ballade beginnt mit einer rätselhaften Frage, die Neugier und eine düstere Stimmung erzeugt. Die Spannung steigert sich durch das Erscheinen des Erlkönigs, die Angst des Kindes und die zunehmend verzweifelten Versuche des Vaters, es zu beruhigen. Die wiederholten Lockrufe des Erlkönigs und die steigende Verzweiflung des Kindes führen zum dramatischen Höhepunkt und dem tragischen Ende.
Schlüsselwörter
Erlkönig, Ballade, Goethe, Naturmagie, Spannung, Kind, Vater, Fantasie, Realität, Tod, Sprache, Stilmittel, Alliteration, Anapher, Reimschema, Rhythmus, Präsens, Präteritum.
Häufig gestellte Fragen zu Goethes "Erlkönig"
Was ist der Inhalt von Goethes Ballade "Erlkönig"?
Die Ballade erzählt von einem nächtlichen Ritt eines Vaters mit seinem kranken Sohn. Der Sohn sieht den Erlkönig, der ihn in sein Reich lockt. Der Vater versucht, ihn zu beruhigen, doch das Kind stirbt am Ende des Ritts. Die Geschichte thematisiert den Kampf zwischen Realität und Fantasie, Angst und Verzweiflung.
Welche Zielsetzung verfolgt die Analyse von "Erlkönig"?
Die Analyse untersucht die Struktur, Sprache und den Spannungsaufbau der Ballade. Ziel ist es, die literarischen Mittel zu identifizieren, die Goethe zur Erzeugung der atmosphärischen Dichte und emotionalen Wirkung einsetzt.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Analyse behandelt?
Die Analyse konzentriert sich auf die sprachlichen Mittel (Alliterationen, Anaphern, Wiederholungen), den Spannungsaufbau, die Interpretation der Figuren und ihrer Perspektiven, die Entstehungsgeschichte und den Kontext, sowie die formalen Aspekte (Reimschema, Rhythmus).
Wie ist die Ballade formal aufgebaut?
Der "Erlkönig" besteht aus acht Strophen mit je vier Versen und einem Paarreimschema (aabb). Der Rhythmus und die unterschiedlichen Sprechweisen der Figuren tragen zum Spannungsaufbau bei. Die Verwendung bestimmter Verben erzeugt eine Melodie, die durch den Erlkönig abrupt unterbrochen wird.
Welche sprachlichen Mittel verwendet Goethe im "Erlkönig"?
Goethe verwendet Alliterationen, Anaphern und Wiederholungen wichtiger Wörter wie "Vater", "Sohn" und "Kind". Die direkte Anrede und der Wechsel zwischen Präsens und Präteritum am Ende verstärken die emotionale Wirkung.
Wie baut Goethe die Spannung in der Ballade auf?
Die Spannung wird durch eine rätselhafte Anfangssituation, das Erscheinen des Erlkönigs, die Angst des Kindes und die verzweifelten Versuche des Vaters aufgebaut. Die wiederholten Lockrufe des Erlkönigs und die steigende Verzweiflung des Kindes führen zum dramatischen Höhepunkt und dem tragischen Ende.
Welche Rolle spielt die Entstehungsgeschichte des "Erlkönigs"?
Goethe schrieb den "Erlkönig" für das Singspiel "Die Fischerin". Die Inspiration stammte von einer wahren Begebenheit, dem Tod eines Kindes. Der Übersetzungsfehler von Herder, der "ellerkonge" mit "Erlkönig" übersetzte, beeinflusste Goethes Interpretation.
Was ist die Bedeutung des Erlkönigs?
Der Erlkönig verkörpert die verführerische und tödliche Natur, im Gegensatz zur rationalen Welt des Vaters. Das Kind ist empfänglich für die magischen Kräfte der Natur, während der Vater diese nicht wahrnimmt. Die Ballade zeigt den Kontrast zwischen kindlicher Fantasie und erwachsener Vernunft.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den "Erlkönig"?
Schlüsselwörter sind: Erlkönig, Ballade, Goethe, Naturmagie, Spannung, Kind, Vater, Fantasie, Realität, Tod, Sprache, Stilmittel, Alliteration, Anapher, Reimschema, Rhythmus, Präsens, Präteritum.
- Quote paper
- Julia Hübner (Author), 2017, Über "Der Erlkönig "von Johann Wolfgang Goethe. Eine Interpretation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/490844