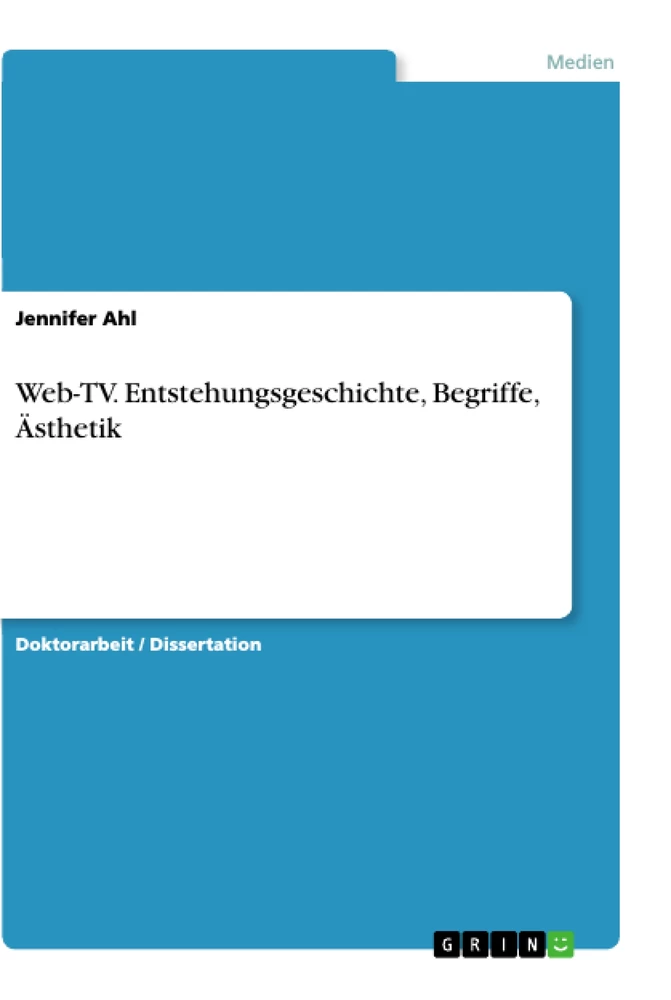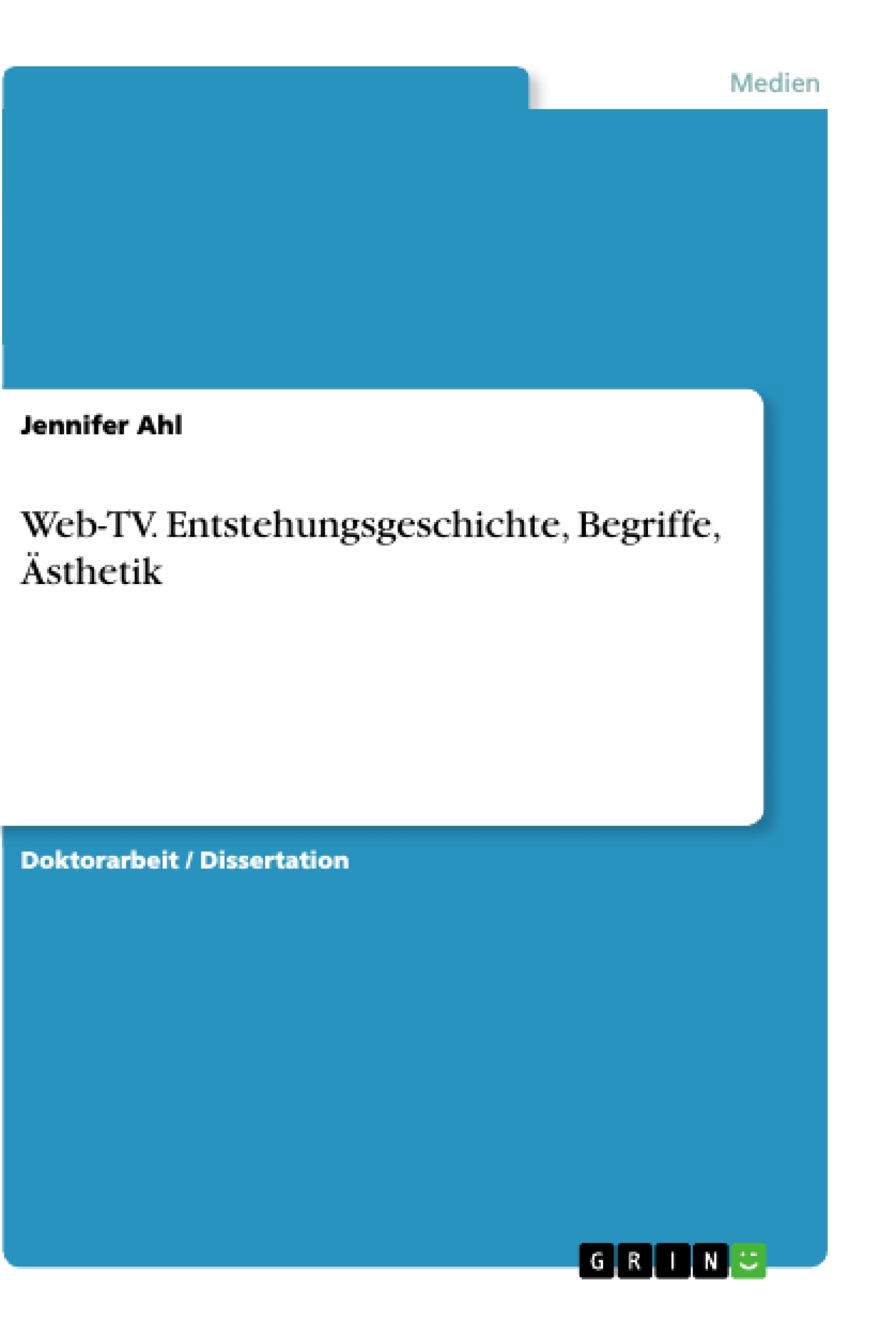Web-TV ist ein Zwitter: Es besitzt Eigenschaften von Web-Videos und von traditionellen Fernsehsendungen. Die Dissertation klärt, wie dieser Doppelcharakter des Web-TV entsteht, was er beinhaltet und was das ästhetisch bedeutet. In einem ersten Schritt wird bestimmt, welches die wesentlichen Eigenschaften des traditionellen Fernsehens sind. In einem zweiten Schritt werden diese Eigenschaften als notwendige Kriterien auf Bewegtbildinhalte im World Wide Web angewendet. Der Schlüsselgedanke dabei ist, dass sich das Konzept Fernsehen erweitern lässt, dass das traditionelle Fernsehen nur noch eine Realisierungsmöglichkeit von Fernsehen ist und es daneben weitere Formen geben kann, wie eben das Web-TV. Es geht um die Charakteristika Serialität, Massenmedialität und Welthaltigkeit. Gemeinsam zeichnen sie ein Bewegtbild als fernsehartig aus.
Serialität im Fernsehen entsteht aufgrund des andauernden Programmflusses. Bei der Massenmedialität geht es um eine Abgrenzung zu individuell und interaktiv genutzten Artefakten. Fernsehartige Bewegtbilder sind öffentlich zugänglich, werden räumlich und/oder zeitlich distanziert übermittelt und richten sich an ein disperses Publikum. Das dritte Kriterium ist die Welthaltigkeit. Ein Artefakt gilt als welthaltig, wenn es einen Gehalt von Welt erkennen lässt, der dem einzelnen Zuschauer einen Anschluss an die Gesellschaft ermöglicht. Dieser Anschluss ist gegeben, wenn eine intersubjektive Interpretation möglich ist, im Bewegtbild angelegt ist. Wenn diese drei Fernsehkriterien von Web-Videos erfüllt werden, handelt es sich jedoch noch nicht um Web-TV. Denn Web-TV verlangt nach etwas Neuem, soll es ein eigenständiger, abgrenzbarer Bereich sein, also mehr als nur der Import von traditionellen Fernsehinhalten. Dieses Neue lässt sich als Webartigkeit bezeichnen.
Das Ergebnis ist eine Typologie der Web-Videos mit drei Hauptkategorien: Nutzergenerierte Videos, Web-Sendungen und Importe von traditionellen Fernsehsendern. Beispeilhaft erfolgt die Bestimmung des Web-TV anhand der drei Web-TV-Sendungen: EHRENSENF (D), REBELL.TV (CH) und BUSCHKA ENTDECKT DEUTSCHLAND (D). Die Schlussbetrachtung der Arbeit orientiert sich an den anfangs aufgestellten Thesen. Es zeigt sich, dass das Web-TV eine neue Fernsehform ist, die das Konzept des Fernsehens verändert. Web-TV besitzt das Potenzial, unsere Vorstellung von Fernsehen zu verändern. Web-TV ist ein Indikator und wissenschaftlicher Impulsgeber für das traditionelle Fernsehen.
Inhaltsverzeichnis
- ,,Fernsehen war gestern?\" - Einführung
- Eingrenzung des Themas
- Vorgehen und Zielsetzung
- Die ästhetische Perspektive
- Struktur der Arbeit und Darstellung der Thesen
- ,,How will we know, television' when we see it?\" - Kriterien zur Bestimmung von Fernsehartigkeit im World Wide Web
- Mediale Struktur
- Programmfluss versus Hypertext
- Serialität als Strukturprinzip
- Mediale Kommunikation
- Massenmedialität
- Welthaltigkeit
- ,,Online is the New Primetime?\" - Audiovisuelle Gattungen im World Wide Web
- Typologie der Web-Videos
- Webcam-Aufnahmen
- Private-Cams
- Videoblogs
- Traditionelle Fernsehsender im World Wide Web
- Web-TV-Sender
- Webisodes
- Videosendungen
- Bestimmung des Web-TV
- Übersicht der Web-Video-Gattungen
- Der Web-TV-Wert
- ,,TV you won't see on TV.\" – Ästhetik der Videosendung
- Ehrensenf
- Formatierung
- Strategien der Komikgenerierung
- Zwischen Boulevardisierung und politischer Schärfe
- Orientierung im World Wide Web
- Fazit
- rebell.tv
- Struktur der Website
- Formatierung
- Interview als Darstellungsform
- Die Rollen des Interviewers
- Fazit
- Buschka entdeckt Deutschland
- Struktur der Website
- Formatierung
- Stand-up-Reportage
- Authentizierende Form
- Funktionen des Reporters
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation von Jennifer Ahl befasst sich mit dem Phänomen „Web-TV“ und untersucht dessen Entstehung, Begrifflichkeiten und ästhetische Besonderheiten. Die Arbeit analysiert die vielfältigen Formen des Fernsehens im World Wide Web, um die Kriterien zur Bestimmung von Fernsehartigkeit im digitalen Raum zu definieren.
- Etablierung von Kriterien für die Definition von „Fernsehartigkeit“ im World Wide Web
- Analyse der verschiedenen Web-Video-Gattungen und deren spezifischen Eigenschaften
- Untersuchung der ästhetischen Besonderheiten von Web-Videosendungen
- Vergleich von Web-TV und traditionellem Fernsehen hinsichtlich ihrer spezifischen Charakteristika
- Bewertung des Einflusses des World Wide Web auf die Entwicklung des Fernsehens
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einführung stellt die Relevanz des Themas „Web-TV“ heraus, beschreibt die Problematik der uneindeutigen Begriffsdefinition und verdeutlicht die Notwendigkeit einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Phänomen.
- Kapitel 2: In diesem Kapitel werden Kriterien zur Unterscheidung zwischen „Fernsehartigkeit“ im World Wide Web und anderen Formen der Online-Kommunikation erarbeitet. Die Analyse umfasst Aspekte der medialen Struktur wie Programmfluss, Serialität und Hypertext, sowie die mediale Kommunikation in Bezug auf Massenmedialität und Welthaltigkeit.
- Kapitel 3: Die Arbeit widmet sich der Typologie von Web-Videos und stellt die verschiedenen Gattungen wie Webcam-Aufnahmen, Private-Cams, Videoblogs, traditionelle Fernsehsender im World Wide Web, Web-TV-Sender, Webisodes und Videosendungen vor.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel untersucht die ästhetischen Besonderheiten von Videosendungen am Beispiel dreier ausgewählter Web-TV-Formate: Ehrensenf, rebell.tv und Buschka entdeckt Deutschland. Die Analyse beleuchtet Formatierung, Strategien der Komikgenerierung, Authentizität und die Rolle des Reporters bzw. Interviewers.
Schlüsselwörter
Web-TV, Online-Fernsehen, Fernsehen im Internet, World Wide Web, Medienwandel, Medientheorie, Ästhetik, Videosendungen, Gattungen, Genres, Programmfluss, Serialität, Hypertext, Massenmedialität, Welthaltigkeit, Videoblogs, Webcam-Aufnahmen, Private-Cams, Traditionelle Fernsehsender, Web-TV-Sender, Webisodes, Interview, Reportage, Stand-up-Comedy, Authentizität.
- Quote paper
- Jennifer Ahl (Author), 2013, Web-TV. Entstehungsgeschichte, Begriffe, Ästhetik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/490075