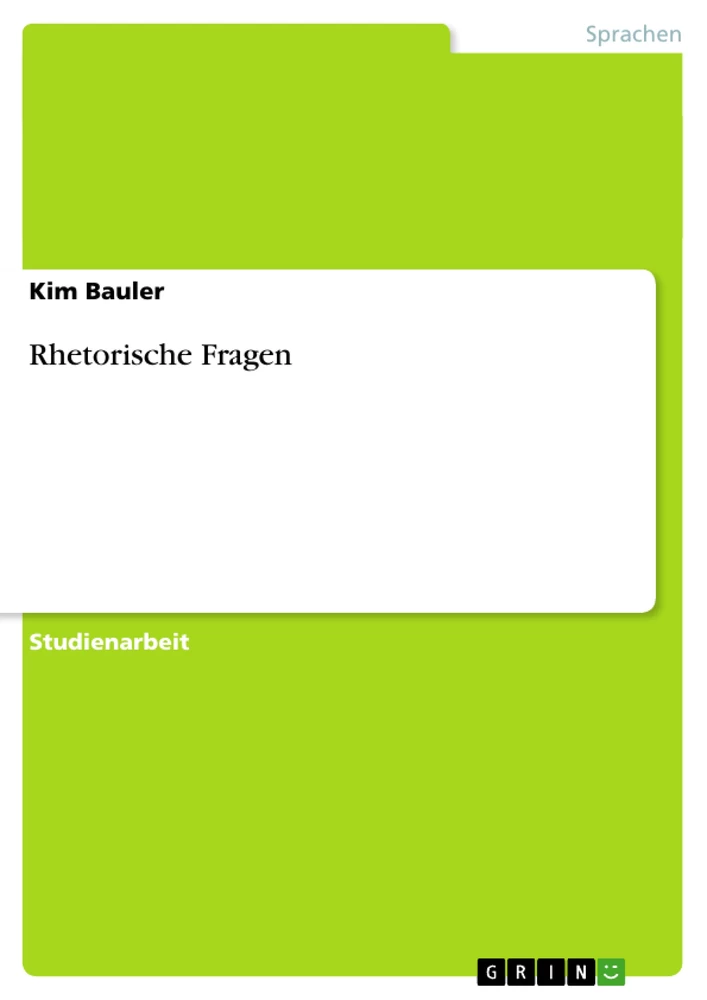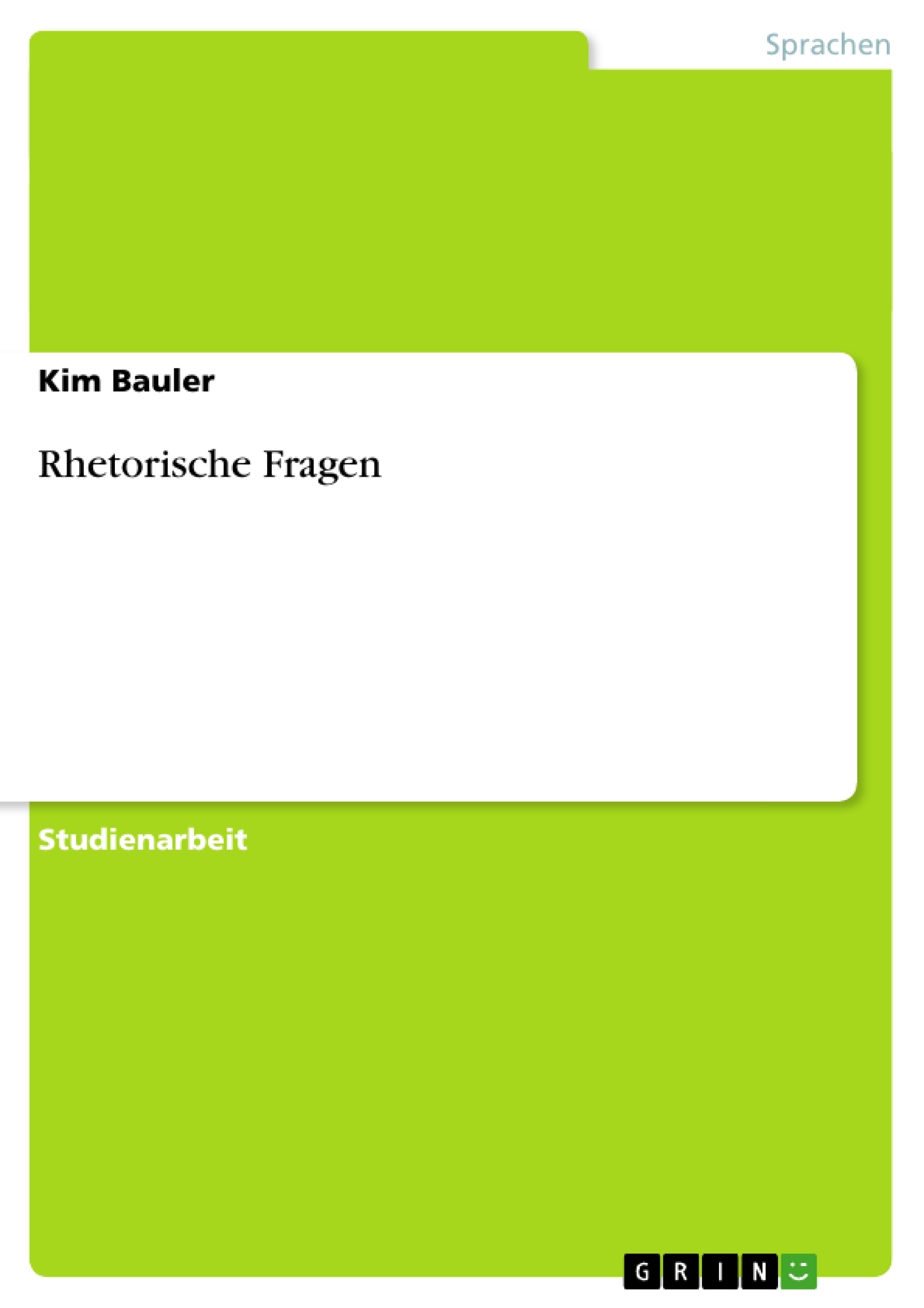Ce travail traite les questions rhétoriques, leurs indices et leur emploi.
Après la première partie, qui est constituée d’une introduction et de quelques aspects généraux sur les questions rhétoriques, les études et les travaux de différents linguistes qui ont analysé la thématique sont présentés dans la deuxième partie.
Le premier de ces linguistes est Jürgen Schmidt-Radefeld, qui a rédigé un article en anglais en 1977 sur les questions rhétoriques en anglais, français, allemand et portugais.
La même année, Baku Sarchan Abdullaev a abordé le sujet, mais il s’est limité sur l’allemand.
En 1981, une linguiste portant le nom de Andrée Borillo a publié une vaste étude des questions rhétoriques en français.
En 1986 alors, l’Allemand Jörg Meibauer a écrit une dissertation sur les questions rhétoriques en général et plus tard il en a fait un livre. Il se sert entre autres des travaux des linguistes mentionnés ci-dessus.
La dernière partie est une présentation de quelques exemples de l’emploi des questions rhétoriques dans des discours politiques, dans les journaux et dans la littérature.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Allgemeines
- 2. Die rhetorische Frage als Untersuchungsgegenstand
- 2.1. Schmidt-Radefeld
- 2.2. Abdullaev
- 2.3. Borillo
- 2.4. Meibauer
- 3. Beispiele
- 3.1. Reden und Vorträge
- 3.2. Zeitungsartikel
- 3.3. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht rhetorische Fragen, ihre Kennzeichen und ihren Gebrauch in verschiedenen Kontexten. Das Hauptziel ist es, ein umfassendes Verständnis der rhetorischen Frage zu entwickeln, indem verschiedene linguistische Ansätze und zahlreiche Beispiele analysiert werden.
- Definition und Charakteristika rhetorischer Fragen
- Untersuchung verschiedener linguistischer Perspektiven auf rhetorische Fragen
- Analyse des Gebrauchs rhetorischer Fragen in verschiedenen Textsorten
- Die Funktion rhetorischer Fragen in der Kommunikation
- Der Vergleich der rhetorischen Frage im Deutschen und Französischen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Allgemeines: Dieses Kapitel liefert eine Einführung in das Thema der rhetorischen Frage und beleuchtet die Unterschiede in der Bezeichnung und Wahrnehmung dieser Frageform im Deutschen und Französischen. Es wird der grundlegende Charakter der rhetorischen Frage als eine Frageform ohne erwartete Antwort herausgestellt, die implizite Aussagen verstärkt oder unausgesprochene Verneinungen erzeugt. Die antike Verwendung und die modernen Funktionen, wie Provokation, Aufmerksamkeitserzeugung und argumentative Persuasion werden angesprochen. Eine Definition von Paul wird vorgestellt, welche die zentrale Zielsetzung (keine Antwort, sondern Anerkennung einer Tatsache) hervorhebt. Die Ambivalenz der rhetorischen Frage wird bereits hier angedeutet, da sie einerseits als Frageform erscheint, andererseits aber eine Aussagefunktion hat.
2. Die rhetorische Frage als Untersuchungsgegenstand: Dieses Kapitel präsentiert eine umfassende Literaturübersicht, die verschiedene linguistische Perspektiven auf rhetorische Fragen beleuchtet. Es werden die Arbeiten von Schmidt-Radefeld (fokussiert auf Englisch, Französisch, Deutsch und Portugiesisch), Abdullaev (fokussiert auf Deutsch), Borillo (fokussiert auf Französisch) und Meibauer (mit breiterem Fokus und Einbezug der vorherigen Arbeiten) diskutiert. Jede dieser Studien bietet einen einzigartigen Beitrag zum Verständnis der rhetorischen Frage, wobei Unterschiede in der Methodik und den Ergebnissen deutlich werden. Die Zusammenfassung der einzelnen Studien dient dazu, den vielschichtigen Forschungsstand zum Thema darzulegen und den Rahmen für die eigene Analyse zu setzen.
3. Beispiele: Dieses Kapitel präsentiert konkrete Beispiele für den Gebrauch rhetorischer Fragen in verschiedenen Kontexten: Reden und Vorträgen, Zeitungsartikeln und literarischen Texten. Die Beispiele dienen dazu, die theoretischen Überlegungen der vorherigen Kapitel zu illustrieren und die Vielseitigkeit des Einsatzes rhetorischer Fragen zu verdeutlichen. Die Auswahl der Beispiele ermöglicht eine differenzierte Betrachtung der Funktion rhetorischer Fragen in Abhängigkeit vom jeweiligen Kontext und der kommunikativen Absicht des Sprechers/Schreibers. Durch die Analyse der Beispiele wird die praktische Anwendung der theoretischen Konzepte veranschaulicht.
Schlüsselwörter
Rhetorische Frage, Frageform, Illokution, Aussage, Negation, Persuasion, Kommunikation, Linguistik, Deutsch, Französisch, Schmidt-Radefeld, Abdullaev, Borillo, Meibauer.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit über Rhetorische Fragen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht rhetorische Fragen, ihre Merkmale und ihren Gebrauch in verschiedenen Kontexten. Sie analysiert verschiedene linguistische Ansätze und zahlreiche Beispiele, um ein umfassendes Verständnis der rhetorischen Frage zu entwickeln.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Charakteristika rhetorischer Fragen, verschiedene linguistische Perspektiven darauf, den Gebrauch in verschiedenen Textsorten (Reden, Zeitungsartikel, Literatur), die Funktion in der Kommunikation und einen Vergleich im Deutschen und Französischen.
Welche linguistischen Ansätze werden berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht sich auf die Arbeiten von Schmidt-Radefeld, Abdullaev, Borillo und Meibauer. Jede dieser Studien bietet einen einzigartigen Beitrag zum Verständnis der rhetorischen Frage, mit Unterschieden in Methodik und Ergebnissen. Die Arbeit vergleicht diese Ansätze und setzt sie in Beziehung zueinander.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptkapitel: „Allgemeines“, welches eine Einführung und grundlegende Definitionen bietet; „Die rhetorische Frage als Untersuchungsgegenstand“, welches verschiedene linguistische Perspektiven vorstellt; und „Beispiele“, welches den praktischen Gebrauch in verschiedenen Textsorten anhand konkreter Beispiele illustriert.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist es, ein umfassendes Verständnis der rhetorischen Frage zu entwickeln, indem verschiedene linguistische Ansätze und zahlreiche Beispiele analysiert werden. Die Arbeit zielt darauf ab, die Vielseitigkeit und Funktion rhetorischer Fragen in der Kommunikation zu verdeutlichen.
Welche Beispiele werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Beispiele aus Reden und Vorträgen, Zeitungsartikeln und literarischen Texten. Die Auswahl der Beispiele soll die Vielseitigkeit des Einsatzes rhetorischer Fragen und deren Funktion in Abhängigkeit vom Kontext und der kommunikativen Absicht verdeutlichen.
Welche Sprachen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht den Gebrauch rhetorischer Fragen im Deutschen und Französischen, wobei die Unterschiede in der Bezeichnung und Wahrnehmung dieser Frageform beleuchtet werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rhetorische Frage, Frageform, Illokution, Aussage, Negation, Persuasion, Kommunikation, Linguistik, Deutsch, Französisch, Schmidt-Radefeld, Abdullaev, Borillo, Meibauer.
Welche Ambivalenz wird in Bezug auf die rhetorische Frage hervorgehoben?
Die Arbeit hebt die Ambivalenz der rhetorischen Frage hervor: Sie erscheint als Frageform, hat aber gleichzeitig eine Aussagefunktion. Sie verstärkt implizite Aussagen oder erzeugt unausgesprochene Verneinungen.
Wie wird die Funktion der rhetorischen Frage beschrieben?
Die Funktion rhetorischer Fragen wird als vielseitig beschrieben, inklusive Provokation, Aufmerksamkeitserzeugung und argumentativer Persuasion. Die Arbeit betont, dass die Funktion stark vom Kontext und der kommunikativen Absicht des Sprechers/Schreibers abhängt.
- Quote paper
- Kim Bauler (Author), 2005, Rhetorische Fragen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/48992