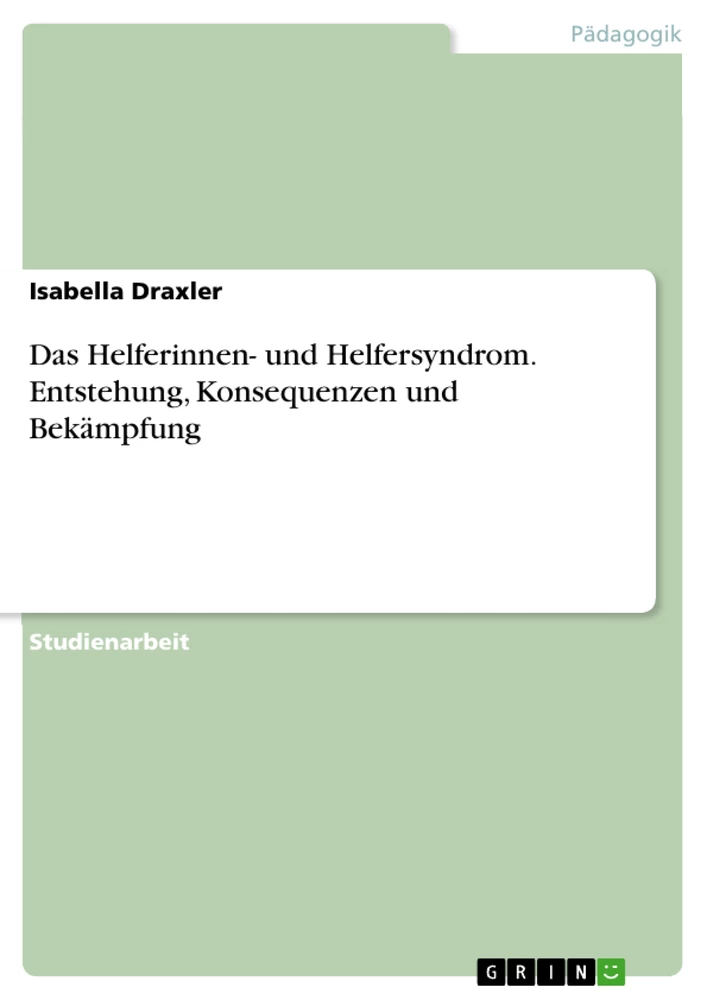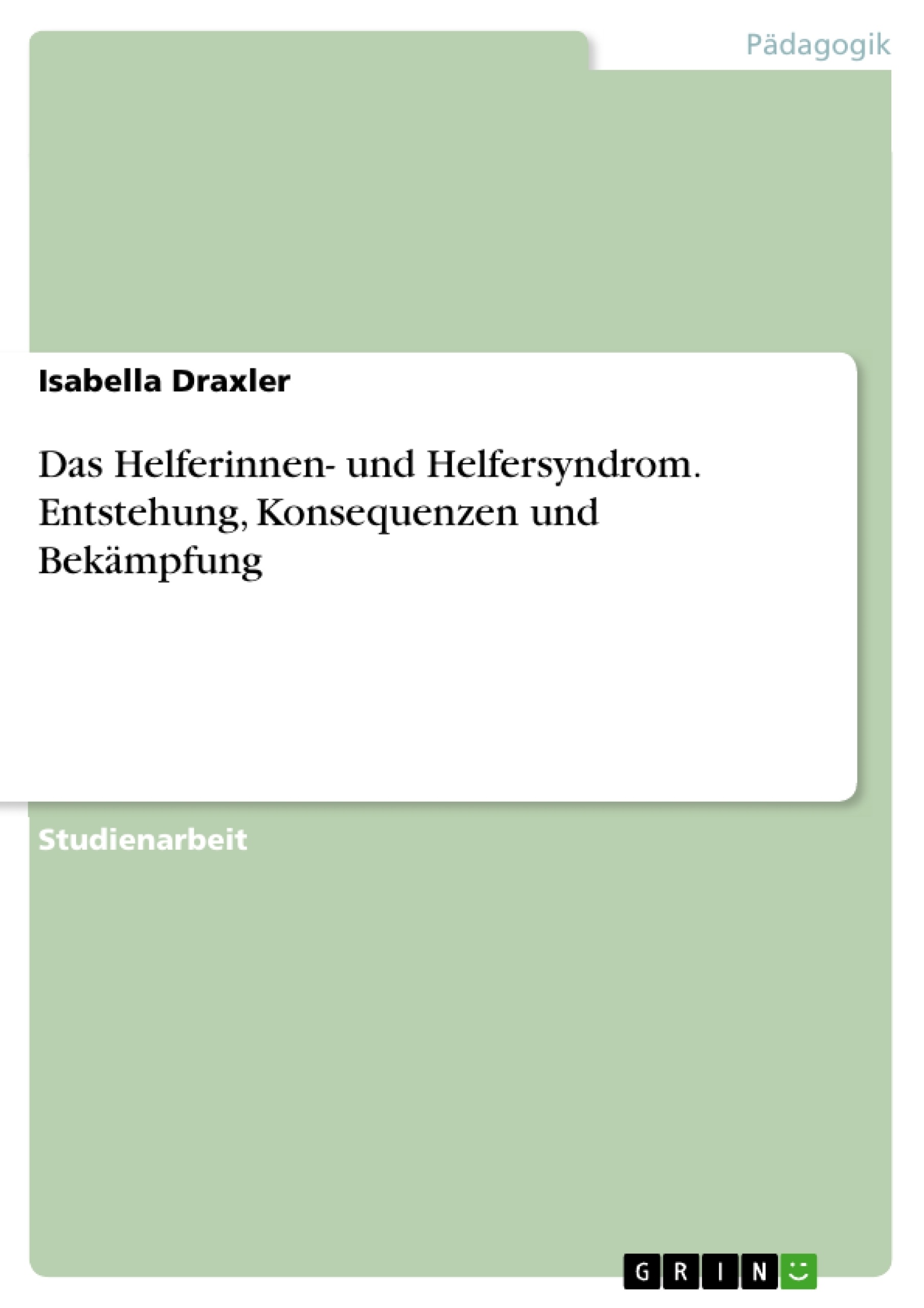Diese Arbeit beschäftigt sich mit verschiedenen Facetten des Helferinnen- und Helfersyndroms1 und dessen Ausprägungen, aber auch mit der Ätiologie der Erkrankung und der indizierten Prävention und Intervention. Obwohl ausgeführt werden wird, dass das Helferinnen- und Helfersyndrom in unterschiedlichen Berufsfeldern sowie auch im Privatleben auftreten kann, liegt der Schwerpunkt der Arbeit auf mit der Sozialpädagogik assoziierten Berufsfeldern, die im Folgenden als „soziale Berufe“ zusammengefasst werden.
Die forschungsleitenden Fragen waren demgemäß:
• Worum handelt es sich beim Helferinnen- und Helfersyndrom? Wie entsteht ein solches?
• Was für Konsequenzen hat das Helferinnen- und Helfersyndrom für alle Beteiligten?
• Was kann zur Vorbeugung des Helferinnen- und Helfersyndroms getan werden? Wie kann Betroffenen geholfen werden?
Die Informationen zur Beantwortung der Fragen entspringen der Fachliteratur, wobei Datenbanksuchen durch manuelle Suchen ergänzt wurden. Gezielt wurden auch wissenschaftliche Journals als Quellen praxisnaher und aktueller Einblicke herangezogen. Die Auswertung der Informationen erfolgte themenanalytisch- hermeneutisch, unter quellenkritischem Einbezug des jeweiligen Kontextes.
Die Basis der vorliegenden Arbeit bildet die definitorische und konzeptuelle Darstellung des vielschichtigen Phänomens des Helferinnen- und Helfersyndroms: Das nachfolgende Kapitel 2 gibt Einblick in die Definition und die zentralen Merkmale des Begriffes, grenzt diesen aber auch gegenüber verwandten Termini und Phänomenen ab. Daraufhin wird in Kapitel 3 auf die Prävalenz des Syndroms eingegangen, wobei aucherörtert wird, ob bestimmte Personengruppen häufiger betroffen sind als andere und ob Veränderungen, z.B. Zu- oder Abnahmen der Prävalenz, im weiteren Zeitverlauf denkbar sind. Kapitel 4 stellt die wechselwirkenden Ursachen und Auslöser des Helferinnen- und Helfersyndroms auf einer individuellen ebenso wie auf einer sozialen Ebene dar, woraufhin die Folgen der Krankheit für die Betroffenen, mögliche Komorbiditäten und die Konsequenzen des Syndroms für die Schützlinge in Kapitel 5 diskutiert werden. Nicht zuletzt geht Kapitel 6 darauf ein, wie gegen das Helferinnen- und Helfersyndrom vorgegangen werden kann. Obwohl zielführende Interventionsmöglichkeiten bestehen, sollte dabei vor allem Wert auf die Prävention gelegt werden. Aufbauend auf den zusammengetragenen Erkenntnissen schließt die Arbeit mit einer kurzen Konklusion in Kapitel 7.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Phänomen des „Helferinnen- und Helfersyndroms“
- 2.1. Begriffsklärung und Konzeptualisierung
- 2.2. Begriffsabgrenzung
- 3. Vorkommen des Helferinnen- und Helfersyndroms
- 4. Ursachen und Entstehung eines Helferinnen- und Helfersyndroms
- 4.1. Individuelle Prädisposition
- 4.2. Frühkindliche Entwicklung
- 4.3. Die Rolle des Umfeldes
- 5. Folgen für Betroffene und deren Schützlinge
- 5.1. Folgen für Betroffene
- 5.1.1. Erschöpfung und Burnout
- 5.1.2. Andere Komorbiditäten des Helferinnen- und Helfersyndroms
- 5.2. Folgen für Klientinnen, Klienten, Patientinnen und Patienten
- 5.1. Folgen für Betroffene
- 6. Hilfe für die pathologisch Helfenden
- 6.1. Prävention
- 6.2. Intervention
- 7. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Seminararbeit untersucht das Helferinnen- und Helfersyndrom und widmet sich verschiedenen Facetten der Erkrankung, einschließlich ihrer Entstehung, Folgen und möglichen Präventions- und Interventionsmaßnahmen. Der Fokus liegt dabei auf sozialen Berufen im Kontext der Sozialpädagogik, wobei die Arbeit die Frage nach der Prävalenz des Syndroms in verschiedenen Berufsgruppen sowie im privaten Umfeld beleuchtet.
- Definition und Konzeptualisierung des Helferinnen- und Helfersyndroms
- Ursachen und Entstehung des Syndroms auf individueller und sozialer Ebene
- Folgen des Syndroms für Betroffene, mögliche Komorbiditäten und Auswirkungen auf Schützlinge
- Präventions- und Interventionsmöglichkeiten zur Bekämpfung des Helferinnen- und Helfersyndroms
- Die Relevanz der Thematik für soziale Berufe und die Notwendigkeit einer sensibleren Betrachtungsweise von Hilfsbereitschaft und Altruismus
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet die Begriffsklärung und Konzeptualisierung des Helferinnen- und Helfersyndroms, wobei die wichtigsten Merkmale und Abgrenzungen zu verwandten Phänomenen erläutert werden. Kapitel 3 befasst sich mit dem Vorkommen des Syndroms und untersucht, ob bestimmte Personengruppen häufiger betroffen sind als andere. Kapitel 4 analysiert die Ursachen und Auslöser des Helferinnen- und Helfersyndroms auf individueller und sozialer Ebene. Kapitel 5 untersucht die Folgen des Syndroms für die Betroffenen, einschließlich Erschöpfung, Burnout und möglicher Komorbiditäten, sowie die Auswirkungen auf Klientinnen, Klienten, Patientinnen und Patienten. Kapitel 6 beleuchtet verschiedene Möglichkeiten der Intervention und Prävention, um dem Helferinnen- und Helfersyndrom entgegenzuwirken.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Helferinnen- und Helfersyndrom, einer Erkrankung, die durch einen inneren Zwang zur Hilfeleistung und ein übermäßiges Verantwortungsgefühl gekennzeichnet ist. Im Fokus stehen die Entstehung, Folgen und mögliche Interventionsmaßnahmen, insbesondere im Kontext sozialer Berufe. Themen wie Erschöpfung, Burnout, Komorbiditäten, Prävention und Intervention sowie die Rolle des Umfeldes in der Entwicklung des Syndroms werden detailliert untersucht.
- Quote paper
- Isabella Draxler (Author), 2017, Das Helferinnen- und Helfersyndrom. Entstehung, Konsequenzen und Bekämpfung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/489726