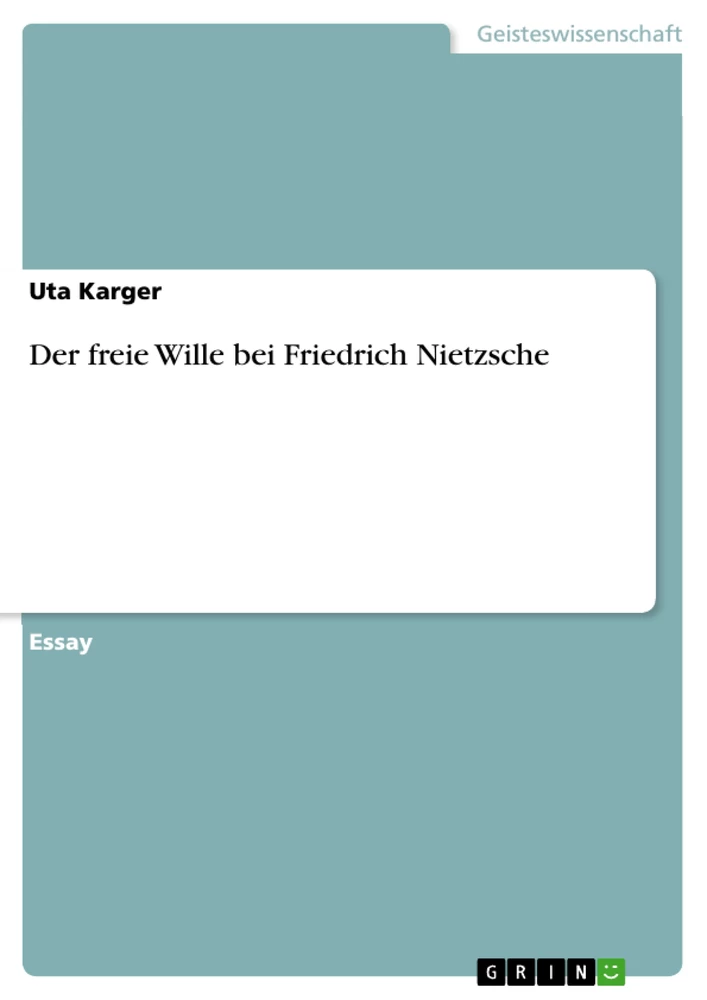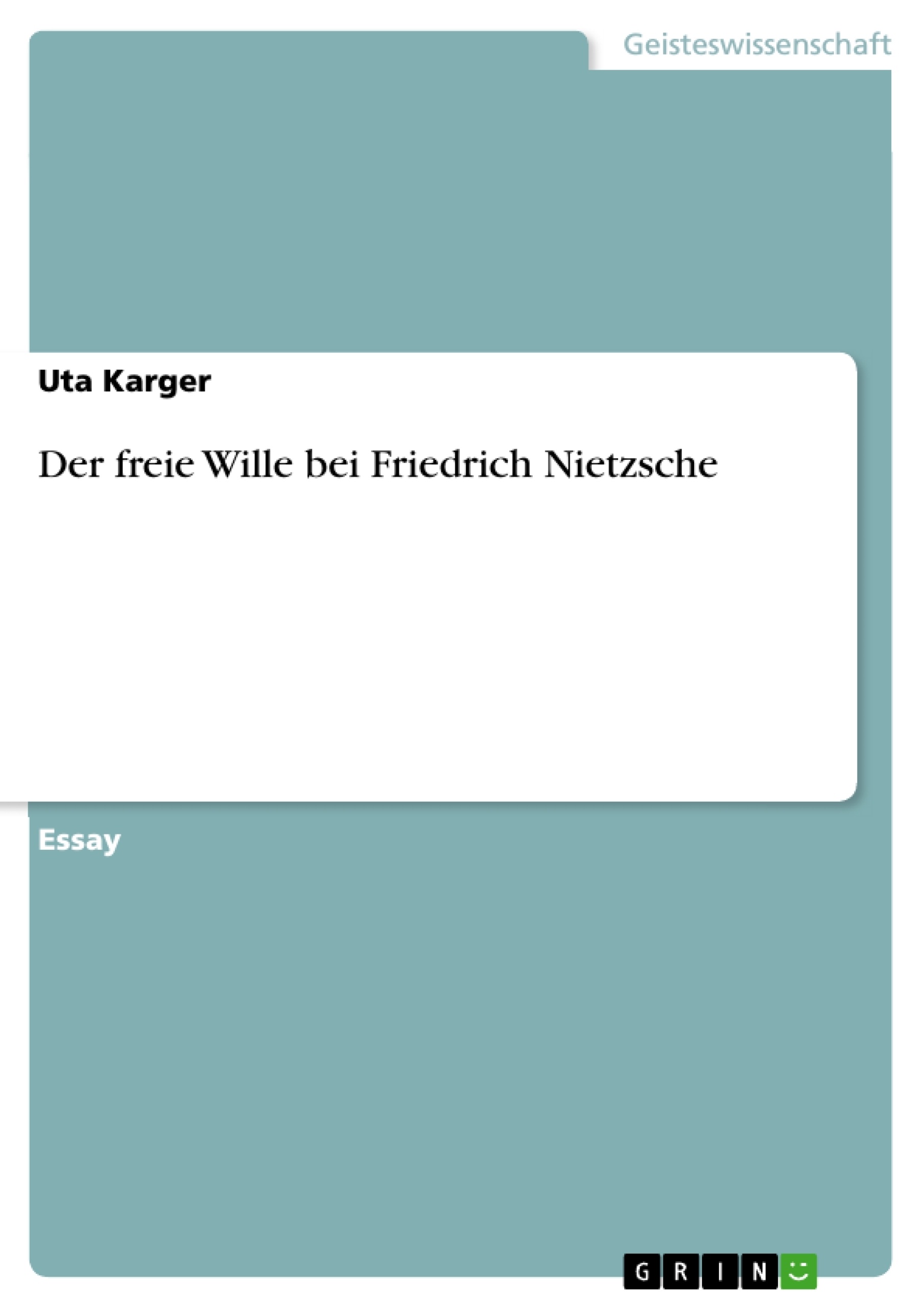Es gibt keine Verantwortlichkeit des Menschen für seine Handlungen. Nietzsche ist der Überzeugung, dass der Irrtum von der Verantwortlichkeit auf einer grundsätzlichen Verwechslung der Begriffe gut und böse beruht. Indem man eine Handlung schlicht als gut oder böse bezeichnet, lässt man deren Motive völlig außen vor. Allein durch ihre nützlichen oder schädlichen Folgen wird der Handlung diese Bewertung zuteil, man verwechselt Ursache und Wirkung. Von der Handlung wird sodann auf den ganzen Menschen geschlossen und dieser als gut oder böse bezeichnet. Der Mensch ist jedoch gänzlich dem Kausalitätsprinzip und der Notwendigkeit unterworfen, er kann also für rein gar nichts verantwortlich gemacht werden. Ebenso wenig gibt es eine Freiheit des Willens. Und nur, weil gewisse Handlungen Unmut nach sich ziehen, heißt das nicht, dass dies ein verantwortlich machen rechtfertigt. Aber kann sich jemand als Folge dessen über eine Bestrafung beschweren?
Inhaltsverzeichnis
- Friedrich Nietzsches These von der Nicht-Existenz der Willensfreiheit
- Die Verwechslung von gut und böse
- Der Determinismus und die Folgen
- Moritz Schlicks Kritik an Nietzsches Determinismus
- Naturgesetz vs. Juristisches Gesetz
- Der Denkfehler in Nietzsches Argumentation
- Die Folgen von Nietzsches Determinismus für die Gesellschaft
- Der Mensch als triebgesteuertes Wesen
- Das Prinzip der Bejahung des Lebens
- Die Frage nach der Selbstverwirklichung in einer individualistischen Gesellschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Essay befasst sich mit Friedrich Nietzsches These von der Nicht-Existenz der Willensfreiheit und den daraus resultierenden Folgen für die Gesellschaft. Der Essay analysiert Nietzsches Argumentation, die auf der Annahme eines absoluten Determinismus beruht, und vergleicht diese mit der Kritik von Moritz Schlick.
- Der Determinismus und die Willensfreiheit
- Die Unterscheidung zwischen gut und böse
- Die Folgen des Determinismus für die menschliche Verantwortung
- Die Rolle des Naturgesetzes in der Philosophie Nietzsches
- Das Konzept der Selbstverwirklichung in einer Gesellschaft von Individualisten
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet Nietzsches These von der Nicht-Existenz der Willensfreiheit. Nietzsche argumentiert, dass der Irrtum von der Verantwortlichkeit auf einer Verwechslung der Begriffe gut und böse beruht. Er kritisiert die Zuschreibung von moralischen Werten auf Basis von Folgen und nicht von Motiven und argumentiert, dass der Mensch dem Kausalitätsprinzip und der Notwendigkeit unterworfen ist.
Das zweite Kapitel widmet sich Moritz Schlicks Kritik an Nietzsches Determinismus. Schlick argumentiert, dass der Mensch zwar Naturgesetzen unterworfen ist, aber diese nicht als Zwang betrachtet werden sollten. Er stellt die Frage, welchem Gesetz der Wille folgt und kommt zu dem Schluss, dass es sich um ein psychologisches Gesetz handelt, das die Natur des Willens beschreibt.
Das dritte Kapitel untersucht die möglichen Folgen von Nietzsches Determinismus für die Gesellschaft. Es wird diskutiert, ob der Mensch als triebgesteuertes Wesen in einer Gemeinschaft funktionieren kann und welche Auswirkungen der absolute Egozentrismus auf die Selbstverwirklichung und die Beziehungen zwischen Menschen hätte.
Schlüsselwörter
Der Essay befasst sich mit zentralen Themen der Philosophie Nietzsches wie Determinismus, Willensfreiheit, Verantwortung, Moral, Naturgesetz, Selbstverwirklichung und Individualismus.
- Quote paper
- Uta Karger (Author), 2019, Der freie Wille bei Friedrich Nietzsche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/489483