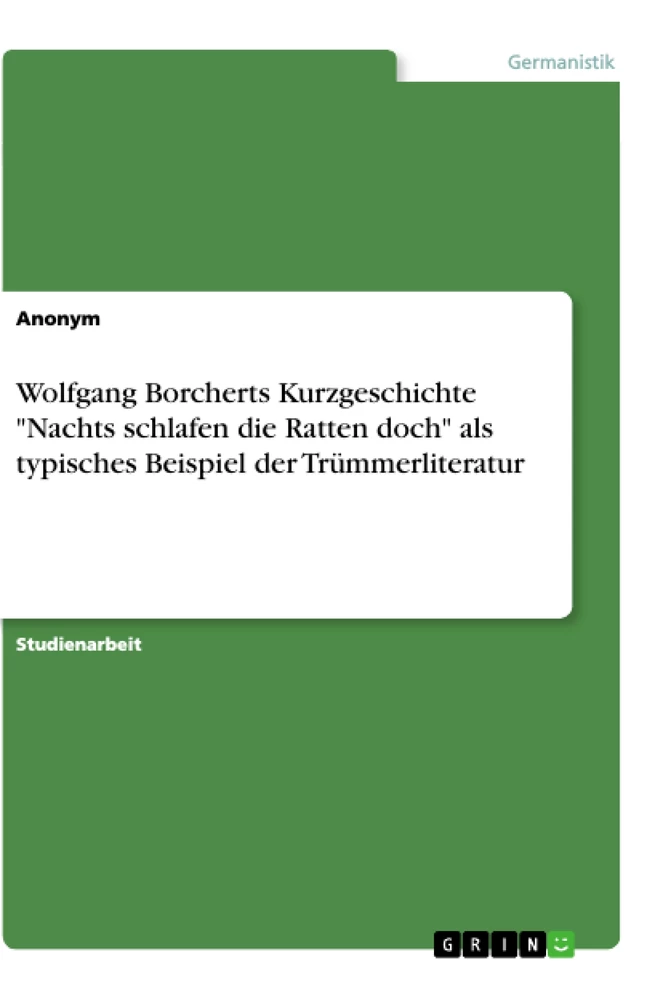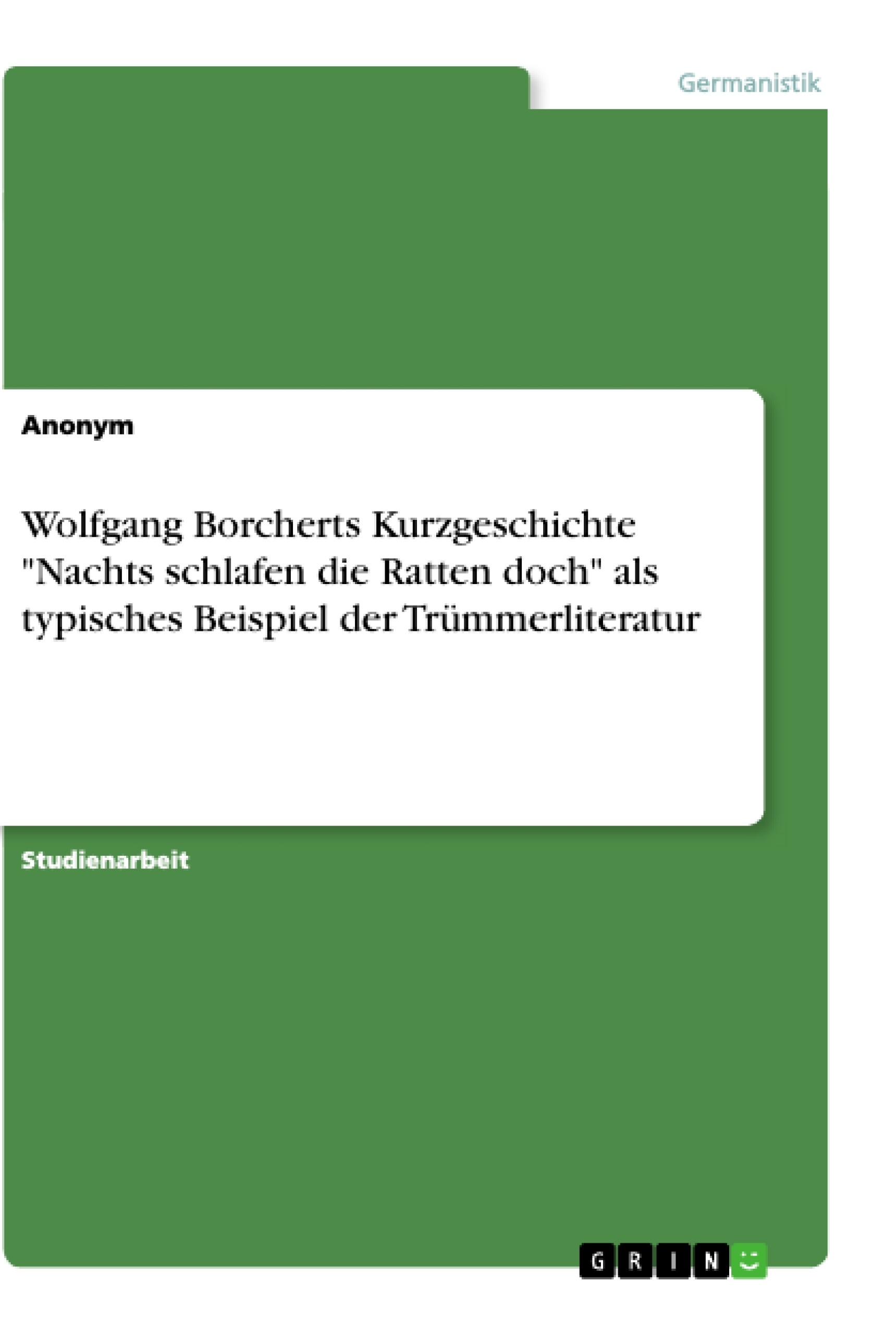Der Nationalsozialismus war zusammengebrochen, geflohene Autoren kehrten zurück in ihr Heimatland und der Einzug der Siegermächte führte zur Expansion deren Literatur. Diese hatte einen großen Einfluss auf die westdeutsche literarische Kunst. Doch zum Vorschein kam auch etwas völlig Neuartiges. Hierbei ging es um Heimkehrer, die weder vergessen konnten, noch wollten, was ihnen im Krieg widerfahren war. Aufgrund des Inhalts und Stils, wurden ihre ersten literarischen Werke nach 1945 mit „Trümmerliteratur“ betitelt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Wandel der deutschen Literatur ab 1945
- 2.1 Die Kurzgeschichte als Modell für die Trümmerliteratur
- 2.2 Die Multifunktionalität des Negativen
- 2.3 Das Negative als Katalysator für neue Handlungsweisen
- 2.4 Die Grundstruktur der Borchert-Geschichten
- 2.5 Die junge Generation aus der Sicht von Borchert
- 3. Untersuchung der Kurzgeschichte „Nachts schlafen die Ratten doch“
- 3.1 Inhalt der Kurzgeschichte
- 3.2 Struktur der Kurzgeschichte
- 3.3 Leblosigkeit vs. Lebendigkeit
- 3.4 Kind- vs. Erwachsensein
- 3.5 Der Kernsatz der Kurzgeschichte
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Kurzgeschichte „Nachts schlafen die Ratten doch“ von Wolfgang Borchert im Kontext der Trümmerliteratur. Ziel ist es, die typischen Merkmale dieser literarischen Strömung anhand des ausgewählten Textes zu analysieren und aufzuzeigen, inwiefern Borcherts Werk exemplarisch für die Nachkriegsliteratur steht. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Negativität, der Verarbeitung von Kriegserfahrungen und der Entwicklung von neuen Handlungsweisen der Protagonisten.
- Die Charakteristika der Trümmerliteratur
- Die Rolle des Negativen als erzählerisches Mittel und Katalysator
- Die Darstellung der „jungen Generation“ in Borcherts Werk
- Die Struktur und Thematik von Borcherts Kurzgeschichten
- Die Verarbeitung von Kriegserfahrungen und die Suche nach Hoffnung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Trümmerliteratur ein und begründet die Wahl von Wolfgang Borcherts Kurzgeschichte „Nachts schlafen die Ratten doch“ als Untersuchungsgegenstand. Sie erläutert die Bezeichnung "Trümmerliteratur" und den kontroversen Umgang damit. Der einleitende Abschnitt skizziert den Kontext der Nachkriegsliteratur, die geprägt war vom Einfluss amerikanischer und französischer Autoren sowie den Erfahrungen der Kriegsheimkehrer. Die Arbeit beschreibt ihr Ziel, die Merkmale der Trümmerliteratur anhand der ausgewählten Geschichte zu untersuchen, wobei die Negativität und die Entwicklungsprozesse der Protagonisten im Zentrum stehen.
2. Der Wandel der deutschen Literatur ab 1945: Dieses Kapitel analysiert den Wandel der deutschen Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg. Es beschreibt den Einfluss der Siegermächte und die Entstehung der Trümmerliteratur als Reaktion auf die Kriegserfahrungen. Die Adaption der amerikanischen „short story“ wird als wichtiger Faktor für die Entwicklung der Kurzprosa in der Nachkriegszeit hervorgehoben. Das Kapitel beleuchtet die „junge Generation“ und ihre literarischen Versuche, die erlebte Zerstörung und das Trauma des Krieges zu verarbeiten. Der Einfluss von Autoren wie Faulkner, Hemingway, Camus und Sartre auf die westdeutsche Literatur wird ebenfalls thematisiert.
2.1 Die Kurzgeschichte als Modell für die Trümmerliteratur: Dieser Abschnitt fokussiert auf die Bedeutung der Kurzgeschichte als dominante Form der Trümmerliteratur. Er beschreibt die typischen Merkmale dieser Form, wie die Konzentration auf die nackte Existenz des Menschen, Kargheit und Einfachheit des Stils sowie die Darstellung von typisierten Figuren. Die Adaption der "short story" als zeitgemäßer Schreibstil wird im Kontext der vorherigen Zensur unter dem Nationalsozialismus diskutiert und die Verbreitung durch Literaturzeitschriften erläutert. Die praktische Notwendigkeit kürzerer Texte aufgrund der Papierknappheit wird ebenfalls angesprochen.
2.2 Die Multifunktionalität des Negativen: Hier wird die omnipräsente Negativität in der Trümmerliteratur untersucht. Das Kapitel analysiert, wie die junge Generation die negative Atmosphäre, die durch die Schilderung der Kriegsfolgen und der Zerstörung entsteht, als Ausgangspunkt für neue Hoffnung und neue Handlungsweisen nutzte. Die "Multifunktionalität des Negativen" als Grundlage des Werks, als Ort des Geschehens und als Auslöser neuer Verhaltensweisen wird detailliert beschrieben. Es wird die Konfrontation mit der Realität und der Versuch, den Beginn einer neuen Zeit zu verkünden, erläutert.
2.3 Das Negative als Katalysator für neue Handlungsweisen: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf das Negative als Katalysator für neue Verhaltensweisen. Die typische Struktur vieler Werke der jungen Generation – ein negatives Ereignis, gefolgt vom Zusammentreffen von Personen, oft isoliert von ihrer Umwelt – wird analysiert. Die möglichen Ausgänge dieser Begegnungen – kein Fortschritt, einseitiger Fortschritt und gegenseitiger Fortschritt – werden dargestellt und deren Bedeutung im Kontext der Hoffnung und des Weges aus der Misere diskutiert. Der Fokus liegt auf den seltenen Fällen eines erfolgreichen Wandels und der Skepsis der jungen Generation gegenüber einfachen Antworten.
2.4 Die Grundstruktur der Borchert-Geschichten: Dieser Teil analysiert die wiederkehrende Struktur in Borcherts Kurzprosa: Ein Anfangszustand, ein Übergangszustand des Ausgestoßenseins und Disharmonie sowie ein Endzustand, der durch Unschlüssigkeit und die Schwierigkeit der Rückkehr zur Harmonie geprägt ist. Es wird betont, dass es sich nur um ein theoretisches Muster handelt, welches nicht in allen Werken Borcherts strikt eingehalten wird.
Schlüsselwörter
Trümmerliteratur, Wolfgang Borchert, Nachkriegsliteratur, Kurzgeschichte, Negative, Hoffnung, Junge Generation, Kriegserfahrungen, Handlungsweisen, „Nachts schlafen die Ratten doch“.
Häufig gestellte Fragen zu "Nachts schlafen die Ratten doch" - Eine Analyse
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Wolfgang Borcherts Kurzgeschichte "Nachts schlafen die Ratten doch" im Kontext der Trümmerliteratur. Sie untersucht die typischen Merkmale dieser literarischen Strömung anhand des ausgewählten Textes und beleuchtet, inwiefern Borcherts Werk exemplarisch für die Nachkriegsliteratur steht. Der Fokus liegt auf der Darstellung von Negativität, der Verarbeitung von Kriegserfahrungen und der Entwicklung neuer Handlungsweisen der Protagonisten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Charakteristika der Trümmerliteratur, die Rolle des Negativen als erzählerisches Mittel und Katalysator, die Darstellung der „jungen Generation“ in Borcherts Werk, die Struktur und Thematik von Borcherts Kurzgeschichten sowie die Verarbeitung von Kriegserfahrungen und die Suche nach Hoffnung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über den Wandel der deutschen Literatur ab 1945 (mit Unterkapiteln zur Kurzgeschichte als Modell für die Trümmerliteratur, der Multifunktionalität des Negativen, dem Negativen als Katalysator für neue Handlungsweisen und der Grundstruktur von Borcherts Geschichten), ein Kapitel zur Untersuchung der Kurzgeschichte "Nachts schlafen die Ratten doch" (mit Unterkapiteln zu Inhalt, Struktur, Leblosigkeit vs. Lebendigkeit, Kind- vs. Erwachsensein und dem Kernsatz) und ein Fazit.
Wie wird die Trümmerliteratur charakterisiert?
Die Trümmerliteratur wird als Reaktion auf die Kriegserfahrungen beschrieben. Es werden die Einflüsse amerikanischer und französischer Autoren sowie die Adaption der amerikanischen "short story" als wichtige Faktoren für die Entwicklung der Kurzprosa in der Nachkriegszeit hervorgehoben. Die Konzentration auf die nackte Existenz des Menschen, Kargheit und Einfachheit des Stils sowie die Darstellung von typisierten Figuren werden als typische Merkmale genannt. Die omnipräsente Negativität wird als Ausgangspunkt für neue Hoffnung und neue Handlungsweisen interpretiert.
Welche Rolle spielt das Negative in der Analyse?
Das Negative spielt eine zentrale Rolle. Es wird als omnipräsentes Element der Trümmerliteratur analysiert, als erzählerisches Mittel und als Katalysator für neue Handlungsweisen der Protagonisten. Die Arbeit untersucht, wie die junge Generation die negative Atmosphäre als Ausgangspunkt für neue Hoffnung und neue Verhaltensweisen nutzte. Die "Multifunktionalität des Negativen" wird detailliert beschrieben.
Wie wird die "junge Generation" dargestellt?
Die "junge Generation" wird als Gruppe beschrieben, die versucht, die erlebte Zerstörung und das Trauma des Krieges zu verarbeiten. Ihre literarischen Versuche, mit der Realität zu konfrontieren und den Beginn einer neuen Zeit zu verkünden, stehen im Mittelpunkt. Die Arbeit betont die Skepsis dieser Generation gegenüber einfachen Antworten.
Welche Struktur haben Borcherts Kurzgeschichten?
Die Arbeit analysiert eine wiederkehrende Struktur in Borcherts Kurzprosa: Ein Anfangszustand, ein Übergangszustand des Ausgestoßenseins und Disharmonie sowie ein Endzustand, der durch Unschlüssigkeit und die Schwierigkeit der Rückkehr zur Harmonie geprägt ist. Es wird betont, dass es sich nur um ein theoretisches Muster handelt.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Trümmerliteratur, Wolfgang Borchert, Nachkriegsliteratur, Kurzgeschichte, Negative, Hoffnung, Junge Generation, Kriegserfahrungen, Handlungsweisen, „Nachts schlafen die Ratten doch“.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2016, Wolfgang Borcherts Kurzgeschichte "Nachts schlafen die Ratten doch" als typisches Beispiel der Trümmerliteratur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/489402